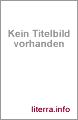|
|
Startseite > Rezensionen > Michaela Dittrich > Belletristik > Die Selbstmordschwestern |
Die Selbstmordschwestern
| DIE SELBSTMORDSCHWESTERN
Buch / Belletristik |
Jeffrey Eugenides ist 2003 als Autor mit seinem umfangreichen Roman „Middlesex“ ganz groß rausgekommen. Den Pulitzer Preis hat er eingeheimst, die Leser sind begeistert und die Kritiker singen eine Lobeshymne nach der anderen. Selten waren sich Fachpresse und Publikum so einig – und selten so gerechtfertigt. „Middlesex“ ist ein Buch, dass man gern im Regal stehen hat, in dem man gern blättert, schmökert und dessen Geschichte man sofort verfällt. Da aber auch der dickste Schmöker einmal ausgelesen ist, macht man sich auf die Suche nach anderen Romanen des Autors und wird nur einen finden: „Die Selbstmordschwestern“, ein Roman, der eher durch seine Verfilmung durch Sofia Coppola („The Virgin Suicides“) bekannt geworden ist und der in Deutschland lange Zeit vergriffen war.
Dieser schmale Debutroman (knapp 200 Seiten) spielt in einem Vorort von Detroit, in einer nicht näher bezeichneten Vergangenheit – schätzen wir mal, es handelt sich um die 60er Jahre. Im Hause der Lisbons – Vater Lehrer, Mutter Hausfrau – gibt es fünf bildschöne Mädchen: Cecilia, Therese, Lux, Mary und Bonnie. Alle fünf betören die in derselben Straße wohnenden Jungen – vor allem durch ihre Abwesenheit. Denn die Lisbonschwestern verlassen kaum das Haus. Eines Tages jedoch findet man Cecilia mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne; sie kann eben noch von den Ärzten gerettet werden. Doch die damit gewonnene Zeit ist nur ein Aufschub. Als die Lisbons eine Party für Cecilia veranstalten (auf Anraten des Krankenhauspsychiaters), verlässt diese den Partykeller, um sich aus einem Fenster im Obergeschoß zu stürzen. Sie fällt auf einen Zaunpfahl und ist sofort tot.
Die restlichen vier Schwestern werden ihr innerhalb eines Jahres folgen. Und immer schauen ihnen die Nachbarsjungen in die Fenster, um einen Blick zu erhaschen. Sie sind es auch, die später durch Interviews, Fotos und andere Beweismittel versuchen zu rekonstruieren, warum sich die Libson-Schwestern umbrachten. Doch wer auf eine schlüssige Erklärung hofft, wird enttäuscht werden. Zwar gibt es viele Indizien, jedoch keine unverrückbaren Beweise.
So leben die Lisbon Schwestern beispielsweise nach Cecilias Tod wie Gefangene in ihrem eigenen Haus. Nie gehen sie aus, nie verlassen sie auch nur das Haus um so profane Dinge wie den wöchentlichen Einkauf zu erledigen. In der Schule spricht kaum jemand mit ihnen. So geistern sie durch den Roman ohne je selbst eine Stimme zu erhalten. Der Leser erlebt sie immer nur durch die Augen der Jungen, die begierig auf Bewegungen hinter den Fenstern der Schwestern warten. Weil sie immer nur reflektiert von jungenhafter Wahrnehmung an den Leser geraten, erscheinen sie umso fremdartiger, mysteriöser und eigenbrötlerischer. Da hilft es auch nicht, wenn sie sich die Schwestern mit Familienpackungen Tampons im Bad eingeschlossen imaginieren, wo sie ihren betörenden Mädchengeruch verströmen, kichern und erzählen. Die vier verbleibenden Schwestern bleiben ungreifbar – zwar sind sie der Kern der Geschichte, doch scheinen sie seltsam außerhalb zu schweben.
Eugenides schildert virtuos den Mikrokosmos einer typischen Vorortstraße. Obwohl der Roman so ökonomisch gehalten ist, beschwört er eine komplette Welt herauf: Die gepflegten Vorgärten, den Gruppenzwang innerhalb der Nachbarn, das Rasenmähen am Samstag und das Laub verbrennen im Herbst, die lokale Presse, die Außenseiter in der Nachbarschaft (eine deutsche Familie, die gleich mal zu Nazis gestempelt wird) und die dazu gehörige High School mit ihren Football Matches und Abschlussbällen. Es ist alles da und alles ist genauestens beobachtet. Sofort fühlt man sich auf subtile Weise beengt, als fände das ganze Leben nur in dieser Straße statt und als gäbe es kein woanders. So verschwinden die übrig gebliebenen Lisbon-Eltern am Schluss nicht nur aus der Straße, sondern auch aus dem Leben.
Als Leser macht man sich keine Illusionen. Dass keine der Lisbon Schwestern den Roman überleben wird, machen die Erzähler gleich auf der ersten Seite unmissverständlich klar. Also liest man nicht in der Hoffnung weiter, dass die Mädchen gerettet werden könnten. Stattdessen wird man wie die Nachbarn, die den Verfall des Lisbon Hauses beobachten, zum Voyeur. Man weiß, dies wird kein gutes Ende nehmen – und gerade deshalb will man keine Sekunde verpassen. Doch natürlich wird man auch von dem „Warum“ umgetrieben. Warum wählten sie keinen anderen Weg? Flucht von zu Hause? Der Versuch, mit anderen Kontakt aufzunehmen? Warum vergruben sich die Schwestern in ihren Zimmern um sich in letzter Instanz umzubringen? Endgültige Antworten finden sich darauf, wie gesagt, nicht. Eugenides lässt den Leser am Schluss des Romans mit einem Schulterzucken zurück. Er mag die alte literaturtheoretische Prämisse, nach der sich am Ende des Romans jemand an dem Nagel aufhängen müsse, der am Anfang in der Geschichte vorkam. In „Die Selbstmordschwestern“ hängt sich zwar jemand auf, doch findet sich kein entsprechender Nagel. Vielmehr sind es Dutzende Nägel, unter denen man den entscheidenden nicht ausmachen kann.
„Die Selbstmordschwestern“ ist ein Debutroman, der auf die überdurchschnittlichen Fähigkeiten seines Autors schließen lässt. Schon hier klingen einige Themen an, die er in „Middlesex“ zur Meisterschaft bringt. Das Eintauchen in pubertäre Geisteszustände scheint eine seiner Leidenschaften zu sein. So versteht er es, sowohl die weibliche, als auch die männliche Perspektive mit viel Einfühlungsvermögen zu beschreiben. Auch sein Stil nähert sich hier schon an einigen Stellen Erzähltechniken im Film an, wobei „Die Selbstmordschwestern“ viel mehr geradeaus erzählt ist als „Middlesex“. Es wird weniger abgeschweift, um die unheilschwangere Atmosphäre des Romans nicht zu stören.
Im direkten Vergleich mit „Middlesex“ bleiben „Die Selbstmordschwestern“ leicht zurück – wobei der Roman immer noch um Längen besser ist als vieles, was uns die Bestsellerlisten so aufschwatzen möchten. Eugenides hat sich einen überaus originellen Plot ausgedacht, den er durch die interessante Perspektive (die Draufsicht der Jungen – ohne dass die Mädchen je selbst zu Wort kämen) noch spannender gestaltet. Da kann ja nur ein lesenswertes Buch herauskommen!
Der Rezensent
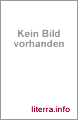 Michaela Dittrich
Michaela Dittrich Total: 22 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info