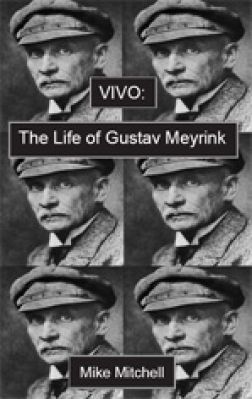|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Biographie > VIVO: The Life of Gustav Meyrink |
VIVO: The Life of Gustav Meyrink
| VIVO: THE LIFE OF GUSTAV MEYRINK
Mike Mitchell Daedalus Verlag |
Mike Mitchell hat eine mit seinem vorliegenden Text eine weitere Biographie des markanten deutschsprachigen Autors der Prager Vorkriegsboheme dem umfangreichen Kanon von Literatur über den Verfasser des Golems hinzugefügt. Auf Englisch und bei einem englischen Verlag veröffentlicht. In seinen Vorbemerkungen macht Mitchell, der eine Reihe von Meyrinks Kurzgeschichten und wenigen Romanen ins Englische übersetzt hat, seine Intention klar. Es geh nicht darum, eine neue Biographie zu den Arbeiten Edward Franks, Manfred Lubes oder Mohammed Quasims, sowie Frans Smits monographischer Untersuchungen hinzuzufügen, sondern das Leben Meyrinks dem britischen Leser vorzustellen und vieles aus den deutlich umfangreicheren Arbeiten der aufgeführten Autoren zu relativieren. Im Kern ist „Vivo: The Life of Gustav Meyrink“ eine Art Überbiographie, ohne es von der grundlegenden Ausrichtung her sein zu wollen.
Mitchells gut zu lesende, ungewöhnlich kompakt geschriebene Studie – im Rahmen der „The Dark Masters“ Reihe erschienen – teilt sich im Grunde in Meyrinks Leben und später eine Auseinandersetzung zwischen seinen insbesondere spirituellen Ansichten sowie seinem Werk. In Bezug auf die bekannten historischen Daten beginnt Mitchell die verschiedenen Biographien sowie meistens schriftliche vorliegende Aussagen von Zeitzeugen miteinander zu verbinden bzw sie konträr wie kritisch hinterfragend zu vergleichen. Tagebuchaufzeichnungen Meyrinks sind spärlich und die Korrespondenz besteht in erster Linie aus geschäftlichen Briefen mit seinen diversen Verlegern. Ein einziger Brief an seine Mutter ist übrig geblieben. Anfänglich versucht der Autor im Gegensatz zu seinen Mitbiographen Belege für ein schlechtes Verhältnis zwischen Mutter und Sohn an Hand seiner Werke zu bestimmen. Vieles was obige Autoren eher gefällig als konsequent implizieren, kann Mitchell negieren. Aus dieser kontinuierlichen Gegenüberstellung ergibt sich eine kurzweilig zu lesende, vor allem in erster Linie für Gustav Meyrink Anhänger neue Facetten miteinander vereinbarende biographische Studie, dessen Fokus nicht die tiefgehende Analyse, sondern die Zusammenfassung, Richtigstellung und Neubewertung des eher spärlichen historischen Materials darstellt. Von dieser soliden Basis ausgehend untersucht der Autor wichtige Lebensabschnitte Meyrinks. Er räumt endgültig mit der Legende auf, dass Meyrink während seines Aufenthalts in Prag als junger Bänker Kundengelder unterschlagen und Betrügereien begangen hat. Obwohl er in jungen Jahren einem opulenten wie provozierenden Lebensstil – in erster Linie aus der Erbschaft seines adligen Vaters finanziert, der zwar seine illegitime Geburt niemals offiziell anerkannt, ihn aber zumindest monetär abgesichert hat - lagen die Gründe des Zusammenbruchs seiner kleinen Bank/ Wechselstube in seinem fehlenden Geschäftsinn. Interessanterweise hat – ein Widerspruch, dem Mitchell nicht weiter auf den Grund geht – Gustav Meyrink in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sein ansehnliches, aber angesichts seiner Lebensumstände zu kleines Einkommen als Schriftsteller mit „Vertreterarbeiten“ bzw. zumindest einem kleinen Handel in Wertgegenständen wie Schmuck oder Antiquitäten aufgebessert. Kaufmännisch gänzlich unbedarft kann er also nicht gewesen sein. Ausgesprochen sachlich und viele Gerüchte dank der spärlichen Faktenlage widerlegend zeichnet Mitchell das Portrait eines Mannes, den der Gefängnisaufenthalt ruiniert hat, der aber mit seinem aufbrausenden Gehabe und seiner provozierenden Art sich zu viele Feinde geschaffen hat, um nicht ein bisschen selbst am Fall aus der sich wandelnden Prager Gesellschaft Schuld zu sein.
Interessanterweise werden Gustav Meyrinks schriftstellerische Anfänge gänzlich anders als in vielen Biographien dargestellt. Hier gibt Mitchell nicht seinen Mitkollegen, sondern eher den Jahrzehnten Schuld, die manche Erinnerung getrübt haben. Die ersten Satiren im „Simplicissimus“ folgen ersten eher naturalistischen schriftstellerischen Übungen. Auch hier stört sich Meyrink am bürgerlichen Spießertum – siehe auch Heinrich Mann, bzw. Thomas Mann, der Meyrink sehr früh in dessen literarischer Laufbahn in seiner Novelle Tonio Kröger ein literarisches Denkmal gesetzt hat - , dem Adel sowie dem Militär. Alles Gruppen, denen er aufgrund seiner illegitimen Geburt, seiner nur kurzzeitig zur Verfügung stehenden Mittel sowie seiner schwächlichen Gesundheit – im Grunde ein Widerspruch zu den späteren sportlichen Erfolgen als Ruderer - nicht angehören konnte bzw. angehören wollte.
Bis zur Arbeit an seinem ersten weltberühmten Roman „Der Golem“ bleiben die biographischen wie auch die literarisch kritischen Teile eng verwoben. Es gibt nur wenige Vorgriffe wie auf seine späteren Erfolge als Ruderer am Starnberger See oder die finanziellen Notlagen, die Meyrinks Zeit nach dem Abschied aus Prag prägen sollen. Mit der Veröffentlichung des Golems, der Meyrink wegen eines großzügigen Vorschuss und der Abtretung der Rechte nicht zu einem gemachten Mann macht, verschiebt sich der Fokus der Biographie. Das literarisch kritisierende Element tritt deutlich mehr in den Mittelpunkt der Betrachtungen und Mike Mitchell versucht aus Meyrinks Werk Rückschlüsse insbesondere auf dessen spirituelle Einstellung sowie sein späteres Leben zu ziehen. Das Gustav Meyrnk mit sehr viel Freude Bekannte und Freunde sowie seine zahlreichen Feinde in seinen Kurzgeschichten „verarbeitet“ hat, ist bekannt. Weniger bekannt sind die Quellen seiner zahlreichen grotesken und bitterbösen Geschichten. Hier hilft Mike Mitchell sehr gut recherchiertes Büchlein, Bezüge zwischen literarischer Adaption und der harten Realität herzustellen.
Wer aber jetzt intensive Auseinandersetzungen mit Meyrinks Werk erwartet, wird verwundert vielleicht sogar enttäuscht. Wie bei der systematischen Trennung zwischen Fiktion und Fakt in Bezug auf Meyrinks Leben konzentriert sich Mike Mitchell bei der Analyse insbesondere der Romane auf die Relation zwischen Autor und Werke. Bei „Der Golem“ zeigt der Autor die unterschiede zwischen der jüdischen „Golem“ Legende und Meyrinks Roman, der die Saga als Sprungbrett zu einer kritischen Auseinandersetzung nicht nur mit seiner Prager Zeit, sondern vor allem seinen aus seiner Sicht spießigen und arroganten Mitmenschen nutzt. Viele Aspekte des Originalromans sind insbesondere durch die anhaltende Popularität der zweiten Paul Wegener Verfilmung des Golems in Vergessenheit geraten, Mike Mitchell bemüht sich ausgesprochen kompakt und stellenweise ein wenig oberflächlich, diese wieder ans Tageslicht zu holen und entsprechend der bekannten biographischen Fakten einzuordnen. Manches bleibt trotzdem im Bereich der Spekulation förmlich stecken. In Bezug auf seine späteren Romane vergleicht Mitchell Meyrinks spirituelle Erfahrungen, die er wie ein Süchtiger fast verzweifelt gesucht hat, mit den Erlebnissen seiner Charaktere. Für Anhänger und Kenner des Oevres sicherlich eine interessante Vergleichsmöglichkeit; wer die rezensionstechnisch angerissenen Bücher wie „Das grüne Gesicht“ oder „Der weiße Dominikaner“ nicht kennt, wird manchem Zusammenhang nicht folgen können. In Bezug auf Gustav Meyrinks letzten abgeschlossenen Roman „Der Engel vom westlichen Fenster“ versucht Mitchell zu eruieren, wie viel Meyrink selbst geschrieben und welche Prozentanteile der sich später als neunzigprozentiger Alleinautor rühmende Alfred Schmid-Noerr verfasst hat. Mitchells Begründungen erscheinen frustrierend oberflächlich, auf die möglichen stilistischen Nuancen geht er bis auf einige eher plakative Anmerkungen nicht weiter ein. Das einzige wirklich schlagkräftige Argument scheint Meyrinks durch seinen Tod unvollendeter fragmentarischer vorliegender Roman zu sein, den er erst nach „Der Engel vom westlichen Fenster“ in Angriff genommen hat.
In Bezug auf Meyrinks literarisches Werk bleibt die Analyse von den ersten Kurzgeschichten bis zum unvollendeten Roman manchmal zu oberflächlich, zu stereotyp, als wenn die literarische Abrechnung mit erlittenen Ungerechtigkeiten alleine die Qualität einer Kurzgeschichte bestimmt. Zumindest bemüht sich Mitchell, den spirituellen Grundlagen und Meyrinks Kontakten in verschiedene esoterische Zirkel auf die Spur zu kommen und eine gegenseitige Abhängigkeit herauszuarbeiten.
In Bezug auf Meyrinks letzten Lebensabschnitt mit dem Selbstmord seines einzigen Sohnes sowie seinen inzwischen chronisch gewordenen Krankheiten schlägt der Autor den Bogen zu dessen Vorstellung, dass das Leben auf der Erde nur eine Zwischenstation ins – von Meyrink nicht immer optimistisch beurteilte – Jenseits ist.
Mike Mitchells Biographie „Vivo- The Life of Gustav Meyrink“ ist eine eher gewöhnungsbedürftige, aber gut zu lesende distanziert und nicht emotional geschriebene Studie eines zerrissenen Lebens, das Triumphe wie Tragödien fast im übertriebenen Maße umfasste und in dessen Mittelpunkt ein Mann stand, der aufgrund seiner unehelichen Geburt und den zerrissenen politischen wie sozialen Verhältnissen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sowie seiner spöttisch zynischen Art niemals wirklich eine Heimat gefunden hat. Als Eingangslektüre ist Mike Mitchells Studie aufgrund der zahlreichen Querverweise zu den bislang publizierten Biographien nicht unbedingt geeignet. Es lohnt sich, als Einstiegslektüre in die umfangreiche Materie Meyrink/ Spiritualismus/ Prager Boheme die nicht selten zur Legendenbildung neigende Arbeit eines Edward Franks oder Manfred Lubes zu erst zu lesen, um dann Mike Mitchells viele Gerüchte/ Spekulationen sowie unbegründete Schnellschüsse relativierende Ergänzungsbiographie zu goutieren.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info