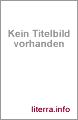|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Horror > Move under Ground |
Move under Ground
| MOVE UNDER GROUND
Buch / Horror |
Viele Autoren sind an der Herausforderung gescheitert: Lovecrafts Mythos in die Gegenwart oder die nähere Vergangenheit zu übertragen und trotzdem eine originelle Geschichte erzählen zu können. In Deutschland versuchten sich zuletzt Michael Marrak und Andreas Gruber an der Quadratur des Kreises. Sie scheiterten weniger an ihren sehr gut angelegten Konzepten, sondern an der Notwendigkeit, irgendwann den Schleier von den Monstern nehmen zu müssen. Verschiedene Kombinationen unterschiedlicher und auf den ersten Blick kontraproduktiver Themen können das Thema eher beleben. Vor kurzer Zeit erschien im Bastei Verlag die Anthologie „Schatten über Baker Street“, die den berühmten englischen Privatdetektiv gegen die Alten antreten ließ. Nick Mamatas setzt dagegen auf die goldenen sechziger Jahre mit ihrem beginnenden Underground Journalismus, der Jahre des Sommers der Liebe, des Vietnamkrieges und schließlich deren Wurzeln in der so genannten Beat Generation. Wer diese Zeit nicht miterlebt hat und dazu werden die meisten Leser dieses kurzen Romans gehören, kann einen kurzen Blick im Terry Gilliams berüchtigt berühmten Film „Fear and Loathing in Las Vegas“ werfen oder eben den noch bekannteren Roman Jack Keouac – „On the Road“ – lesen, der Hauptperson dieser fiktiven Geschichte.
Heute werden sich viele Leute fragen, wer denn überhaupt dieser Jack Keouac ist oder besser gewesen ist. Für einen kurzen Augenblick in der langen literarischen Geschichte dieser Welt und den wenigen eigenständigen Impulsen amerikanischer Literaturströmungen – viele Kritiker sagen, außer den Comics und der Science Fiction hätten sich Amerikas Autoren kein eigenständiges Gesicht erkämpft – gehörte er zu den bekanntesten und am meisten gelesenen Autoren des Landes. Heute ist er vielleicht noch das Idol einer ergrauten und an den eigenen Träumen gescheiterten Generation unfreiwillig Gestriger. Wie viele Randexistenzen verfügt er über eine Handvoll eifriger Anhänger, die ihn als Vorbild der inzwischen fast unbekannten Beatgeneration feiern. Vor den Hippies gab es die Beatniks. Ihre Geburtsstunde waren die soziale Stagnation der fünfziger Jahre und die bedrückende Atmosphäre einer dem kalten Krieg unfähig gegenüberstehenden Regierung. Das Erbe eines Volkes, das sich zwischen Koreakrieg und McCarthy fast selbst gespalten hat. Vor Kennedy standen die Beatnicks stellvertretend für die kommenden sozialen Unruhen des Schmelztiegels Amerika. Und eines ihrer Idole war eben der wenig kommerzielle Schriftsteller Jack Kerouac. Nick Mamatas hat sich mit seiner zweiten längeren Arbeit um die Frage gekümmert, was aus diesem realen Jack Kerouac fiktiv geworden ist. Viele sagen heute noch, er konnte weder den Erwartungen seiner Fans und Groupies gerecht werden noch dem Druck des kommerziellen Literaturgeschäftes, gegen das er sich wehrte, auf dessen Wellen er trotzdem mit geschwommen ist, ausweichen. So wurde er zum Alkoholiker und verschwand schließlich in der Einsamkeit einer sich immer schneller drehenden Zivilisation. Nick Mamatas behauptet dagegen, Kerouac hat gegen die alten Götter gekämpft. Während seiner Entziehungskur in der Isolation haben sich die Meere erhoben und die alten Götter Cthulhu und Azathoth haben sich erhoben.
Dabei verknüpft Mamatas Kerouacs individuellen und sich Ich-bezogenen Schreibstil mit einer klassischen metaphorischen Monsterhandlung. Dabei bemüht er sich, sehr intelligent die Brücke zu den überwiegend in den zwanziger Jahren bis in die Weltwirtschaftskrise hinein entstandenen Lovecraftgeschichten zu schlagen. Der Leser verspürt immer wieder das Auseinanderbrechen der Realität, den Einfluss aus dem Hintergrund dieser unbeschreiblichen Monster und den verzweifelten Versuch der einzelnen Charaktere, ihre für sie verzehrte Realität nicht noch mehr zu verlieren. Dabei lassen sich die eindrucksvollen Bilder als Auswüchse unbeschreiblichen Horrors oder als Nachwirkungen diverser Drogenorgien interpretieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, in denen normale Menschen langsam auf den Abgrund zusteuern, sind Mamatas Charaktere den berühmten Schritt weiter. Sie haben ihre Grenzen überschritten und sich ein eigenes Amerika erschaffen. Diese Illusion wird von den Monstren von jenseits der Grenze bedroht. Dabei spielt es jetzt keine Rolle mehr, ob das reale oder das irreale Amerika zerstört werden könnte. Trotz ihrer kritischen Haltung gegenüber der Spießergesellschaft sehen es Mamatas schräge, aber durchaus lebensnahe Figuren als ritterliche Aufgabe an, Amerika zu retten. Auch wenn sie die „andere“ Kultur nicht lieben. Im Grunde erschafft Mamatas die gleiche übertrieben stilisierte Kunstwelt, die Lovecraft als Hintergrund seiner Geschichten gesehen und verfolgt hat.
Dabei sind sich die handelnden Protagonisten auch unheimlich ähnlich. Jack Kerouac kann mit dem Ruhm nicht fertig werden und lebt in einer einsamen Hütte. Lovecraft selbst war sein Leben lang Außenseiter, ein verschlossener Mensch, der mehr über Briefe mit seiner Umwelt in Kontakt getreten ist. Kerouac produzierte Unmassen von literarischen Ergüssen, scheinbar auf Endlospapier, das er bei Bedarf an seinen Verleger gibt. Sowohl Kerouac als auch Lovecraft sind in dieser Form nicht lebensfähig und dadurch prädestiniert, dem Einfluss der Alten zu unterliegen. Mamatas integriert auch die vorherrschenden stilistischen Elemente beider Autoren in diese ungewöhnliche Story: So herrscht indirekte Rede vor, der Leser kann die Geschichte fast ausschließlich aus Jack Kerouacs innere Perspektive verfolgen. In dessen Texten gab er vor, eigene Motive und Handlungen wiederzugeben. Auch Lovecraft bevorzugte die Ich-Perspektive und bemühte sich insbesondere in seiner fiktiven Stadt um größtmögliche Authentizität. Trotzdem erschufen beide Autoren nur idealisierte Kunstwelten, in denen sie sich wohler fühlten als in der jeweiligen, sie erdrückenden Realität. Augenscheinlich hat Mamatas Lovecrafts Ideen und Eigenheiten einfach in ein literarisches Genres übertragen, dessen Blüte erst vierzig Jahre und einen Weltkrieg später entstanden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Bad in den Maden das Ergebnis eines Drogenrausches oder eine grenzüberschreitende Erscheinung ist. In verblüffender Klarheit erkennt der Leser, wie wenig und doch wie viel diese beiden Charaktere gemeinsam haben. Es stellt sich die Frage, ob Lovecraft vielleicht schon unter Drogen seine Texte geschrieben hat oder Jack Kerouac zumindest einen Teil dieser bekannten und oft als Schund abgewerteten Texte gelesen hat. Was kann einen Beatnick mehr erfreuen, als Texte zu lesen, die die Öffentlichkeit mit Abscheu ablehnt?
Aber in gleichen Moment kann und sollte der Leser hinter die Kulisse schauen. Was cool und originell ist, ist nur der äußere Rahmen. Nick Mamatas ist ein zu intelligenter Autor, um das äußere Bild dem Inneren gleichzusetzen. Der Leser muss sich allerdings seinen Weg durch den oft verschachtelten und damit auch nicht leicht zu lesenden Text kämpfen. Der Leser muss dabei nicht unbedingt Gefühle für die Beatbewegung auf der einen oder den lovecraft´schen Horror auf der anderen Seite aufbringen, es hilft allerdings für das Verständnis des Textes ungemein, eine gewisse Toleranz zu haben. Der Roman ist bewusst in Kerouacs nicht leicht verständlichem Stil mit seiner wilden Mischung aus verschiedenen Ebenen – zusätzlich aus der immer gleichen Perspektive des Autoren – und verschiedenen nahtlos in einander übergehenden Realitäten geschrieben worden. Dazu in einem leicht ironisch- lakonischen Stil mit einem genauen Auge für Unstimmigkeiten unserer heutigen und der damaligen sechziger Jahre Gesellschaft. Geschickt extrapoliert Mamatas diese Tendenzen und integriert diese in die Vergangenheit. Das Resultat ist verwirrend.
Um die zugrunde liegende Reise durch Amerika zu verstehen, braucht der Leser sich weder mit der Lebensauffassung der Beats noch der dunklen amerikanischen Trauma auseinandersetzen. Mamatas variiert diese beiden Komponenten. Zu Beginn wirkt die Geschichte wie ein unzugänglicher Drogentrip, in der Mitte wie eine klassische Quest im Stil der Weird Tales Magazine mit dem Ziel, das erwachende Böse wieder in den Schlaf zu wiegen und schließlich der Kumulation in einem zynischen, düsteren und damit auch Generationen umspannenden Ende. Wer eine Botschaft sucht, wird sie nicht im eigentlichen Roman, sondern im mit sieben Seiten doch ausführlichen Epilog finden. Kerouac und sein Alter Ego Neal haben das imperialistische Amerika gerettet, welche Ironie schwingt alle in diesem Höhepunkt seines Romans mit. Die Reise und der Konflikt lassen Jack Keouac verbittert zurück. Er ist inzwischen Alkoholiker, seine Fans verfolgen ihm auf Schritt und Tritt, um in seinem literarischen Schatten ihre persönliche Erfüllung zu finden und er kann kaum seine primitive Hütte verlassen. Dort stapeln sich seine immer verschlüsselteren Werke, die kaum noch bei einem Verlag zu platzieren, geschweige denn zu verkaufen sind.
Das dieser Beatnickautor die Welt gerettet hat, steht in keiner Zeitung. Zynisch schreitet er seine innere Verzweifelung heraus, doch – wie in seinem bisherigen Leben – nehmen die meisten nicht den Menschen Keouac war, sondern nur den poetischen Literaten. Erst diese Szenen heben die bislang oberflächlich interessante, geradlinige Geschichte aus dem Mittelmass heraus. Auf den ersten fast zweihundert Seiten beschränkte sich Mamatas auf seine originelle Idee, bevölkert mit eher unscheinbaren, durchschnittlichen Charakteren und kaum vorhandener erzählerischer Spannung.
Mit dem Epilog will uns wahrscheinlich der Autor aufklären. Die bisherige Handlung wird auf eine Hülle reduziert. Dann lassen sich verschiedene Interpretationen zu. Doch Mamatas hat seinen Jack Keouac als Menschen angelegt, der geachtet und geliebt werden möchte. Dabei hat er eine schwierige Beziehung zum Ruhm. Auf der einen Seite verachtet er sein zahlendes Publikum, auf der anderen Seite sonnt er sich vor seinen Groupies. Sein Erfolg hat ihn allerdings in erster Linie von seinen Mitstreitern und alten Freunden isoliert. Dafür spricht auch, dass er sich auf die Reise nach New York und die Suche nach Neal mit nur 17 Dollar macht, obwohl er in seinem Haus größere Summen von Scheinen als Isoliermaterial verwendet hat. Seine jetzige Realität ist nur noch ein Schatten der großartigen Zeit, sie ist durchschnittlich – ein Todesurteil für einen Aufrührer – und grau, die Gesellschaft hat seine Bewegung ignoriert und absorbiert – eine weitere Narbe in seinem Leben. Nur wenn er diese Realität ignoriert und sich auf eine mehr oder minder realistische Suche begibt, kann er die Grenzen überwinden, seine alten Freunde und vor allem seinen bisherigen Lebensmut zurückgewinnen. Mit seiner Reise geht eine fortschreitende Zertrümmerung der falschen Realität einher. Sein Freunde Neal Cassidy kann endlich in dieser fiktiven Kontra Realität sein Buch beenden. Das der Wind die einzelnen Seiten dann vor sich hertreibt und dieses literarische Werk für die Öffentlichkeit verloren scheint, unterstreicht Mamatas kritische, aber auch melancholische Haltung den sechziger Jahren gegenüber. Er bemüht sich, in seiner Fiktion so realistisch wie möglich zu bleiben.
Intelligent stellt er die künstliche Bedrohung durch imaginäre Monster den dunklen Seiten eines im Grunde simplen Lebens gegenüber. Der Autor kommt zu den allumfassenden Erkenntnis, ein Mensch kann sich nur selbst finden. Äußere Bedrohungen – wie in diesem Fall klassische Monster – können seinen Weg beeinflussen, aber sie sollten ihn in seinen Entschlüssen nicht stoppen können. Auf der anderen Seite wächst ein Mensch oft mit seinen Aufgaben, auch wenn es außer ihm niemand merkt.
Im Grunde ist „Move under Ground“ weder ein Horror noch ein Drogenroman. In vielen Punkten bleibt der Autor bewusst vage. Vielleicht stellt sich ihm die Frage, welchen Weg er selbst gehen soll. Aufgeschlossene Leser sollten sich nicht von der fremdartigen Kulisse abschrecken lassen, Nick Mamatas Buch ist eine weitere Auseinandersetzung mit einem faszinierenden, vielschichtigen Land aus einer Zeit heraus, die inzwischen abgeschlossene Geschichte geworden ist. Vielleicht ist das auch die Botschaft des Romans, die Rebellen haben sich angepasst und die Monster trotz der verlorenen Schlacht im Zuge des Corporate Amerika gewonnen. Wie bei Lovecraft, dessen Protagonisten auch oft die verlorenen Seelen darstellten.
Der Roman polarisiert. Leser, die mit Undergroundautoren, Drogen und Rock n´Roll nichts anfangen können, werden in diesem Buch keinen roten Faden finden. Für den Rest ist es ein interessantes Experiment, schwer zu goutieren, manchmal eher langweilig als spannend, mit zum Teil unsympathischen Anti-Helden, aber einem ungewöhnlichen Plot.
Nick Mamatas: "Move under Ground"
Roman, Softcover, 200 Seiten
Edition Phantasia 2005
http://www.sf-radio.net/buchecke/horror/isbn3-9378...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info