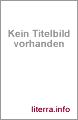|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Horror > The Wicker Man |
The Wicker Man
| THE WICKER MAN
Buch / Horror |
Auch wenn auf dem Titelbild von „The Wicker Man – Ritual des Bösen“ Nicolas Cage aus dem Remake gehetzt potentielle Käufer anschaut, handelt es sich beim vorliegenden Roman um eine Reinterpretation – wenigstens nach Regisseur Robin Hardys und Drehbuchautor Anthony Shaffers Meinung –ihres von den Produzenten verstümmelten Films, der 1973 an der Kinokasse enttäuschte und sich erst über seinen fast legendären Ruf – ohne das ihn wirklich jemand gesehen hat – zu einer Perle des Genres und schließlich zur verdienten Anerkennung hangelte.
Nicht nur aus diesem Grund ist im Zuge des überteuren und unglücklichen Remakes das Augenmerk wieder auf den originären Film und zum ersten Mal auf diese Nachbearbeitung gefallen. Außerdem ermöglichen die digitalen Medien einem interessierten Fan einen Vergleich zwischen dem Director´s Cut des Jahres 2001 und dem Roman, der vorgeblich die eigentliche Vision der beiden Entscheidungsträger beinhaltet. Wie so oft wird man feststellen, dass zwischen dem Anspruch, eine Meisterleistung noch verbessern zu wollen und der Realität deutliche Unterschiede bestehen. Die Produzenten des Films „The Wicker Man“ haben die Rechte zu David Pinners Roman „Ritual“ – 1967 erschienen und inzwischen in Vergessenheit geraten – gekauft und Shaffer beauftragt, diesen Stoff fürs Kino allerdings unter der Prämisse eines lowbudget Films zu adaptieren. „Ritual“ ist die Geschichte eines Polizeioffiziers, der in einer abgeschiedenen dörflichen Gemeinschaft nach einem verschwundenen Kind sucht. Je weiter er mit seinen Untersuchungen an der Oberfläche der friedlichen Gemeinschaft kratzt, desto offensichtlicher werden heidnische Rituale und Aberglaube. In einer auf den Film übertragenen Szene versucht man die männliche Jungfrau durch die Wand seines Hotelzimmers anzulocken und zu verführen. Die Grundstruktur dieses Romans ist erhalten geblieben. In erster Linie unterscheidet sich die spätere Filmfassung von diesem Roman in Bezug auf die Lokalität. Geschickt verlegt Shaffer die Handlung auf eine vom Golfstrom bevorzugte schottische Insel weit vor der unwirtlichen Küste des Landes. Durch diese Isolation kann auch das Entstehen des Kultes und vor allem die vollkommene, aber unsichtbare Kontrolle der ländlichen, vielleicht sogar einfältigen Bevölkerung perfektioniert worden. Die Autorität – in diesem Fall das Amt des Friedensrichters – wurde an den Inhaber der Insel Lord Summerisle delegiert – eine staatliche Kontrolle findet nicht mehr statt und ist auch nicht gewünscht. Alleine der Name des Lords, dessen Vorfahre die Insel vor vielen Jahren für kleines Geld erworben hat, wirkt wie eine bewusste Metapher auf die kommenden unabänderlichen Ereignisse. Neben dem schockierenden Finale, auf das später eingegangen werden soll, bleiben die wunderschönen Bilder der Insel aus dem Film im Gedächtnis. Diese markanten Punkte - im Gegensatz zum Film mit opulenten Bildern kann das Buch nur auf Worte zurückgreifen und wenige Sätze ersetzen keine schöne Szenerie - lassen sich am besten durch einen charismatischen Charaktere, in diesem Fall den Narren, der dazu ausgewählt worden ist, einen Tag lang König zu sein, ersetzen. Inzwischen denkt man automatisch an den bodenständigen jungen englischen Schauspieler Edward Woodward, wenn von Sergeant Howie die Rede ist. Im vorliegenden Roman bemüht sich Shaffer, seiner Schöpfung eine gewisse Vorgeschichte zu geben, um mit diesem literarischen Trick die Farblosigkeit seiner Figur zu überspielen. Eine männliche Jungfrau, zwar in Polizeiuniform, aber ohne überzeugende Autorität, ein pflichtschuldiger Beamter und gleichzeitig liebender Mann, der seine zukünftige Frau achtet und ihren erotischen Anbandelungen mit einer Mischung aus Faszination und Ekel ausweicht, ein Vogelliebhaber und ein aufrechter, ehrlicher Durchschnittsbürger. Keines dieser Attribute ist wirklich so fesselnd, dass man der Odyssee über eine scheinbar aus einer anderen Zeit stammenden Insel wirklich gefesselt folgen kann. Auch wenn es brutal klingt, Sergeant Howies größte Tat ist seine Opferung. Der Narr hat seinen König gefunden und ist an ihm zugrunde gegangen. Ähnlich wie im Film wirken die Dialoge hart und sehr konzentriert, Howie bemüht sich selten, wirklich Verständnis für seine Gegenüber zu entwickeln. In der Tradition des hardboiled Detektivs und gänzlich entgegen seiner Umgebung und seines Wesens sucht er das Böse, das Gemeine und Hinterhältige in seinen Gesprächspartnern, ohne wirklich einen Schritt weiter zu kommen. Er ist sich allerdings auch dieser Tatsache bewusst und als man sein Flugzeug beschädigt, verändert er seine Vorgehensweise im Grunde nicht. Eigentlich müsste er sich einer bedrohlichen Situation bewusst sein, nachdem man vorher versucht hat, ihn unter allen Umständen loszuwerden, agiert man jetzt hinter seinem Rücken, um ihm die Flucht von der Insel zu verwehren. Diese äußerliche Wendung der Ereignisse spiegelt sich leider zu wenig in Howies innerem Wesen wieder. Mit einer effektiven Auftaktszene versucht Shaffer noch zu unterstreichen, dass Howie ein Mann ist, der sich ungeachtet persönlicher Gefahr an dieser Aufgabe festbeißt und sie konsequent zu Ende führt. Diese Hartnäckigkeit wird zu seinem Verhängnis. Der Weg zum „Wicker Man“ dagegen ist nicht nur voller Steine, sondern einiger plottechnisch notwendiger, aber deswegen nicht unbedingt logischer Aktionen.
In starkem Kontrast zu seiner geordneten, ernsthaften Existenz steht das für ihn zügellose, sittenlose Leben der Insulaner, die – gleich zu Beginn paaren sich eine Reihe junger Männer und Frauen auf einer Wiese, die Frauen sitzen immer oben – anscheinend nach Feierabend jegliche Pflichten vergessen. Shaffer schränkt sehr geschickt die Perspektive gänzlich ein und der Leser erfährt nur die Fakten, die uns Howie wirklich mitteilen möchte, die er in seinem streng religiösen Weltbild akzeptieren oder ablehnen kann. Insbesondere im Mittelteil wirkt die Handlung wie ein kontinuierliches Abtasten zweier religiöser Gruppen – die Christen und die Atheisten – mit einem Hauch heidnischer Bräuche. In die Struktur des Romans eingewebt ist das unabänderliche Zusteuern auf den ersten Mai und den ihm zugeschriebenen phallischen Fruchtbarkeitsritualen. Es ist eine der überraschenden sowie unglaubwürdigen Komponenten des Buches – und des Films, dass Howie fanatisch davon ausgeht, dass die Insulaner nur einen aus ihren Reihen opfern wollen, während bei vielen heidnischen Religionen Außenstehende oder Fremde geopfert werden.
Wie im Film bemüht sich Shaffer, das inzwischen ja weltbekannte Geheimnis des „Wicker Man“ vor seinem Protagonisten und seinen Lesern zu verstecken. Ganz bewusst als Mystery Thriller konzipiert mit subtilen Tönen und einer fast zeitlupenartigen Ermittlungsarbeit lässt sich diese Art des Vorgehens sehr schlecht aufs Papier bannen und so wirkt die Handlung insbesondere in der ersten Hälfte des Buches unnatürlich gedehnt, fast langweilig. Ein gewisses Gegengewicht erhält diese Art der Exposition durch die minutiöse Darstellung heidnischer Riten – oft mit entsprechenden Erklärungen, die ein wenig den Zauber vom Geschehen nehmen, aber wie bei einem Schild insbesondere bei Sergeant Howie abprallen. So fehlt Lord Summerisle auch Christopher Lees charismatischer, unerschütterlicher Charaktere und die verbalen Duelle zwischen diesen beiden unterschiedlichen Männern – mit einer Vorliebe für die Natur, bei Howie als Begleiter, bei Summerisle als Lebensgrundlage – wirken geschrieben deutlicher erzwungener, fast statisch. Alle andere Charaktere werden eher im Vorbeigehen beschrieben, reagieren auf das Duell der beiden so unterschiedlichen Söhne des Landes mehr oder minder passiv, selten kommt – bis auf das nihilistische Ende – eine wirklich bedrohliche Atmosphäre auf. Im Film kann dieser Wechsel der Perspektive, der Stimmung deutlich besser erzwungen werden als in einem eher ruhigen, fast sekundärliterarisch angelegten Text mit einigen wenigen aufwühlenden, dann aber auch sehr gut zu lesenden Abschnitten.
Weiterhin ist es nicht einfach, den Sinn dieses Buches zu erkennen. Sowohl Hardy als auch Shaffer haben immer betont, den Torso des Originalfilms zu erweitern und einen Einblick in die eigene Vision geben zu wollen. Knappe vier Jahre nach der fast unmerklichen Kinopremiere in einem Zeitalter ohne Video und DVD war die einzige Möglichkeit, diesen Film auf Festivals wieder zusehen – auch nur spärlich – oder mit Hilfe des vorliegenden Romans die Erinnerung aufzufrischen. Dazu hält sich insbesondere Shaffer über weite Strecken des Buches sehr gut an das Drehbuch, nur beim Showdown kann er quasi in den Kopf seines zum Tode verurteilten Protagonisten eindringen und dem Zuschauer einige wenige neue, relevante Informationen über Howies Charakter offenbaren. Die Vorgeschichte wirkt dagegen deutlich zu plakativ und wirkt im Vergleich zu Howies ansonsten sehr zurückhaltendem Agieren zu aggressiv. Selbst in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts erweitert sich nach der Lektüre des Buches das Spektrum nur wenig und es bleibt der Eindruck, dass man viel Wind um sehr wenig gemacht hat. In unserem Medienzeitalter ist es inzwischen noch schwieriger, die erste deutsche Veröffentlichung dieses Buches wirklich objektiv und fair zu beurteilen. Inzwischen liegt der 1973er „The Wicker Man“ in verschiedenen Inkarnation – vom Beutel bis zur Holzbox als Verpackung vor und ein interessierter Zuschauer kann den Film immer wieder beim Anschauen analysieren. Der Sinn der Veröffentlichung des Romans im Angesicht des teuren Remakes erschließt sich nicht jedem, vielleicht versucht man einfach nur, den Zuschauer dank Nicolas Cage zur Lektüre/ Betrachtung des Originals zu animieren. Diese Aufgabe erfüllt der kurzweilig zu lesende, aber im Grunde in Bezug auf den Plot und die Charakterisierung im Gegensatz zum Film nicht zufrieden stellende Roman. Wer mehr Information über die heidnische Religion auf der schönen Insel erwartet, der wird enttäuscht, wer ein „Beyond the Wicker Man“ sich vorstellt, sollte woanders suchen. Der Ehrgeiz Shaffers und Hardys spiegelt sich im vorliegenden Buch leider nicht wieder, über weite Strecken wirkt es wie eine anschauliche Begleitmusik, aber keine revolutionäre oder gar Augenöffnende Neuinterpretation.
Robin Hardy & Anthony Shaffer: "The Wicker Man"
Roman, Softcover, 302 Seiten
Heyne 2006
ISBN 3-4535-0033-4
http://www.sf-radio.net/buchecke/horror/isbn3-4535...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info