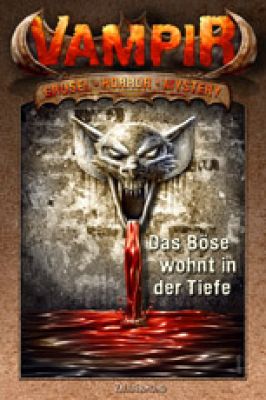|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Horror > Das Böse wohnt in der Tiefe |
Das Böse wohnt in der Tiefe
| DAS BÖSE WOHNT IN DER TIEFE
Ernst Vlcek Vampir-Horror: Band 11 |
Uwe Voehl leitet den behutsam bearbeiteten Nachdruck dreier plottechnisch voneinander unabhängigen Horror- Taschenbüchern sowie einer seit vielen Jahren nicht mehr nachgedruckten Kurzgeschichte aus der Feder Ernst Vlceks ausgesprochen emotional wie vielschichtig ein. Er analysiert die Romane und arbeitet vielleicht ein wenig zu positiv, zu ambitioniert die qualitative Sonderstellung innerhalb der Taschenbuchreihen heraus. Weiterhin zieht er Vergleiche zu Ernst Vlceks „Dorian Hunter“ Arbeiten, in denen er sich anfänglich am Rand der Indizierung durch die Bundesprüfstelle entlang hangelte. Die drei Romane werden zusätzlich durch die Idee der partiellen Amnesie – insbesondere im ersten Buch ein Mittel, um die Spannungskurve länger aufrechtzuerhalten – verbunden.
„Das Phantom aus dem Spiegel“ ist – wie schon Uwe Voehl schreibt – im Grunde thematisch dreigeteilter Roman, der den Leser aufgrund der intimen Ich- Erzählerperspektive insbesondere hinsichtlich des dunklen Endes auch ein wenig verwirrt zurücklässt. Es ist unwahrscheinlich, dass Paul – eine Anspielung auf Vlceks Pseudonym Paul Wolf – die Ereignisse derartig verschachtelt und falsche Spuren auch gegen sich selbst legend erzählen kann. Unabhängig von dieser strukturellen Schwäche präsentiert sich „Das Phantom aus dem Spiegel“ als ausgesprochen flotter und lesenswerter Roman, der aus der grundlegenden Idee einer Bedrohung aus dem Jenseits weniger spannungstechnisch als atmosphärisch einiges herausholt.
Der Innenarchitekt Paul renoviert seine Wohnung, während die Familie außerhalb der Stadt im Landhaus wohnt. Von einer befreundeten Antiquitätenhändlerin wird ihm ein alter Standspiegel angeboten, unter dem sich schon im Laden unerklärlicherweise eine kleine Blutlache findet. Paul kauft den Spiegel, der anscheinend bei einem Einbruch in eine Villa kurze Zeit vorher gestohlen worden ist. Kaum hat er den Spiegel aufgestellt, hört er fremde spanisch sprechende Stimmen in seiner Wohnung. Kurze Zeit später versucht die Freundin, den Spiegel wieder zurückzukaufen. Paul sollte sowieso nur eine Kopie und nicht das Original erhalten. Bei seinen Recherchen erfährt Paul, dass in dem Spiegel ein grausamer Sadist gefangen gehalten sein soll, der von der ländlichen Bevölkerung in einer an den Showdown aus „Frankenstein“ erinnernden Szene aus seinem Schloss vertrieben worden ist. Dort hat er mit jungen willigen Menschen experimentiert, um sich eine Art Unsterblichkeit zu sichern. Inzwischen scheint der Dämon aus dem Spiegel auch auf Paul zuzugreifen, der immer weniger zwischen Realität und Wahnvorstellungen unterscheiden kann.
Wie schon von Uwe Voehl im Vorwort herausgearbeitet hat, ist die Einführung in den stringenten Plot stimmungstechnisch überzeugend. Wer sich mit Ernst Vlceks Leben ein wenig auskennt, wird einige Parallelen erkennen. Im Mittelteil greift der Autor zu drastischen Mittels und beschreibt die Folter, der sich Paul aussetzen muss, sehr detailliert. Die Szene wirkt auch in anderer Hinsicht ausgesprochen spannend. Wie Paul fragt sich der Leser, ob er in die Hand eines Irren gefallen ist, der mit sadistischen Vergnügen seine Opfer dank mittelalterlicher Foltergerät quält oder ob sich wirklich ein Dämon aus dem Spiegel in Pauls Wesen eingenistet hat. Diese ambivalente Position muss Ernst Vlcek im letzten eher bodenständigen Drittel aufgeben, das zwar den eigentlichen Handlungsbogen inklusiv des aus heutiger Sicht antiquierten Epilogs zufriedenstellend abschließt, aber auch bemüht ist, die Besessenheit des Protagonisten nachvollziehbarer darzustellen. In diesem Punkt verliert sich die bis dahin stimmig aufgebaute Atmosphäre in einer weiteren Eruption von Gewalt, die Vlcek routiniert, aber zu wenig inspiriert, zu wenig überraschend beschreibt.
Bei der Charakterisierung der handelnden Personen gelingt es dem Autoren, eine Sympathieebene zum Protagonisten aufzubauen. Vor allem verzichtet Ernst Vlcek in der Exposition auf Klischees und der Leser kann gut nachvollziehen, wie Paul im Grunde unschuldig in die Angelegenheit hineinschlittert und versucht, Licht in die dunklen Vorgänge zu bringen. Das ihm statt eines Originals eine sicherlich nicht billige Kopie untergejubelt worden soll, verstimmt ihn anfänglich. Die rätselhaften Stimmen in seiner Wohnung kann er zwar dem Spiegel zuordnen, es erweckt aber nur mäßiges Misstrauen. Es gibt in der ersten Hälfte bis zur Einladung durch den zumindest theoretisch noch rechtmäßigen Besitzer des Spiegels keinen handlungstechnischen Augenblick, in dem Paul – im Gegensatz zum Leser – die gänzlichen Zusammenhänge ahnen könnte oder ab diesem Moment an Dämonen glauben müsste. Diesen geschickten Aufbau kann Ernst Vlcek nicht bis zum Ende durchhalten, aber zusammengefasst ist „Das Phantom aus dem Spiegel“ ein flott zu lesender Roman, der seinem Titel alle Ehre macht.
Der Titel gebende Roman „Das Böse wohnt in der Tiefe“ greift auf die Grundidee aus „Rosemarys Baby“ in doppelter Form zurück. Bis dahin ist die Geschichte um einen außergewöhnlichen Griechenlandurlaub zweier befreundeter Ehepaare inklusiv der überstürzten Rückreise des einen Paares inklusiv der plötzlich auftretenden Veränderung des Ehemanns gut zu lesen. Ernst Vlcek spricht verschiedene zeitnahe Themen an. Zum einen die Last – in diesem Fall beim Ehemann – einer kinderlosen Ehe gegen die eigene Karriere – ungewöhnlich für die Zeit für die Ehefrau geltend - , zum anderen greift der Autor bei seinen Nebenfiguren auf ausländische Emigranten zurück und verlagert das exotische Flair teilweise in heimische Gefilde. Der Beginn beginnt ausgesprochen ruhig. Die Veränderung ihres Mannes beunruhigen zwar die Protagonistin und Erzählerin, aber sie sieht diese Wesensänderungen eher in ihrer nicht stabilen Psyche begründet und sucht einen Psychologen auf. Der Leser kann zu diesem Zeitpunkt die einzelnen Figuren noch nicht einschätzen. Diese Idee hat Vlcek noch effektiver in „Das Phantom aus dem Spiegel“ eingesetzt, wo der Ich- Erzähler von einem psychopatischen Sadisten gefoltert wird, ohne zu wissen, ob der mit seiner auf den ersten Blick absurd erscheinenden Idee eines eingenisteten Dämonen nicht doch recht hat. Diese paranoide Grundhaltung strebt der Autor ab, erreicht sie aber leider nicht. So kann sich die Ehefrau auch nicht richtig an die letzten Stunden ihres Griechenlandurlaubs erinnern. Es muss etwas vorgefallen sein, dass ihr Unterbewusstsein beschäftigt. Später erfahren die Leser und die Protagonistin von dem befreundeten Ehepaar weitere Fakten, es stellt sich aber von Beginn an die Frage, warum sie sich nicht gleich an die Freunde gewandt hat. Sie hat ja nicht den ganzen Urlaub vergessen.
Um die Spannungskurve nicht abflachen zu lassen, führt Vlcek intelligent einen falschen Psychiater in die Handlung ein, dessen schurkische Absichten zumindest für den Leser nach wenigen Zeilen und an Hand eines namens wie Skarabäus klar zu erkennen sind. Im Gegensatz zur nüchtern gezeichneten Protagonisten überspannt der Autor den Bogen bei seinen Antagonisten ein wenig zu sehr und der Roman droht zumindest nach dem ersten Drittel des Buches zu einer Farce zu werden. Langweilige Dialoge stehen der packenden Erkundung des gemeinsamen Kellers gegenüber, in deren Verlauf der Autor immer wieder mit den Erwartungen des Lesers spielt. Die zweite Hälfte des Plots inklusiv des von Uwe Voehl im Vorwort angesprochenen schwierig an der Bundesprüfstelle vorbeischmuggelnden Themas Kannibalismus – die Ausnahme scheinen Überlebende von Flugzeugabstürzen zu sein, die Vlcek in der abschließenden Kurzgeschichten „Nekromantic“ abgehandelt hat – reduziert sich mehr und mehr auf klassische Horrorthemen, die zwar solide geschrieben worden sind, aber die atmosphärisch intensive erste Hälfte des Buches qualitativ nicht erreichen können. Vlcek wiederholt nicht die Schwäche des „Phantoms aus dem Spiegel“, den Ich- Erzähler Fakten berichten zu lassen, die er weder verifizieren noch zu diesem Zeitpunkt der Handlung wissen kann. Der Plot ist deutlich einfacher strukturiert, die finalen Konfrontationen mit dem entsprechenden Dämon – in diesem Fall aus Griechenland importiert – geradliniger, sicherlich auch brutaler, aber weniger spannend. Vielleicht hätte sich Vlcek noch mehr auf den Kinderwunsch des Mannes konzentrieren sollen, der im Mittelteil fast pädophile Intensität erreicht, bevor der Wiener diese Idee wieder in den Hintergrund rückt und statt dessen den kannibalisch veranlagten Dämonen nach vorne zieht, der weniger interessant oder nuanciert beschrieben erscheint als die ersten Protagonisten. Spätestens aber ab dem Augenblick, in dem „Das Böse aus der Tiefe“ sich zu sehr an Ira Levins Vorlage zu Roman Polanskis Klassiker“ orientiert, lässt das Interesse des Lesers an diesem phasenweise wirklich interessanten, aber auch anachronistisch wirkenden Roman stark nach. Einige gute Szenen reichen nicht aus, um ein ganzes Taschenbuch zu schultern. Auf der anderen Seite stimmt insbesondere in der zweiten Hälfte des Plots die fast Tabubrechende Mischung aus Gewalt – in diesem Fall die kannibalische Gier der befallenen Menschen - und exotischer Atmosphäre, wobei insbesondere die südeuropäischen Nebenfiguren mit sehr viel Liebe zum Detail beschrieben worden sind. „Das Böse wohnt in der Tiefe“ ist spürbar schwächer als „Das Phantom aus dem Spiegel“, zumal die grundlegende Idee routiniert auf Romanlänge gebracht worden ist, aber bis auf die angesprochenen Exzesse zu sehr an bekannteren Vorbildern klebt.
Der abschließende Roman „Die Disco Hexe“ lebt nicht nur von ihrem plakativen Titel. Der Reporter Toni kehrt von seinem Arbeitsplatz wie jeden Abend heim. Dabei flirtet er kurz mit einer jungen Dame in Hippiekleidern, die aus einem Bauchladen selbst gemachten Schmuck verkauft. Anscheinend fehlt ihm aber die Erinnerung an einen ganzen Tag, wie er feststellen muss, als er seiner erzürnten Ehefrau zu Hause begegnet. Noch schlimmer, sein ganzer Rücken weißt Male von Peitschenhieben und Wundmalen auf, an seiner Brustwarze erkennt er eine Tätowierung, die eine geringelte Schlange zeigt. Ernst Vlcek gelingt es ausgezeichnet, das Gefühl von Angst wie Verunsicherung zu beschreiben, dem der bislang eher selbstbewusste bis leicht arrogante Toni ausgesetzt wird. Toni besucht das junge Mädchen, das er angeblich in den ihm fehlenden 24 Stunden nach Hause gebracht hat. Hier entlädt sich die ihn im aufgestaute, widernatürliche Wut in sinnloser Gewalt. Anscheinend weiß die junge Regina sehr viel mehr, als sie zugeben möchte. Das sie auch noch in einem engen Zusammenhang mit einem Artikel steht, für den Toni recherchiert, ahnt er nicht. Wie Uwe Voehl in seinem Vorwort herausstellt, ist „Die Disco Hexe“ unabhängig von dem irreleitenden Titel- es gibt wirklich eine Hexe, die tatsächlich in sexuell freizügigen Lederklamotten Peitsche schwingend in einer Disco tanzt – im Grunde kein reinrassiger Horrorroman – obwohl der Plot insbesondere in der zweiten Hälfte diesen Vorgaben sehr gut folgt - , sondern eine vielschichtige Story. Toni als Macher wird zu einem passiven Opfer degradiert, das sich erst auf den letzten plottechnischen Metern in einer finalen feurigen Lösung befreien kann. Die Idee, auch noch eine Prise Science Fiction in die Handlung zu integrieren, wirkt leider ein wenig übertrieben. Dazwischen finden sich einige fast surrealistische Szenen, die an die Flowerpowerkultur der sechziger Jahre mit einem Schuss LDS Trip erinnern. Insbesondere der Juxer als Figur ist Ernst Vlcek sehr gut gelungen und ragt an dem Kontext heraus. Auf der anderen Seite wirkt die Zwillingsgeschichte mit der Ermordung der Eltern, der Idee des Guten wie Bösen auf die Kinder verteilt zu antiquiert und der Leser kann den fehlenden Zwilling relativ früh im Vergleich zu Toni erkennen. Vorsichtig provokant balanciert Ernst Vlcek sicherlich mit sehr viel Vergnügen an der Grenze des Zumutbaren für einen Horrorroman entlang. Stimmungstechnisch sicherlich sein dunkelstes Buch füllt er sich dem Journalisten Toni mehr verbunden als zum Beispiel dem Innenarchitekten Paul, der seinen pseudonymtechnischen Vornamen trägt. Obwohl Amnesie in allen drei Texten eine wichtige Rolle spielt, verbindet die Texte noch ein anderes Element. In allen drei Büchern fallen Männer direkt – Tauchen in Griechenland, Kauf eines Spiegels, außereheliches Flirten – oder indirekt durch leblose Gegenstände bzw. Frauen einem Dämonen zum Opfer. In diese Aneinanderreihung von tragischen Antihelden wird sich anschließend noch der Protagonist aus „Nekromania“ einreihen, dessen Schicksal wahrscheinlich am meisten den Leser anspricht und von Grund auf tragisch ist. Stilistisch deutlich experimenteller, manchmal mit ein wenig zu steifen Dialogen ist „Die Disco Hexe“ eine unterhaltsame, farbenprächtige Horrorgeschichte, in der Ernst Vlcek zum Wohle des Buches insbesondere in der ersten Hälfte sehr ruhig, sehr pointiert die Handlung aufbaut und letzt endlich seine Dämonen im dunklen Herz der Disco ihre Opfer wie reife Pflaumen von den imaginären bäumen pflücken lässt.
Die abschließende Kurzgeschichte „Nekromania“ ist bislang nur in der Anthologie „Liebesgrüße aus dem Jenseits“ veröffentlicht worden. Erzählt aus der Ich- Perspektive eines Beteiligten – so kann der Leser sich auf Augenhöhe der Charaktere bewegen und doch nicht ahnen, was aus den im Mittelpunkt stehenden Figuren wird – wird der Absturz eines Freundes über Alaska mit einem Linienflugzeug, dessen Rettung und schließlich die Erkenntnis beschrieben, das sich die wenigen Überlebenden vom Fleisch der Toten ernährt haben. Von der Öffentlichkeit mit Abscheu behandelt zieht sich der Überlebende Alex zusammen mit seiner Frau aus der Öffentlichkeit zurück. Wie der Ich- Erzähler in einer ausgesprochen makaberen Szene feststellt, gibt es dafür auch noch andere Gründe. Geradlinig erzählt verzichtet Ernst Vlcek auf den bei den Taschenbücher so signifikanten Stimmungsbau und bemüht sich, den Plot möglichst realistisch zu entwickeln, bevor er auf den letzten Seiten in den Bereich des Makaberen mit einem Hauch Phantastik, George Romeros Filme vorwegnehmend abschwenkt. Im Vergleich zu den längeren Texten leidet die Geschichte unter mangelnder Charakterentwicklung, die distanziert beschriebenen Figuren bleiben dem Leser fremd. Auf der anderen Seite entschädigt die leider etwas vorhersehbare Pointe – bis auf den abschließenden Hacken – für diese Schwäche. „Nekromania“ unterstreicht, dass Ernst Vlcek ein solider Kurzgeschichtenautor, aber eher ein inspirierter Romanschriftsteller gewesen ist.
Im Gegensatz zu den bisher im Rahmen der „Vampir“ Reihe präsentierten Anthologien oder den Sammelbänden mit den „Henker“ Romanen Uwe Voehls verfügt der vorliegende Band zum ersten Mal über drei „Dämonenkiller“ oder „Vampir“ Taschenbücher und öffnet damit eine weitere Tür, die nicht immer in Ehren ergrauten, aber wie Vlcek Arbeiten unbedingt lesenswerten Texte einer gänzlich neuen Lesergeneration zu präsentieren. Wer gerne einmal in das ebenfalls umfangreiche Horrorwerk Vlceks hineinschnuppern möchte, ist mit der vorliegenden Sammlung serienunabhängiger Arbeiten nicht nur qualitativ zufrieden stellend, sondern dämonisch gut bedient. Beim nächsten Discobesuch nicht zu sehr in die überdimensionalen Spiegel gucken, vor denen kleine Holzstatuen stehen.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info