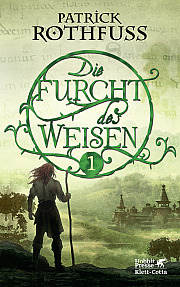|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Fantasy > Die Furcht des Weisen Teil 1 + 2 |
Die Furcht des Weisen Teil 1 + 2
| DIE FURCHT DES WEISEN TEIL 1 + 2
Patrick Rothfuss Klett Cotta |
Mit „The Wise Man´s Fear“ legt Patrick Rothfuss vier Jahre nach seinem Debütwerk “The Name of the Wind” den zweiten Band der Königsmörder Chroniken um Kvothe vor. Klett Cotta hat den Roman unter dem deutschen Titel „Die Furcht des Weisen“ in zwei mit schönen Titelbildern ausgestatten Hardcovern im Abstand von wenigen Monaten veröffentlicht.
Mit im Original fast eintausend Seiten Umfang ein ähnlich gewichtiges Epos wie der erste Teil, dass aufgrund der sich extrem langsam, manchmal ein wenig phlegmatisch, aber nicht interessant entwickelnden Handlung offenbart, Patrick Rothfuss wird sich den Chroniken des Königsmörders nicht mehr einer Trilogie begnügen. Zu viele Einzelheiten präsentiert der zweite Band, zu wenig schreitet aber als Ganzes Kvothes Lebenserzählung fort. Wie im ersten Roman greift Patrick Rothfuss auf eine Rahmenhandlung zurück, in der Kvothe dem Chronisten und seinem Freund Bast, über den der Leser auf mehr als zweitausend Seiten Text so gut wie nichts erfahren hat, seine Lebensgeschichte erzählt. Alle relevanten Fragen des Rahmens, wie zu Beispiel „Warum versteckt sich Kvothe als Kneipenbesitzer im Grunde mitten in der Öffentlichkeit?“, werden weiterhin nicht beantwortet. Ob Rothfuss angestrebt hat, einen Kontrast zwischen Kvothe jetziger, sicherlich gewollter Existenz, seinem bisherigen Leben und den nicht selten etwas heroisierten Berichten herauszuarbeiten, werden hoffentlich die nächsten Roman beantworten. Im Vergleich zu den Lebensberichten wirkt die Rahmenhandlung ein wenig zu gestelzt, fast langweilig. Kvothe erinnert seine Zuhörer und damit auch die Leser mehrmals daran, dass er das Ruder in der Hand hält und alleine bestimmt, was relevant und was unwichtig ist. Während Rothfuss im ersten Band „The Name of the Wind“ den Rahmen auf einer interessanten, neugierig stimmenden Note beendet und damit zum erst vier Jahre später veröffentlichten zweiten Epos übergeleitet hat, bleibt am Ende des vorliegenden Buches das unbestimmte Gefühl, als wollte Rothfuss die Arbeit an der Fortsetzung nur möglichst schnell abschließen. Ein etwas besser ausgearbeiteter Cliffhangar wäre gut gewesen.
Was sich in „The Name of the Wind“ allerdings eher angedeutet hat, wird in vorliegender Fortsetzung besser herausgearbeitet. Das Reifen eines Helden, dessen ambivalenter Ruf ihn schon zu Lebzeiten eingeholt hat. Patrick Rothfuss bewegt sich dabei auf einem schmalen Grad. Wie viele Niederlagen könnte sein wichtigster Protagonist im Rahmen des Reifeprozesses einstecken und ab welchem Augenblick wird er als nuancierter Überheld gegenüber dem Leser unglaubwürdig? Im Gegensatz zu dem etwas selbst verliebten und immer wieder auf bekannte Schemata des Genres zurückgreifenden Erzähltypus des Auftaktbandes zieht Patrick Rothfuss auch zu Gunsten der wichtigsten Protagonisten das Erzähltempo im Verlauf des Plots positiv deutlich an. Die erste Hälfte des Romans wird weiterhin von Kvothes im Grunde schon zum Scheitern verurteilten Studien, seinen monetären Problemen trotz seines ekstatischen Flötenspiels, den ersten Liebesaffären und einen an die Faust Legende erinnernde Verkauf bzw. Verpfändung des eigenen Blutes bestimmt. So lebensecht und unterhaltsam Rothfuss diese Szenen auch beschreibt, sie bieten keine neuen Aspekte und wiederholen auf einem etwas gehoberen Niveau Ideen des ersten Bandes. Erst als Kvothe nahe gelegt wird, doch eine Art Sabbatjahr einzulegen und die Universität zu verlassen, nimmt der Plot Fahrt auf, die Szenerie wird breiter und Kvothe kann aktiver in das Geschehen eingreifen. Dabei muss er seinen neuen Mentor vor einer langsamen Vergiftung schützen, eine Gruppe von Banditen mit einigen Getreuen jagen, Liebesgedichte für eine von Dritter Seite umworbene holde Maid verfassen, sein Training bei den Adem abschließen und in einer der eher verstörenden Episoden des Buches zwei junge Mädchen aus den Händen einer Gruppe von sie folternden und vergewaltigenden Schurken auf dem Weg nach Levinshir retten. Jede dieser kleinen Aufgaben erhöht nicht nur seinen noch ausgesprochen brüchigen „Ruhm“, sie bilden ein kleines Mosaiksteinchen für den von Rothfuss ausgesprochen gut und packend beschriebenen Höhepunkt des Romans, in dem sich Kvothe zum ersten Mal als fast klassischer Held beweisen muss.
Von der erzähltechnischen Struktur folgt die Fortsetzung dem ersten Band. Weiterhin aus der Ich- Perspektive (in doppelter Hinsicht mit Rahmen und Memoiren) erzählt rückt der Leser zumindest in der Theorie ganz nah an Kvothe heran. Schon im ersten Buch wirkte Kvothe teilweise unnötig ausgesprochen arrogant und hat dem Fantasy Klischee folgend Dinge positiv erledigt, die ihm weder alterstechnisch – er ist knapp sechzehn Jahre alt – noch aufgrund seines bisherigen Wissensstandes zugetraut werden können. In der ersten Hälfte des Plots umschifft Rothfuss diese Klippe sehr elegant und für den Leser jederzeit auf Augenhöhe nachvollziehbar, während die Balance mit Kvothes Verlassen der Universität deutlich zu Lasten der Glaubwürdigkeit kippt. Dagegen stehen positiv sein unbändiger Wissensdrang, seine Eitelkeit und sein dunkles, aufbrausendes Temperament, die manche seiner Handlungen zumindest nachvollziehbar machen. Rothfuss beschreibt seinen Protagonisten ausgesprochen dreidimensional. Er ist ein guter Beobachter, verfügt über einen dunklen, aber nicht schwarzen Humor und gesteht sich im stillen Kämmerlein auch Fehler ein. Zu den emotionalen Höhepunkten des Romans gehört das Becircen Dennas sowie später ausgesprochen bodenständig das Erlernen des Fischfangs, Fährtenlesen oder seine Liebe zur Musik, die ihm seine früh verstorbenen /ermordeten Eltern quasi in die Wiege gelegt haben. Die Nebenfiguren sind deutlich eindimensionaler, manchmal ambivalent, aber nicht immer wirklich überzeugend beschrieben worden. Denna als kokette Dame mit beiden Füßen auf dem Boden entwickelt sich von einer intelligenten, verschlagenen Konkurrentin, die genau weiß, wie sie Geld verdienen kann im Mittelteil zu Kvothes erster Liebe inklusiv der tragischen Verwicklungen, bevor sie gegen Ende des Romans wieder an Eigenständigkeit und damit einhergehend Überzeugungskraft gewinnt. Nicht selten überdeckt Patrick Rothfuss wie bei Master Elodin, Maer Alveron oder Bredon Tempi eine fehlende nachhaltige Entwicklung der Figuren mit insbesondere im englischen Original sehr unterhaltend geschriebenen, erstaunlich flüssigen Dialogen, die aber fairer weise nicht selten ins Nichts führen. Insbesondere nach dem ersten Drittel des Romans befürchtet der Leser, dass sich Kvothes Leben zu einer reinen Fantasy- Form von Harry Potters Ausbildung im Proletarierumfeld mit Endlosschleife entwickelt. Anstatt die Handlung über die Dialoge auch voranzutreiben und vor allem dem Leser notwendige Informationen mittels Hintergrundbeschreibungen zu vermitteln, verliebt sich Rothfuss in das gesprochene, aussagelose Wort und fordert noch mehr als im ersten Band die Geduld des Lesers heraus. Deutlich auffallender ist das Fehlen jeglicher Herausforderungen nachhaltig darstellender Antagonisten. Die üblichen Schulhofrabauken, die Kvothe das Leben schwer machen, zählen nicht und die von ihm später gejagten Banditen sind eher Mittel zum Zweck, den Handlungsbogen zu beschleunigen und Spannung aufzubauen. Dank dieser nicht unbedingt dreidimensionalen Vorgehensweise kann Patrick Rothfuss Kvothes wachsende Fähigkeiten sowie sein inzwischen manchmal unerträgliches Ego noch im Zaun halten, dem Buch fehlt aber ein ausgleichendes dramatisches Element, was sich insbesondere in der zweiten Hälfte störend bemerkbar macht.
Wie sehr sich der Auto trotz inzwischen mehr als bislang zweitausend Textseiten auf das Geschehen und nicht seine Welt konzentriert, zeigt insbesondere der vorliegende Roman. Obwohl Kvothe die Enge der Universität verlässt/ verlassen muss, bleiben die Völker, denen er begegnet relativ rudimentär und ausbaufähig beschrieben. Der Autor orientiert sich überwiegend an irdischen Vorbildern unterschiedlicher Epochen. Die Adem verfügen nicht nur über eine einzigartige und innovative Kommunikationsmethode mit interessanten sowie solide präsentierten Handsignalen, sie bringen auch Kvothe eine Art Kug Fu/ Schwertkampf Technik bei, mit der er sich später – wie im Rahmen angedeutet – gegen zahlreiche Gegner durchsetzen kann. Das Königreich Vintas mit seinen zahllosen Aberglauben, ihren Vorurteilen und Ränkespielen erinnert an eine Variante Venedigs zur Dogenzeit. Es ist schade, dass insbesondere diese farbenprächtige Epoche, aus der Kvothe mit seiner bodenständig improvisierenden Art wie ein bunter Hund herausragt, nicht so weit entwickelt worden ist wie zum Beispiel in Jacqueline Careys „Kushiell“ Romanen. Im ersten Buch störte das magische System, von dem Kvothe teilweise profitierte, noch etwas die ansonsten eher abenteuerlich phantastische Ordnung und ragte zu sehr heraus. Im vorliegenden zweiten Buch ordnet sich die Magie strikter dem Gesamtbild unter und wird eher als Mittel zum Zweck denn als Deus Ex Machina Lösung angewandt. Das lässt „Die Furcht des Weisen“ weniger konstruiert erscheinen.
Hinzu kommt die sexuelle Komponente, die deutlich stärker insbesondere beim heranwachsenden Kvothe ausgebildet ist, auf die sich Patrick Rothfuss allerdings nicht zu Lasten der Gesamtkomposition konzentriert. Er integriert die Liebesszenen in den Handlungsfluss und kann gut zwischen körperlichen Begehren und zumindest aus Kvothes noch unerfahrener Sicht „wahrer Liebe“ unterscheiden. Hier vermisst der Leser allerdings aus dem Rahmen heraus eine Selbsteinschätzung des Erzählers und eine gewisse Distanz zu Ereignissen, die zumindest mehr als einen Tag in der Vergangenheit liegen.
„Die Furcht des Weisen“ ist eine interessante, wenn auch etwas zu lang geratene Fortsetzung des Auftaktbuches, das dem Leser Kvothe als Protagonist nicht unbedingt näher bringt. Am Ende des Romans ahnt man, dass wahrscheinlich mehr als ein Buch noch folgen könnte, das die Verstrickungen deutlich komplexer werden könnten. Stilistisch deutlich ansprechender, ambitionierter und handlungstechnisch besser durchkomponiert, aber viel weniger überraschend oder herausfordernd unterhält der Plot solide bis stellenweise inspiriert, auch wenn anfänglich ausgesprochen viel Geduld vom Leser als Zuhörer gefordert wird.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
April 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info