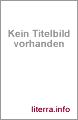|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science-Fiction > Das Cusanus Spiel |
Das Cusanus Spiel
| DAS CUSANUS SPIEL
Buch / Science-Fiction |
Auch wenn Wolfgang Jeschke in seinem kurzen Nachwort dem kürzlich verstorbenen Carl Amery und seinem Roman „Das Königsprojekt“ in Bezug auf christliche Zeitreise eine entsprechende Hommage erweist, erinnert sein neuer umfangreicher Text eher an Connie Willis herausragenden und mehrfach preisgekrönten „The Doomsday Book“. Die Anspielungen auf Jack Finneys Zeitreisewerk „Das andere Ufer der Zeit“ geht ins Leere, da Finney eine positive, eine lebensbejahende und im Kern romantische Geschichte erzählt, Jeschke sich über weite Strecken nicht entscheiden kann, ob er eine dramatische Zeitreisegeschichte oder einen Entwicklungsroman in Bezug auf seine weibliche Protagonistin Domenica Ligrina darstellen könnte.
Jeschkes Europa ist eine seltsame Mischung aus Reinmar Cunis kritischen Texten und wildem Cyberpunk mit einem Hauch Low Budget Hollywood als Hintergrundmusik. Der Handlungsbogen beginnt symptomatisch in der ewigen Stadt Rom des Jahres 2052. Der Unfall eines Atommülltransportes im Ballungsgebiet Rhein Main ist der erste Katalysator einer folgenreichen Kette. Am Ende steht die Auflösung der EU und der Zerfall des künstlichen Gebildes in Einzelstaaten, Fluchtwellen von Europäern aus den verstrahlten Gebieten in die Anreinerstaaten und die folgerichtige Konsequenz von Grenzschließungen. Die globale Erwärmung hat das Klima in weiten Teilen Europas und den südlichen Mittelmeerstaaten verändert. Von Süden rücken die mittellosen Menschen in den Norden vor, wo sie in auf faschistische Kleinstaaten treffen. Weder eine polizeiliche Ordnung noch staatliche Kontrolle ist in dieser düsteren Zukunft zu erkennen.
Mitten in diesem Chaos beendet die selbstbewusste, attraktive Ich- Erzählerin Domenica Ligrina ihr Botanikstudium. Sie erhält das Jobangebot einer geheimnisvollen, verschlossenen katholischen Organisation. Warum es überhaupt Botanikstudien in einem zerstörten und verseuchten Europa in der heute bekannten Form noch gibt, lässt Jeschke offen. Aber er benötigt diesen Studienzweig, um einen logischen Bogen zu seiner futuristischen Handlung schlagen zu können. Ihre Mission führt sie in das Europa des fünfzehnten Jahrhunderts unter dem Kardinal Nicolaus Cusanus, der den Naturwissenschaften offen gegenüberstand. Sie soll dort Flora und Fauna einsammeln, um der verstrahlten Zukunft eine neue ökologische Artenvielfalt zu präsentieren. Eher indirekt stellt Jeschke heraus, dass es sich bei dieser Mission nur um einen kleinen Baustein eines großen Projektes handelt. So tauchen in der Gegenwart Baupläne sakraler Gebäude auf, die über Jahrhunderte als verschollen galten und längst stellt sich die Kirche die Frage, wie man die Vergangenheit für eine bessere, aber geplante Zukunft manipulieren kann.
In Wolfgang Jeschkes Roman unterliegt nicht nur die Natur einem kontinuierlichen Evolutionsprozess. Als Ergebnis dieser Zeitreisen entstehen immer mehr Paralleluniversen, von denen nur wenige wirklich lebensfähig sind. Diese Geburt zeigt Jeschke sehr geschickt an einer sich stetig wiederholenden und sich doch verändernden Szene: Cusanus – der sich auch für ein Geschicklichkeitsspiel verantwortlicht zeichnet, dessen Kern die Aufforderung zum freien Denken und Assoziieren enthält – reist in seine deutsche Heimat. Während der Fahrt erhält er Informationen über eine gelehrte Frau, die der Hexerei für schuldig befunden wird und die versucht, mit verschlüsselten Informationen die Neugierde des Kardinals zu wecken. Jede dieser Szenen endet anders und der Leser darf auf keinen Fall der Versuchung unterliegen, die „bekannten“ Szenarien nur zu überfliegen. Jeschke macht deutlich, dass diese Frau natürlich die Zeitreisende Domenica ist, deren Mission kurz vor ihrem Ende gescheitert ist. Das es ihm weniger um eine stringente Handlung , aber eine kritische Auseinandersetzung mit brisanten Themen der Gegenwart geht, unterstreicht die Tatsache, dass die eigentliche Zeitreise weniger als zwanzig Prozent des Romans einnimmt, ihre Folgen aber von Beginn ablesbar sind.
Die Idee, durch die Manipulation der Vergangenheit die Gegenwart zu verändern, ist auch für Jeschkes Werk nicht neu. In seinem inzwischen als Neuauflage wieder zugänglichen Roman „Der letzte Tag der Schöpfung“ lässt er die Amerikaner in die tiefste Vergangenheit reisen und dort das Öl von der arabischen Halbinsel in neutralere Gewässer abpumpen. Schon in diesem Buch erkannte er scharfsinnig die Absurdität dieses Versuchs und karikierte den amerikanischen Egoismus auf treffende Weise. „Das Cusanus – Spiel“ als grüne Alternative und Weiterentwicklung zu bezeichnen, trifft auch nicht den Kern dieses Buches. Der Roman zerfällt erst einmal in zwei wichtige Teile: die Charakterisierung Domenicas und die Manipulation der Vergangenheit.
Um diese für den Leser nachvollziehbar zu gestalten, muss die prognostizierte Zukunft möglichst düster gemalt werden. Hier greift Jeschke auf eine Reihe von inzwischen fast klassisch zu nennenden Klischees zurück: Genmutanten, rassistische Ausrottung aller Andersartigen, eine in sich zusammengebrochene Industrienation, das riesige Ozonloch, fehlende erneuerbare Energien und schließlich auch eine zum Aussterben verurteilte Natur. Diese Vision hat Jeschke sehr „naturgetreu“ und detailliert mit Beschreibungen des Lokalkolorits Roms und Venedig untermalt. Die Recherche, die auch in die in der Vergangenheit spielenden Abschnitte geflossen ist, weckt seinen Roman im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben. Dazu kommen vordergründig naturwissenschaftliche und technologische Erkenntnisse der letzten Jahre, die in einem scharfen Kontrast zur äußerlichen Gläubigkeit der Kirche stehen. Jeschke bemüht sich, nicht zu viele verwirrende Fakten in die Handlung zu integrieren, sondern lieber zugunsten einer Beschreibung auf eine technische Erklärung zu verzichten. So dringt er nicht in sonderlich tief in die kirchliche Organisation ein, sondern belässt es bei Anspielungen.
Die Abschnitte der Vergangenheit wirken entsprechend düster, ungebildet und brutal. Natürlich muss Domenica dort die dunklen Seiten der Vergangenheit erleben und abschnittweise erreicht Jeschke eine erdrückende Authentizität, wie sie bislang nur von Connie Willis Pestgeschichte „The Doomsday Book“ und ihrer im zweiten Weltkrieg spielenden Geschichte „Brandwache“ bekannt gewesen ist.
Was Wolfgang Jeschke fehlt, ist der Mut, seinen Text rechtzeitig zu beenden. Domenica erhält keine zweite Chance. Trotzdem darf sie wieder in die Vergangenheit reisen. Dieses Mal soll sie ihren Vater retten, der zusammen mit fünfhundert anderen Menschen bei einem Bombenanschlag auf einen Zug ums Leben gekommen ist. Diese Reise ist ein Widerspruch zur bislang bekannten Haltung, für die Allgemeinheit und das Wohl der Menschheit da zu sein. Ketzerisch könnte man bei diesen Passagen fast von einem Heilandkomplex sprechen. Wie viele Christen sich gerne für den Heiland geopfert hätten, möchte Domenica die Zukunft für die Rettung ihres Vaters eintauschen. Auch wenn Jeschke – eher für ein Alterswerk typisch – zu einer Reihe von lesenswerten, fast persönlichen Erkenntnissen kommt, wirkt das Versatzspiel derart aufgesetzt und in Bezug auf die erotische Komponente altbacken. Der Inzestgedanke – durch die Unwissenheit des Vaters und Domenicas holde Absichten abgemildert, wenn auch nicht eliminiert – ist kontraproduktiv in Bezug auf die gesamte Anlage ihres Charakters. Sehr gut zeichnet der Autor Domenicas bisherige Entwicklung – der frühe Tod ihres Vaters hat sie ihrer Kindheit beraubt und lässt die selbstbewusste Frau schwer Beziehungen knüpfen. In letzter Konsequenz wird sie in dieser Vergangenheit wieder Kind und sucht eine zweite Chance. Im Gegensatz zu den Passagen, die Jeschke im fünfzehnten Jahrhundert nuanciert stetig wiederholt, erinnert die zweite Reise eher an Kim Grinwoods „Replay“ mit komischen Einlagen.
Nach einem effektiven, dunklen Auftakt verliert sich Jeschke zum Teil in seinem Werk. Zu oberflächlich spielt er mit den Versatzstücken von Zeitreisegeschichten – die Begegnung mit einer älteren Version ihrer selbst, das Scheitern in der Vergangenheit und die Suche nach der zweiten, dritten oder vierten Chance. Wie sein literarisches Vorbild – für diesen Roman und in diesem Fall – Carl Amery geht es ihm weniger um einen logisch aufgebauten Text, sondern eher eine amüsante intellektuelle Spielerei. Er setzt sich kaum mit der geheimnisvollen kirchlichen Organisation auseinander und so geht es ihm mehr um die Frage an sich als eine mögliche Antwort zu finden. Das funktioniert über weite Strecken des Buches ergreifend gut, um dann am Ende in einem sentimentalen und unbefriedigenden offenen Ende wie bei einem Kartenhaus zusammenzufallen.
Im Vergleich zu Amerys oft amüsanten und hintergründigen Geschichten ist Jeschke der bessere Autor und der bessere Szenarrist. Sein Text ist – soweit es bei Zeitreisegeschichten geht – entweder schlüssig oder emotional ansprechend. Seinen Charakteren verleiht er individuelle und vielschichtige Züge. Trotzdem erweckt er den Eindruck, sich ein bisschen selbst in seinen Text verliebt zu haben. Viele Szenen wirken ausgedehnt, extrapoliert, zu viele Details erdrücken den Leser insbesondere zu Beginn der Geschichte. Beispielhaft die erste Fahrt Domenicas durch das zerfallende Rom. Eine Lawine unterschiedlichster Eindrücke stürzen auf den Leser ein, wichtige Fakten und Nebenkriegsschauplätze wechseln sich ab. Der Leser ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, wichtiges von unwichtigem zu unterscheiden. Am Ende des Buches ist es genau umgekehrt, Wolfgang Jeschke möchte nicht mehr unwichtiges von wichtigen Informationen unterscheiden.
Trotz einiger Schwächen im Aufbau und in der literarischen Umsetzung seiner Ambitionen – das wird allerdings erst im Nachwort deutlich – ist Jeschkes Buch eines der wichtigsten deutschsprachigen Science Fiction Veröffentlichungen des Jahres. Sicherlich wird er die wichtigen beiden Preise – den SFCD Literaturpreis und den Kurd Lasswitz Preis – verdientermaßen im nächsten Jahr erhalten. Über weite Strecken hat der Autor ein schlüssiges, deprimierendes und wenn auch nicht unabwendbares, zumindest folgerichtiges Szenario aufgebaut. Die einzige Rettung scheint die Kirche anbieten zu können. Nicht als Institution des Glaubens, sondern als Hort des Wissens und mit dieser Erkenntnis schlägt Jeschke sogar den Bogen zu Walter M. Millers „Lobgesang auf Leibowitz“ und fasst über fünfzig Jahre Evolutionsgeschichte der Science Fiction in einem Atemzug und vor allem sehr unterhaltsam zusammen.
Wolfgang Jeschke: "Das Cusanus Spiel"
Roman, Softcover, 720 Seiten
Droemer 2005
ISBN 3-4261-9700-6
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/i...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info