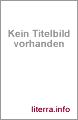|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science-Fiction > Das Dorn Projekt |
Das Dorn Projekt
| DAS DORN PROJEKT
Buch / Science-Fiction |
Inzwischen liegen mehr als zwei Dutzend Humanx- Commonwealth Romane aus Alan Dean Fosters Feder vor. Von „Die denkenden Wälder“ über die verschiedenen Flinx- Romane bis zu diesem frühen Zyklus „Founding of Commonwealth“ reicht das Spektrum.
Dabei hat sich und bemüht sich Foster, auch serienunabhängige Romane in seinen Kosmos zu integrieren.
Das interstellare Vielvölkerspektrum reicht von den emporstrebenden Menschen über die insektoiden Thranx zu den oft im Hintergrund agierenden AAnn. Das utopische Ziel ist eine Gemeinschaft, in der das Gemeingut über egoistischen Einzelinteressen steht.
Inzwischen liegt der dritte Roman des „Founding of Commonwealth“ vor. Ursprünglich als Trilogie konzipiert ist Alan Dean Foster zu einem Zyklus von Romanen umgeschwenkt und schaut sich der aufmerksame Leser den stetig steigenden Umfang der Bücher bei sinkendem Gesamtfortschritt an, kann Foster das Konzept noch eine Weile spielen.
Obwohl Menschen und Thranx den Orionarm der Galaxis sich teilen, beschränkte sich der Kontakt aufs Oberflächlichste. Fast 100 Jahre nach dem Erstkontakt und der ersten gemeinsamen Aktion gegen hinterhältige Feinde gelang trotzdem nicht der Durchbruch bei den gegenseitigen Beziehungen. Auf diplomatischer Ebene finden Verhandlungen statt, Verträge entworfen und verworfen, doch ratifiziert oder gar mit Leben erfüllt worden ist bislang nichts. Die Menschen fürchten sich weiterhin vor dem Äußeren der Insekten und beschwören alte Feindbilder, die Thranx können mit dem bleichen, wabbeligen Fleisch nichts anfangen. Sehr natürlich zeichnet Foster auf beiden Seiten jeweils das Bild einer von Vorurteilen und Klischees geprägten Rasse. Mit kurzen, prägnanten Floskeln entblößt er die scheinbar oft offenherzigen Menschen als hemmungslose Egoisten.
Trotzdem gibt es auf beiden Seiten verstärkt Idealisten, die die Träume einer friedlichen Verständigung hegen und pflegen. Andere möchten mit Gewalt diese zarten Bande zerstören und suchen sich ein geeignetes Ziel für ihren Hass. Die erste zwischenkulturelle Kunstausstellung wird das Ziel der Terroristen aus beiden Lagern.
In einer Parallelhandlung beobachten die AAnn eine Gruppe von Archäologen, die auf die Reste einer technologisch fortgeschrittenen menschlichen Kultur stoßen. Diese ist plötzlich vor tausenden von Jahren ausgestorben. Die AAnn suchen Parallelen zur Gegenwart und hoffen mit neuen Erkenntnissen, die neuen Feinde auch loszuwerden.
Alan Dean Fosters Abenteuerromane leben in erster Linie von ihrer wilden Romantik und dem Flair des Fremden. Diese beiden Elemente bestimmen auch den dritten und bislang schwächsten Roman des Zyklus. Die Ausgrabungen schildert er sehr detailliert und führt unbedarfte Leser in diese fesselnde Materie ein. Dabei bemüht er sich, mehr Fragen zu stellen als zu beantworten. Geschickt baut er Bezüge zur weiter sehr schleppend voranschreitenden Gründung des Commonwealth auf und unterstreicht, dass kluge Menschen und Außerirdische erst ihre Vergangenheit kennen sollten, bevor sie eine gemeinsame Zukunft zerstören.
Eine weitere Stärke des Romans ist die fremdartige und doch sympathische Beschreibung verschiedener außerirdischer Rassen. Auch wenn es körperliche Unterschiede gibt, auch wenn weder Religion noch politische Ausrichtung übereinstimmen, Foster findet einfache, fast schon simple Gemeinsamkeiten und überbrückt damit die unübersehbaren Differenzen. Seine Aliens leben einfach. Das zeigt sich an kleinen, aber genau beobachteten Gesten. Oft wirken sie überzeugender und greifbarer als seine menschlichen Protagonisten. Die Botschafterin Fanielle Anjou sei hier stellvertretend genannt. Zu Beginn versucht sie mit einem Trick, eine Audienz bei der Thranx Regierung zu erhalten. Nach einem tragischen Anschlag auf ihr Leben stellt sich dieser Trick als Wahrheit heraus. Damit rührt Foster in verschiedenen Klischees. Warum nicht einen Trick als Trick entlarven und so zwischen den intelligenten Wesen und den Menschen zumindest kurzzeitig eine Barriere aufzubauen? Diese Missverständnisse müssten dann überwunden werden und das gegenseitige Verstehen könnte zu Vertrauen führen? Warum muss bei diesem Anschlag ihr Lebensgefährte ums Leben kommen, während sie ihre schwierige Mission fortführt. Warum werden die Positionen nicht umgekehrt, die Diplomatin stirbt und ihre Freund/Mann muss trotz seines Verlustes die Brücke zu den Thranx überschreiten? Foster macht es sich in seinem Handlungsgeflecht oft zu einfach und sucht trotz des inzwischen dreidimensionalen und vielschichtigen Universums keine neuen Ansätze. Das verzeiht der aufmerksame Leser einem erfahrenen Schriftsteller einmal, vielleicht ein zweites Mal, doch es häuft sich in Fosters Romanen. Zu oft spielt er mit Gefühlen und konzentriert sich auf das Vordergründige, während er einen intelligenten Hintergrund zu wenig und dann zu fahrlässig nutzt.
Fast schon surrealistische Züge nimmt der Roman in der Sekunde an, als zwei unterschiedliche Terroristengruppen sich am Objekt der Begierde – eines fatalen Anschlages – treffen und beginnen, über eine von Misstrauen geprägte Kooperation nachzudenken. Mit einem Schuss bissigen Humors lässt Foster die Thranx und Menschen ihre terroristischen Erfahrungen austauschen. Das Ziel ist eine weiterreichende Kooperation zwischen den beiden Rassen zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie zusammenarbeiten. Wie so oft in der menschlichen Geschichte steht das Ziel in starkem Widerspruch zum Weg. Obwohl Foster in diesen Passagen und den damit verbundenen steifen Dialogen zur Übertreibung neigt, gehören sie zu den stärksten Abschnitten des Buches. Die Verknüpfung des futuristischen Backgrounds mit aktuellen politischen Bezügen beinhaltet einen eindringlichen Appell zur Völkerverständigung und mahnt, dass Gewalt der falsche Weg ist. Dadurch gewinnt der Roman auch vor dem Hintergrund weiterer Bombenanschlägen in Europa und einem ständigen Terror im Irak eine für Foster ungewöhnliche und beeindruckende Intensität.
Das ist aber nur ein Teilaspekt dieses Buches. Neben den Aktivitäten dieser fanatischen Splittergruppen sieht Foster weitere Schwierigkeiten im Integrationsprozess: das Misstrauen und die Abneigung gegenüber den Andersartigen. Hier beschreibt er sowohl auf der Seite der Menschen als auch der Thranx die jeweiligen Vorurteile. Damit gibt er der passiven, schweigenden Mehrheit ein Gesicht. Der Autor stellt ungewöhnlich offen dar, wie schwer es ist, die gewohnten Bahnen zu verlassen und den jeweiligen Partner als Wesen zu betrachten. In den ersten beiden Romanen arbeitete er mit jeweils einer kleinen Gruppe von unterschiedlichen Charakteren, jetzt konzentriert er sich auf eine Berufsdiplomatin. Foster zeigt ihre Unfähigkeit auf, trotz ihrer umfassenden Ausbildung in die Haut der Anderen zu schlüpfen. Sie braucht lange, um ihrem Willen auch Taten folgen zu lassen. Erst in dem Moment, in welchem sie ihre persönliche Grenze überschritten hat, kann sie auch nach außen wirken. Sie streift ihre Karriere, ihre Ambitionen ab, um ein Mittler zwischen den Thranx und Menschen zu werden. Nicht ganz so dramatisch, aber es bestehen zumindest Ähnlichkeiten zu Charakteren wie Ender Wiggins in Orson Scott Cards „Sprecher für die Toten“ Serie. Der größte Unterschied ist, dass Wiggins das ausgelöschte fremde Volk betrauert, Fosters Diplomatin die Zeit, die Möglichkeit und schließlich den Willen hat, das Rad der Geschichte entscheidend weiterzudrehen.
Obwohl er auf zwei Handlungsebenen umfangreiche Plots angesiedelt hat, wirkt der Roman mit mehr als 400 Seiten gedehnt und selten konzentriert. Foster verzweigt die Handlung, ist aber nicht in der Lage, einzelne Ebenen befriedigend zu beenden und scheut sich davor, zu viele Zügel in diesem dritten Band aus der Hand zu geben. Im ersten Roman konzentrierte er sich auf zwei Wesen – einen Menschen und einen Thranx – in einer für beide gefährlichen Situation. Nach anfänglichen Misstrauen mussten die Beiden die jeweiligen Schutzschilde zur Seite legen, um zu überleben. Hier steht Foster eine größere Ebene und verschiedene Ansätze zur Verfügung, aber der Leser findet zu wenig wirklich bedrohliche und dramatische Situationen, zu wenig direkte Informationen über die archäologischen Funde auf der einen Welt und schließlich eine zu geradlinige und zu einfache Lösung vor.
Dabei ist Foster trotz vieler verschenkter Ansätze ein intelligenter und unterhaltsamer Gastgeber. Der Roman liest sich sehr geradlinig und fließend, aber er reicht trotz der aktuellen politischen Ansätze und der gut gemeinten Intention Fosters nicht über gehobene Unterhaltung hinaus. Im gleichen Universum spielt der Roman „Die denkenden Wälder“, in dem Foster sich sehr direkt und nachhaltig mit dem Thema Umweltverschmutzung/ Umweltzerstörung auseinandergesetzt hat. Niemand wird bezweifeln, dass insbesondere aktuell das Thema fanatischer Terrorismus eine ähnliche Aktualität hat. Die Unterschiede zwischen den beiden Romanen könnten nicht größer ein. „Die denkenden Wälder“ ist eine intensive Warnung und Auseinandersetzung mit fast allen Facetten, „Das Dorn –Projekt“ nutzt den anderen Ansatz, weil er in und bedrückend unterhaltsam ist, um dann eine weitere, fast schon kitschige „Wir sind alle Brüder“- Geschichte mit einem vorläufigen Happy-End zu erzählen. Viele der guten Denkansätze gehen leider in diesem Roman verloren.
Alan Dean Foster: "Das Dorn Projekt"
Roman, Softcover
Bastei 2005
ISBN 3-4042-4340-4
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/i...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info