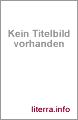|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science-Fiction > Sonnensturm |
Sonnensturm
| SONNENSTURM
Buch / Science-Fiction |
Mit „Sonnensturm“ ist eine kuriose und zwiegespaltene Fortsetzung zu „Die Zeit- Odyssee“ der beiden britischen Autoren erschienen. Stellte der Auftaktband dieser Serie eine verschachtelte, aber leider intellektuell wenig ansprechende Reise durch verschiedene Paralleluniversen und Zeitebenen dar, präsentiert sich „Sonnensturm“ auf den ersten Blick nicht nur als Katastrophenroman, sondern zumindest theoretisch als legitimer Nachfolger der allerersten Zusammenarbeit vor dieser Serie der beiden Schriftsteller. „Das Licht anderer Tage“ war ein altmodischer, aber nicht veralteter Hard Science Fiction Roman und nahm Ideen aus Brian Shaws klassischem Roman „Andere Augen, Andere Welten“ auf. Im Kern ist „Sonnensturm“ eine Katastrophengeschichte. Die Idee, dass die Sonne das menschliche Leben nicht nur geschaffen hat, sondern auch beenden kann, hat eine beängstigende Faszination. Leider haben die Autoren das Gerüst mit den Übermenschen – Erstgeborene genannt - aus dem ersten Roman auch noch um eine pseudoreligiöse Komponente unnötig erweitert. Die beiden Bestandteile wollen nicht zueinander passen.
Das Verbindungsglied dieser so unterschiedlichen Romane ist handlungstechnisch nicht zu lokalisieren, sondern ist die Soldatin Bisesa Dutt. Sie taucht einen Tag nach ihrem Verschwinden in Afghanistan wieder auf ihrer Welt auf. Für sie sind fünf Jahre auf einer zersplitterten Parallelerde vergangen. In dieser Zeit hat sie neben Kipling auch Alexander den Großen oder Dschinghis Khan kennen gelernt. Die Spannungen zwischen den aus unterschiedlichen Zeiten entführten Soldaten entluden sich in einer fremdartigen Inkarnation Babylons. Bisea kehrt an dem Tag zurück, an dem eine Entladung der Sonne das technische Leben auf der Erde und den beiden Kolonien auf Mond und Mars zum Erliegen bringt. Ein Forscher auf dem Mond sagt voraus, dass es wenige Jahre später einen massiven Sonnensturm gibt, dem die ganze Erde zum Opfer fallen wird.
Sie treibt das Handlungsgeschehen nicht voran und irritiert die Wissenschaftler und Militärs auf ihrem Weg, die Menschheit aus eigener Kraft zu retten. An einer Stelle sehnt sich einer der Charaktere Bruce Willis wieder herbei. Der Leser wünscht sich Willis ebenfalls herbei. Um dem alternden Arthur C. Clarke und dem merkwürdig lieblos schreibenden Stephen Baxter deutlich vor Augen zu führen, dass es ihre Aufgabe ist, eine Geschichte ernsthaft und nachhaltig zu erzählen. Die eigentliche Katastrophenhandlung – die Bezüge zur Serie werden später detailliert besprochen – ist eine Hommage an die ersten Romane Clarkes. Wissenschaftlich fundiert, sehr kompakt und konzentriert, aber nicht episch dargestellt. Eine Würdigung der bisherigen Forschung und eine Verneigung vor dem Mut einiger weniger Menschen. Wie in den bisherigen Kooperationen werden weite Teile des Buches von Stephen Baxter geschrieben worden sein. Er trifft Clarkes Stil sehr genau. Diese Handlungsebene wird – trotz einiger Unwahrscheinlichkeiten und Ungenauigkeiten – sehr ernsthaft erzählt. Die beiden Autoren verzichten auf jegliche romantische Klischees – auch wenn es eine obligatorische Abschiedsszene gibt. Die verschiedenen vorgeschlagenen Lösungen sind theoretisch nachvollziehbar. Baxter verzichtet auf pathetische Szenen. Der Pathos wird dezent, aber spürbar eingesetzt. Für zwei britische Autoren wirkt das Buch trotzdem sehr amerikanisch und antichinesisch. Schließlich gestehen sie aber doch dem Rest der Welt ein gewisses Krisenmanagement zu. Obwohl Baxter und Clarke hier ein epochales Thema aufgreifen, erinnert der Roman nie an die letzten, eben epochalen Romane Stephen Baxters. In „Der Orden“ oder auch „Sternenkinder“ hat er unwiderstehlich zu lesende, sehr umfangreiche und komplexe Themen interessant und innovativ dargelegt. All diese Elemente bis auf den ersten interessanten Komplex des Sonnensturms fällen gänzlich. Oft schweifen die Autoren bei den nicht notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen in Monologe zu anderen, kurz angerissenen Themen ab. Bei der Kürze des Buches, der Großzügigkeit des Druckbildes und der oft mangelhaften Gestaltung einzelner Charaktere wirkt die literarische Nutzung dieser Einschübe zweifelhafter denn je. Erschwerend kommt als Tatsache hinzu, dass die einzelnen Protagonisten sich untereinander diese Monologe halten. Kurze Frage- Antwortpassagen oder gar komprimierte Lexikaeinträge hätten das gleiche Ergebnis erzielt, die Handlung aber effektiver vorangetrieben und im Gesamttext ein homogeneres Bild erschaffen.
Wie bei diesem Subgenre üblich, konzentrieren sie sich in ihren umfangreichen Handlungsbögen auf eine Reihe von unterschiedlichen Charakteren. Mit dieser Reduktion auf wenige für den Leser schließlich charakterisierte Protagonisten versuchen die Autoren, die Katastrophe greifbarer und deren Folgen messbarer zu beschreiben. Die Schwierigkeit des Textes liegt in der ausschließlich oberflächlichen Charakterisierung der Figuren. Schon im ersten Buch konnte Bisesa Dutt als Soldatin mit einem Herzen aus Gold nicht überzeugen. Zu steif agieren auch hier alle Figuren. Kaum einer Figur wird eine überzeugende und notwendige emotionale Tiefe gegeben. Dadurch verlieren die Protagonisten, die in der Folge von Unfällen oder dem Sonnensturm ihr Leben verlieren, an Kraft. Sie geraten ungewöhnlich schnell in Vergessenheit. Im Rahmen der Geschichte werden sie benötigt, um die verschiedenen wissenschaftlichen Thesen dem Leser verständlich zu machen.
Als reiner Katastrophenroman nach dem inzwischen in Hollywood gängigen Konzept atemloser Action und möglichst keinem Tiefgang funktioniert das Buch. Auch wenn sich die beiden Autoren Seitenhiebe auf Produzenten wie Jerry Bruckheimer und dessen „Armageddon“ sowie die klassischen Invasionsfilme der fünfziger Jahre nicht verkneifen können, fallen sie an mehreren Stellen auf die gleichen Klischees zurück.
Die Schwierigkeit dieses Romans liegt in der übergeordneten Ebene der Erstgeborenen. Das einzige Verbindungsglied stellt die Soldatin Bisesa Dutt dar. Sie ist der Ansicht, die Katastrophe wurde von der geheimnisvollen, aber mächtigen Rasse der Erstgeborenen inszeniert, um die Ausbreitung der Menschen ins All zu verhindern. Darum soll am Tag der Geburt Christis ein Planet in den Kern der Sonnen gelenkt worden sein. Somit verbinden die Autoren die Entstehung des christlichen Glaubens nicht mit einem übernatürlichen Ereignis, sondern sähen den Impuls der (Selbst-)Vernichtung. Ein wichtigeres Buch als der vorliegende Roman könnte die Proteste verschiedener fundamentalistischer Gruppen hervorrufen. Hier wird dieses Szenario derart unglücklich und überzogen beschrieben, das es nur noch zum Lächeln anregt. Ob die zweitausend Jahre sich entwickelnde Bestrafung/ Vernichtung der Menschheit Teil eines sadistischen Spiels oder Zufall ist, lassen die Autoren offen. Hinzu kommt die eingeschränkte Perspektive auf die Erstgeborenen. Die beiden Handlungsebenen werden derart unglücklich verbunden, dass der Leser unwillkürlich das Gefühl hat, im Grunde zwei Bücher zu lesen: die Katastrophengeschichte und eine entrückte oder entkernte moderne Vision von Clarkes visionären „2001“ und Folgegeschichten. Das sich die Autoren verzweifelt bemühen, weitere Bezüge zu Clarkes Werk darzustellen, wird an der späten, viel zu späten Erwähnung von Clarkes „Fahrstuhl den Sternen“ deutlich. Warum diese Idee nicht konsequenter in den Text integriert und zu einem Teil der potentiellen Lösung gemacht worden ist, stellt eine weitere Unzulänglichkeit der Geschichte dar.
Im Gegensatz zu romantischer Verzweifelung wie in Larry Nivens Kurzgeschichte „Verhängnisvoller Mond“ oder Poul Andersons oft kritischen Geschichten, in denen die Menschheit den Kern ihrer eigenen Vernichtung in sich trägt anstatt an den durch eine Katastrophe anfallenden Aufgaben zu wachsen, sehen Baxter und Clarke die Bedrohung als Schlüssel zur nächsten politischen und intellektuellen Ebene der Menschheit. Bis auf die Chinesen schließen sich die Völker der Welt zusammen. Die beiden Autoren räumen den beiden extremen Randgruppen – die sich vor dem Unglück rücksichtslos verschließen und die religiösen Fanatiker – nur begrenzten Raum ein. Sie ignorieren sie auch nicht. Im Gegensatz zu den zahlreichen Meteoritengeschichten und ihrem runterzählenden Countdown basieren das genaue Datum der Bedrohung und deren Folgen auf der mathematischen Gleichung eines einzigen Mannes. Mit seiner ersten Vorhersage hatte er Recht und jetzt glaubt ihm die Menschheit. Bei einem Arthur C. Clarke Roman könnte sich noch die Frage stellen, welche übergeordnete Macht – siehe „2010“ – eingreifen könnte. In dieser Geschichte ist der Mensch allerdings auf sich alleine gestellt und das ist für einen wissenschaftlich orientierten Science Fiction Roman nicht nur erforderlich, sondern in Bezug auf eine innere Logik und Glaubwürdigkeit zwingend notwendig.
Als einzelnes Werk betrachtet wäre „Sonnensturm“ eine interessante Katastrophengeschichte. Aus einem technokratischen Winkel heraus wird die Gefahr erkannt, analysiert und schließlich gebannt. Im Laufe dieser Einzelschritte entsteht eine zweite, subtilere Bedrohung, die erstaunlich schnell ebenfalls mit logischen, wissenschaftlich fundierten Schritten unter Kontrolle gebracht werden kann. Routinierte Autoren umgeben diesen Rahmen mit einer Handvoll unterschiedlicher, mäßig interessanter, aber vor allem austauschbarer Charaktere und einer Reihe von actionhaltigen Szenen, die auf der Erde, dem Mond und im All spielen. Diese Bestandteile sind alle vorhanden und werden von den beiden erfahrenen, aber unterschiedlich veranlagten Autoren zu einem kompakten, komplexen, aber nicht ausufernden Roman verbunden. Die Schwierigkeiten liegen in den Passagen, die über eine klassische Bedrohungsgeschichte hinaus in die Bereiche Religion oder höhere Intelligenz hineinreichen. Sie wirken zum Teil naiv und erstaunlich unreflektiert geschrieben, unbeholfen in das ansonsten sehr ansprechende Gesamtwerk integriert und aus Übermotivation mit dem ersten Roman der Serie verbunden. Wer über diese Szenen hinweg lesen kann – sie tragen nichts zur Grundhandlung bei – findet hier einen erstaunlich altbackenen, aber zumindest gut zu lesenden Katastrophenroman mit einem fundiert vorgetragenen, aber allgemein verständlichen wissenschaftlichen Hintergrund.
Stephen Baxter/ Arthur C. Clarke: "Sonnensturm"
Roman, Softcover, 411 Seiten
Heyne 2006
ISBN 3-4535-2125-0
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/i...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info