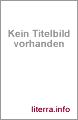|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science-Fiction > Urania |
Urania
| URANIA
Buch / Science-Fiction |
Nach dem populärwissenschaftlichen Sachbuch „Die Mehrheit der bewohnten Welten“ – auch wenn dieser Text eher einer philosophischen Studie als einem trockenen, distanzierten Sachbuch ähnelt und von der Konzeption her eine gewisse Ähnlichkeit sowohl mit dem vorliegenden Text als auch Flammarions späteren, sehr populären Roman „Lumen“ aufweist – legt Dieter von Reeken mit „Urania“ eine weitere Arbeit des bekannten französischen Astronomen auf. In seinem sehr ausführlichen Vorwort stellt der Herausgeber nicht nur Flammarions Biographie vor, sondern geht insbesondere auf seine Bibliographie und die Veröffentlichungen seiner Werk in Deutschland im 19. Jahrhundert ein. Immer wieder verbindet er dessen unglaublich vielfältige Entdeckungen auf dem Gebiet der Astronomie mit seinem zeitkritischen Geist und seiner außerordentlichen Phantasie. Wie viele Forscher wollte Flammarion mit seinen farbenprächtigen, aber zumindest an der Oberfläche philosophischen Werken im Volke eine Begeisterung für die Sterne am Himmelszelt wecken und gleichzeitig über seine eingeschränkten Möglichkeiten als Forscher – immer wieder auf Anstellungen und Fördergelder angewiesen – hinaus die in den Sternenkarten verzeichneten Leuchtpunkte am Firmament mit Leben erfüllen. Im Gegensatz zu seiner eher trockenen, disziplinierten Arbeit am Teleskop und mit dem Rechenschieber verschichtet er in seinen vorliegenden Texten auf jegliche Technik und die Reisen ins All erfolgen in Begleitung von Geistwesen. Gleichzeitig reflektieren, ergänzen und nicht selten mit einem ironischen Unterton kommentieren diese übernatürlichen Erscheinungen die Gedanken des Reisenden. Auch wenn seine Texte überwiegend aus sehr phantasievollen Beschreibungen des möglichen Lebens im All bestehen, macht dieser literarische Trick mit einem übernatürlichen Reiseführer die vorliegenden Arbeiten geschmeidiger und lesenswerter. Zusätzlich spiegeln sich eine Reihe von autobiographischen Anspielungen und Würdigungen oder ironische Karikaturen seiner Zeitgenossen im Text wieder.
Dieter von Reeken legt die einzige bekannte deutsche Auflage des Episodenromans aus dem Jahr 1894 neu auf. Mit mehr als einhundert Zeichnungen versehen – unterschiedliche Künstler haben den Text illustriert, fast zu einer Art Bildergeschichte extrapoliert – erscheint die Geschichte zum ersten Mal in Frakturschrift. Die Zeichnungen von Künstlern wie Bayard, Bieler, Falero, Gambard, Myrbach oder Riou stammen allerdings nicht aus der deutschen Erstauflage, sondern sind den Originalausgaben der Jahre 1889, 1894 und 1919 entnommen worden. Damit geht der Herausgeber im Gegensatz zu seinen bisher authentischen Reproduktionen einen logischen Schritt voran, erweitert die ursprünglich ansonsten eher karge Reproduktion der Erstausgabe um die sehr eloquenten Graphiken und präsentiert quasi als Erstauflage „Urania“ mehr als einhundert Jahre nach ihrer Entstehung.
Wie bei allen seinen Publikationen ist das Druckbild sehr sauber, die Zeichnungen sind so gut wie möglich bei den schlechten Originalvorlagen umgesetzt worden und nicht zuletzt aufgrund seiner Seltenheit als Schlüsselroman zwischen den technokratischen Utopisten und den eher den Geisteswissenschaften zugewandten Phantasten eine Lektüre und eine Anschaffung wert.
„Urania“ besteht – wie Dieter von Reeken ausführlich in seinem informativen Vorwort erläutert – aus drei nur durch die handelnden Personen verbundene Novellen. Oder zumindest erscheint es so. Ein weiteres verbindendes Element der ersten beiden Novellen ist die Begegnung mit unterschiedlichen Musen. In sozusagen der Titelgeschichte „Urania“ unternimmt der Ich- Erzähler, eine unverkennbares Alter Ego Flammarions, eine Traumreise mit Urania, der Muse der Astronomie. Im zweiten Teil begegnen zwei junge Menschen der reinen und wahren Liebe, zumindest in griechischer Zeit und romantischen Romanen oft als Amor dargestellt, und im letzten Teil der Geschichte erscheint der Protagonist des zweiten Teils als eine Art Geistererscheinung nach seiner Reise zum Mars. Im dritten Teil wird zwar wieder auf die Musen verwiesen, ihre Aufgabe – den Menschen aufzuklären – ist allerdings getan.
Insbesondere „Urania“ als einleitende Geschichte lehnt sich am stärksten an Flammarions populärwissenschaftlichen Text „Die Mehrheit der bewohnten Welten“ an und ist nicht nur eine Quelle der Inspiration für die Reisen des kleinen Prinzen, sondern wird vor allem in Kurd Laßwitzs esoterischen späteren Werken extrapoliert. Gleich zu Beginn der Geschichte mit einigen deutlich ironisch überzogenen Passagen karikiert in Form seines traditionsbewussten Vorgesetzten den alten Schlag der Wissenschaftler. Streng auf die Form bedacht, ohne Phantasie, nur was sich mit Händen anfassen lässt, kann wirklich sein und ist damit untersuchenswert. Ausgerechnet in einer Uhr mit einer Statue Uranias findet der Erzähler den Schlüssel zu anderen Welten. Der Weg führt zeitlos zu verschiedenen Welten. Hier zeigt sich nicht nur der Naturwissenschaftler, sondern der Phantast. In farbenprächtigen Bildern, unterstrichen mit einem allerdings an manchen Stellen zu stark beschreibenden und damit schwer zu lesenden Stil lernt der Leser im Vorbeiflug eine Reihe von Welten kennen. Das Spektrum reicht von einer klassischen Wasserwelt über Planeten ohne Wasserstoff bis zu einer reinen Feuerhöhle. Flammarion geht bei seiner Beschreibung des vielfältigen Lebens nicht immer ins Detail und bei manchen Planeten würde der Leser lieber verweilen, als den folgenden philosophischen Ergüssen zu folgen, als Einheit betrachtet wirkt diese Odyssee im All wie ein Prolog der folgenden Science Fiction Abenteuer des nächsten Jahrhunderts. Ganz bewusst will Flammarion aufzeigen, dass Leben unter allen Bedingungen entstehen kann. Damit schlägt er sehr geschickt den Bogen zu seiner stetigen Kritik an der alten Forschergeneration, deren Arbeit auf langweiligen Tabellen, der Aussagekraft der Mathematik und schließlich ihrem verstaubten Wissen besteht. Im vorliegenden Text stellt er die sich heute bewahrheitende These auf, dass man nicht nur die Stellung der glänzenden Punkte am Himmel anzeigt und mit Hilfe der Mondphasen Ebbe und Flut bestimmen wird, sondern in erster Linie nach Leben, nach intelligentem Leben im All suchen wird. Auch wenn die NASE es heute nicht unbedingt gerne zugibt, beinhaltet ihre Suche im All das gleiche Kernmotiv. Am Ende der kurzweiligen Geschichte verzichtet Flammarion darauf, zwischen Traum und Realität zu unterscheiden. Er liefert wie in seinem sekundärliterarischen Werk keine grundlegenden Erläuterungen für die Traumreisen ab, sondern sieht sie als normale Extrapolation bestehender wissenschaftlicher Forschung. Das faszinierende dieses Textes sind die farbenprächtigen Bilder, die Idee, populärwissenschaftliche Forschung mit überraschend weitsichtigen philosophischen Gedankenmodellen zu kombinieren. Flammarion gibt seinen Lesern einen Einblick in die Tiefe des Alls – die wissenschaftlich erfassbare, aber vor allem die notwendige geistige Reife für eine solche Reise und lehnt die kriegerische Vergangenheit seiner Mitmenschen ab. Knappe fünfzig Jahre später wird Olaf Stapledon den Stab wieder aufnehmen und in seinen Bahnbrechenden Romanen den Menschen noch ein wenig weiter hinaus in die ferne Zukunft im All führen. Während Stapledon allerdings seine Utopien in einem nüchternen, fast distanzierten Stil geschrieben hat, vereinigt Flammarions kleine Novelle den für Jules Vernes Werk so typischen Optimismus mit einer fast traumwandlerischen Phantasie.
Am Ende der Geschichte vereint sein Freund Georges Speros den Ich- Erzähler der ersten Episode wieder mit dem Abbild Uranias. Dieser Georges Speros ist, obwohl seine veröffentlichten Texte philosophisch und nicht populistisch sind, einer der am meisten gelesenen Autoren seiner Zeit. Sicherlich eine verhaltene Anspielung auf Jules Verne, der wie kein zweiter zeitgenössischer Autor wissenschaftliche Forschungsergebnisse mit oft stringenten, aber sehr spannenden erzählten Abenteuergeschichten verbunden hat. Vom Leben ist dieser junge Mann aber eher enttäuscht und mehr als einmal fürchten seine Freunde, dass er in Schwermut verfallen könnte. Auf einer seiner Reisen begegnet er dann allerdings einer hübschen, jungen Norwegerin, die nicht nur seine Werke gelesen hat, sie dient ihm als Inspiration für seine zukünftigen Ideen und Forschungen. Die Beiden begegnen einer weiteren Muse, Amor. In fast schwülstigen Bildern beschreibt Flammarion diese idealisierte Beziehung. Im Gegensatz zu seinen farbenprächtigen Ausflügen ins All hat der Leser das Gefühl, er versucht hier seine eigenen Emotionen literarisch aufzuarbeiten und sucht Erklärungen für dieses wunderschöne, aber unerklärliche Ereignis. Die Geschichte kumuliert in einer Ballonfahrt zu den Nordlichtern hoch. Im ersten Text hat der Autor die Wunder des Universums beschrieben, im folgenden Text eines der Wunder der Erde. Die Liebessymphonie endet allerdings auf einer tragischen Note und beinhaltet doch einen sehr überraschenden Neuanfang. Beide kommen beim Absturz des Ballons ums Leben. Die junge Frau opfert sich für ihren Geliebten, doch ihre Tat ist vergebens. Damit beendet Flammarion im Grunde diese klassische, naturalistische Liebesgeschichte und widmet sich wieder seinen utopischen Phantasien sowie dem Ich- Erzähler. Interessant wird diese Episode aber aus einem anderen Grund. Die jugendliche Freundin Iclea entspricht wahrscheinlich Flammarions erster Ehefrau Sylvie Petiaux- Hugo, seine Jugendliebe und vor allem seine Begleiterin auf einer Reihe von Ballonfahrten. ER hat sie 1874 geheiratet. Wahrscheinlich versucht er seine eigenen Eindrücke vom erdrückenden Gefühl wahrer Liebe in Worte zu fassen und bis auf das tragische Ende entspricht George zumindest zeitweise seinem Alter Ego, der die Wissenschaftler zugunsten seiner Freundin und späteren Frau zumindest teilweise ruhen ließ. In Hinblick auf den männlichen Protagonisten – einen sehr erfolgreichen Schriftsteller, der mit seinen kleinen Thesenblättern im Grunde aufklären und kein Millionenpublikum unterhalten wollte – stellt sich die Frage, ob die hier gezeigten Züge nicht nur Flammarions Wesen entsprechen, sondern in gewisser Weise auch ein Ausdruck seiner durchscheinenden Eitelkeit sind. Zumindest in autobiographischer Hinsicht geben die ersten beiden Teile dieser Novellensammlung Einblick in die Psyche eines jungen, sehr erfolgreichen, ernsthaft forschenden, aber auch eitlen und von Esoterik und Mystik faszinierten Mannes. Alleine aus dieser Perspektive stellt „Urania“ den Schlüssel zu seinem Gesamtwerk dar. Er wird viele Ideen wieder aufgreifen und der abschließende dritte Teil dieser Sammlung stellt einen entsprechenden Schritt in die Richtung seiner späteren philosophisch- wissenschaftlichen Werke dar.
Dieser in die Handlung zurückgekehrte Ich- Erzähler erfährt bei einem Wahrsager, dass die beiden jetzt als Seelen/ Geisteswesen auf dem Mars leben. Er als sie, sie als er. Der Geschlechtertausch ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls überraschend und wird im Mittelpunkt der letzten Geschichte stehen. Geisterwesen, übernatürliche Erscheinungen, zum Leben erwachte Musen sind alles Elemente, mit denen Flammarion ganz entgegen seiner wissenschaftlich orientierten Mitautoren jegliche Technik aus seinen Büchern verband hat. Wenn er diese beschreibt, so ist sie inzwischen die Phantasie des Forschers einschränkend – siehe den Auftakt der ersten Novellen – oder tödlich – siehe die Ballonfahrt – oder schränkt den aufmerksamen Geist – siehe die „gefangene“ Urania im Standbild - ein. Sowohl handlungstechnisch als auch inhaltlich wäre es sinnvoller gewesen, diese Episode bis auf die Reinkarnation als Geistwesen auf dem Mars an den Inhalt dieses Büchleins zu stellen. So hätte sich der Autor langsam von den Wundern der Erde über eine Reise durch einen kleinen Ausschnitt des Alls auf eine neue, intellektuelle Ebene begeben können. Den beiden Charakteren hätte der Ich- Erzähler auf der dritten und abschließenden Reise am Mars vorbei begegnen können. Dann wäre die Überraschung nach dem tragischen Ausgang der Ballonreise für den Leser perfekt, der Grundtenor von den Gefahren auf der Erde und dem unbeschwerten Sternenflug ausgewogener gewesen und schließlich auch eine gewisse Kontinuität bewahrt worden.
Im Folgenden listet er als Einleitung seiner folgenden fiktiven Geschichte eine Reihe von angeblich verifizierten übersinnlichen Ereignissen und Begegnungen auf. Dabei unterscheidet er zwischen Erscheinungen aus eigenem Antrieb und solchen die durch die Macht des Willens erzwungen worden sind. Zwar wirkt diese sehr ausführliche Präambel eher entschuldigend als die kommenden Ereignisse einleitend, sie rundet aber eine stimmungsvolle, aber eher phantastische Geschichte stimmig ab. Flammarion kommt zur richtigen Erkenntnis, dass das gestrige Unbekannte die Wahrheit von morgen ist. Allerdings dichtet er nicht zuletzt aufgrund der Augenzeugenberichte dem Mars eine sehr alte, kulturell als auch geistig hoch stehende, pazifistische Zivilisation zu. Eine Maschinenzivilisation, mit einer trägen hochgeistigen Herrenrasse und Tiergattungen, die die niederen Arbeiten verrichten und die Maschinen bedienen. Allerdings entspricht deren Intellekt zumindest dem der kriegerischen und geistig noch nicht reifen Erdenmenschen. Auffällig an dieser abschließenden Novelle ist Flammarions schriftstellerische Unfähigkeit, seine phantasievollen Zukunftsvisionen mit einer entsprechenden packenden und stringenten Handlung zu umgeben. So wirkt die Begegnung mit dem Geist des Freundes wie ein Antihöhepunkt. Wie kurze Zeit später die Marsianer schließt der Autor bei einer älteren Zivilisation gleichzeitig auf Weisheit und eine gewisse Arroganz. Letztere ist notwendig, um den wilden Menschen den Pfad zu den Sternen und damit auch zu neuen Erkenntnissen zu zeigen. So stellt für ihn als Schlüssel zur Überlegenheit astronomische Wissenschaft und vor allem die Verbreitung unter Bevölkerung dieser Thesen dar. Ohne sie kann man nicht richtig denken und hat falsche Vorstellungen vom Leben, von der Schöpfung und dem Schicksal hat. Flammarions vom Marsianer vorgetragene Thesen sind entsprechend einseitig und er vernachlässigt absichtlich die reinen Naturwissenschaften zugunsten seiner in breiteren Schichten eher als Zeitvertreib denn als grundlegende Forschung disqualifizierten Arbeit. Sein Text kumuliert schließlich in einem wissenschaftlichen Testament Speros. Im Gegensatz zu den zehn Geboten insgesamt fünfundzwanzig mehr oder minder interessante Punkte, von denen einige nicht als wissenschaftliche Ideen, sondern als Zusammenfassung von Flammarions farbenprächtigen Text verstanden werden können. Der Ich- Erzähler höchstpersönlich mit gütiger Unterstützung des Autoren fordert am Ende seines kurzweilig zu lesenden, aber höchst umstrittenen Essays eine neue Art der philosophischen Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln und der eigenen Zukunft.
„Urania“ ist trotz einiger Schwächen im Erzählrhythmus und Handlungsaufbau eine interessante Erweiterung der bislang bekannten utopischen Literatur. Nach der bescheidenen Erstauflage zumindest im deutschen Sprachraum in Vergessenheit geraten. Im Gegensatz zu den eher technisch orientierten Romanen verschiedener deutscher und britischer Autoren ist der Franzose Camille Flammarion ein emotionaler Mann, ein Träumer. Technik – bis auf die Linsen und Teleskope zur Sternenbeobachtung – ist ihm eher eine Last. Zusätzlich zu einer Reihe von mathematischen Formeln am Ende der dritten Geschichte findet sich als Ganzes betrachtet eine Zusammenfassung der bekannten astronomischen Erkenntnissen jener Zeit in den Text integriert. Als Vorübung zu seinem literarischen Meisterwerk „Lumen“ lädt „Urania“ leider nur in der besten und ersten Novelle zu einem phantasievollen Gedankenflug ein. Die Liebesgeschichte wirkt phasenweise überzogen. Und „Himmel und Erde“ hat viele gute Ansätze, aber die Umsetzung seiner Fantasien wirkt derart belehrend, dass man schnell das Interesse an diesem Abschnitt verlieren könnte. Wäre da nicht der Zeitunterschied von mehr als einhundert Jahren und ein sanftes Lächeln wegen seiner mutigen, aber inzwischen überholten Thesen.
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/b...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info