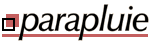
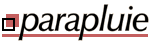 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 21: warschauer pakt
|
In der Obhut des Warschauer PaktsEin Gespräch mit Victor Grossman |
||
von Daniel Sturm |
|
Wer die Memoiren Victor Grossmans liest, wird besser verstehen, weshalb der britische Historiker Eric Hobsbawm das 20. Jahrhundert schlicht das Zeitalter der Extreme nennt. In Crossing the River spricht Grossman, ein amerikanischer Staatsbürger, über seine politisch motivierte Flucht in die Deutsche Demokratische Republik. In Bautzen, Leipzig oder Berlin wollte Grossman die Freiheitsliebe Heinrich Heines mit der Weltoffenheit Pete Seegers paaren --zumindest theoretisch. Und in Crossing the River denkt ein immer noch überzeugter Kommunist, der zu keiner Zeit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands angehörte, offen über die Ursachen des Systemabsturzes von 1989 nach, und geißelt den sich anschließenden Handschlag zwischen Ost und West als schale Geste kühl kalkulierender Geschäftsleute. Kurzum, hier kommt zusammen, was scheinbar nicht zusammengehört. |
||||
Er schien mir ein wenig verloren in seinem roten Schal an jenem Januartag, als wir uns zum Interview in einem Wiener Kaffeehaus am Alexanderplatz trafen. Ich hatte von Victor Grossman zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gehört, wo der 77jährige seit Erscheinen seiner Lebensgeschichte vor zwei Jahren -- Crossing the River -- urplötzlich aus der Vergessenheit gerissen wurde. Staughton Lynd, ein prominenter Bürgerrechtler und Kriegskritiker, hatte mir am Rande einer Konferenz voller Bewunderung von seinem fahnenflüchtigen Schulfreund Stephen Wechsler erzählt, der 1952 durch die Donau in die sowjetisch besetzte Zone schwamm und im 'Warschauer Pakt' landete, wo er nach einem Namenswechsel fortan nahezu 40 Jahre lang unerkannt lebte. Ich knüpfte Kontakt mit Victor Grossman im Januar 2005, während einer Reise durch den Osten Deutschlands. Vor den Arbeitsämtern in Leipzig und Berlin arbeiteten die Wurstbudenbesitzer im Akkord -- und während der Journalist Grossman an einem Text über den "unhaltbaren" Sozialabbau im wiedervereinigten Deutschland bastelte, berichteten die Zeitungen von einigen vereinzelten, aber dünnen Protesten. Draußen in der Kälte vor den Arbeitsämtern dampften die Bratwürste. Nach einem heißen Sommer der Protestkundgebungen gegen 'Hartz IV' war vom kollektiven Trotz nicht mehr viel zu spüren. Wenn man überhaupt von einer bestimmten Stimmungslage sprechen könnte, würde 'kollektive Resignation' sicher am besten passen. |
||||
Nach einer wärmenden Tasse Tee und langer, aber nie langweiliger Diskussion, begann ich mich zu fragen, wie Grossman sein politisches Interesse nach 1989 wach halten konnte, angesichts der oft einseitig und in Siegermentalität geführten Diskussion über das Erbe der DDR. Und: mußte ihm das Deutschland der Schröders, Fischers und Merkels (letztere taufte die New York Times nach Bekanntwerden der vorgezogenen Bundestagswahlen bereits "Deutschlands neue Maggie Thatcher") nicht noch seltsamer vorkommen als jenes kleinere und 'andere' sozialistische Deutschland, in das er 1952 nach seinem Sprung in die Donaufluten entkommen war? |
||||
Wer die Memoiren Victor Grossmans liest, wird vielleicht besser verstehen, weshalb der britische Historiker Eric Hobsbawm das 20. Jahrhundert schlicht das Zeitalter der Extreme nennt. In Crossing the River spricht Grossman, ein amerikanischer Staatsbürger, über seine politisch motivierte Flucht in die Deutsche Demokratische Republik. Hier reflektiert der in einem weltoffenen jüdischen Elternhaus aufgewachsene Pazifist über die Kleinbürgerlichkeit der DDR, in der die Freie Deutsche Jugend jungen Frauen das Tragen von Lippenstift verbot. Hier lernt man über Grossmans mitunter vergebliches Bestreben, in der DDR eine Alternative zum Kapitalismus westlicher Prägung zu erkennen. In Bautzen, Leipzig oder Berlin wollte Grossman die Freiheitsliebe Heinrich Heines mit der Weltoffenheit Pete Seegers paaren -- zumindest theoretisch. Und in Crossing the River denkt ein immer noch überzeugter Kommunist, der zu keiner Zeit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands angehörte, offen über die Ursachen des Systemabsturzes von 1989 nach und geißelt den sich anschließenden Handschlag zwischen Ost und West als schale Geste kühl kalkulierender Geschäftsleute. Kurzum, hier kommt zusammen, was scheinbar nicht zusammengehört. |
||||
Mitten im Kalten Krieg entschied sich Grossman, seiner Zeit noch Stephen Wechsler, zur Flucht vor seinem Heimatland, das gerade Krieg gegen Korea führte und eine neue Runde der Kommunistenhatz im Innern ausrief. 1952 erhielt der in Bayern stationierte Soldat ein Schreiben der obersten Militärjustizbehörde in Washington, das ihm verheimlichte Kontakte zu diversen linken Gruppen in der Heimat unterstellte, verbunden mit der kargen Aufforderung, sich umgehend beim US-Militärgerichtshof in Nürnberg zu melden. Der Brief vermerkte drohend die Möglichkeit einer Geldstrafe in Höhe von 10 000 US-Dollar "und/oder fünf Jahren Gefängnis". Wechsler sah rot. |
||||
Allein die Vorstellung von kommunistischen Schauprozessen und Militärgefängnis war Wechsler, der im antifaschistischen Milieu groß geworden war, Grund genug für einen raschen Wechsel ins andere Lager. Hals über Kopf nahm der GI den nächsten Zug nach Linz, schwamm durch die Donau und hoffte über das in vier Besatzungszonen geteilte Österreich in die Sowjetunion zu entkommen. In die DDR wollte Wechsler ursprünglich auf gar keinen Fall. Das sozialistische Deutschland war in seiner Sicht zwar das bessere Deutschland, eines ohne Nazis, aber trotzdem hatte er nach eigener Aussage von den Deutschen "erst einmal genug". Aber vom sowjetischen Hauptquartier in Baden bei Wien ging es über die Tschechoslowakei dann doch in die DDR. Dort riet ihm ein sowjetischer Offizier zu einem neuen Namen, damit seine Verwandten in den USA nicht gefährdet und seine Spuren besser verwischt würden. |
||||
Stephen Wechsler hätte die panikhafte Flucht in den Warschauer Pakt nicht ergreifen müssen, meint der US-Historiker Mark Solomon im Nachwort von Crossing the River. "Seine Entscheidung zu desertieren erscheint im Nachhinein betrachtet irrational". Solomon glaubt im Blick auf vergleichbare Fälle, daß die Armee Wechsler allenfalls unehrenhaft entlassen hätte. Eine Gefängnisstrafe wäre ihm mit großer Sicherheit erspart geblieben, so Solomon. Im März 1958 habe der US-Bundesgerichtshof sogar ein Urteil eines Landesgerichtes in Washington widerrufen, was zur Rehabilitierung all jener Soldaten führte, die während der McCarthy-Ära als Angehörige 'subversiver' Organisationen unehrenhaft entlassen worden waren. Doch Wechslers Desertieren in den Osten, so Solomon, sei andererseits auch wieder verständlich. Schließlich hätten die McCarthy-Prozesse gegen mutmaßliche Kommunisten und ideologische Sympathisanten eine unberechenbare "Kultur der Angst" zur Folge gehabt, schreibt Solomon. |
||||
In Leipzig absolvierte Victor Grossman ein Studium der Journalistik, was ihn nach eigenen Angaben zum weltweit einzigen Harvard-Absolventen mit einem Diplom der Karl-Marx-Universität machte. Er begann als freier Dozent und Autor für Zeitungen und Hörfunk zu arbeiten. In der Jungen Welt schrieb Grossman über den Vietnamkrieg oder die weltweite Solidaritätsaktion für die in den USA inhaftierte Bürgerrechtlerin Angela Davis, über Nixon und Watergate, oder über die Massendemonstrationen gegen den Vietnam-Krieg und über die Atomkriegspolitik. |
||||
Die Wendezeit verfolgte Grossman mit einer Mischung aus Furcht und Skepsis. Grossman sagt, daß er sich selbst einer klaren Minderheit zurechnete, die eine sozialistische Gesellschaftsordnung, und sei sie auch noch so schlecht, jedweder Form von Kapitalismus vorzöge. Wenige Tage nach dem Mauerfall, als einige Leipziger Montagsdemonstranten "Deutschland Einig Vaterland" zu skandieren beginnen, besuchte er das Leipziger Dokumentarfilmfest. Er sah Michael Moores Film Roger and Me, in dessen Zentrum die Entlassung von 30 000 Fabrikarbeitern und der wirtschaftliche und soziale Ruin von Moores Heimatstadt Flint (Michigan) stehen. Grossman sagt, er habe in dem Film ein Menetekel dessen gesehen, was dem Osten Deutschlands nach einem Systemwechsel noch bevorstand. |
||||
Im Frühling 1989, nachdem Grossman seine Lebensgeschichte im Bulletin der Harvardabsolventen veröffentlicht hatte, wurde er mit Besuchen und Briefen aus den USA überschwemmt. Aber nach dem Mauerfall vergingen weitere fünf Jahre, bevor er ohne Angst vor Strafverfolgung sein Heimatland besuchen konnte. Nach einer dreistündigen Anhörung in New York wurde sein Fall offiziell zu den Akten gelegt. |
||||
In der Nachwendezeit hielt sich Grossman mit Übersetzerjobs über Wasser. Fürs Kabelfernsehen befreite er Clint Eastwoods 30teilige Rawhide-Serie von texanischem Slang, was den eigentlichen Übersetzern die Arbeit immens erleichterte. Den Kampf für eine bessere, sozial-gerechte Welt hat Grossman nie aufgegeben, obwohl er seit 1993 offiziell im Ruhestand ist. Aus Berlin berichtet er unter anderem für den linksgerichteten Newsletter portside.org, in dem er zuletzt die Hartz-Arbeitsmarktreformen und den Krieg der Bush-Administration im Irak scharf angriff. Victor Grossman lebt mit seiner Frau Renate in der Berliner Karl-Marx-Allee. Das Ehepaar hat zwei Söhne, Thomas und Timothy. |
||||
Hier das Gespräch mit Victor Grossman/Stephen Wechsler, das in den Wochen und Monaten nach dem ersten Kontakt in Berlin via E-Mail-Korrespondenz verändert und erweitert wurde. |
||||
parapluie: Herr Grossman, was verbinden Sie mit dem Begriff 'Warschauer Pakt'? |
||||
Victor Grossman: Dieser Pakt hat für mich nicht allzu viel emotionales Gewicht, obwohl ich damals den Zusammenhalt der 'Ost-Länder'-Europas als wichtig für die Verteidigung gegen die NATO (vor allem die USA und die Bundesrepublik) hielt. Ich sah diese Gegend, die nach Sozialismus strebte, als verteidigungswert, auch wenn ich dabei viele Probleme, Dramen und auch Tragödien erkannte und bedauerte. Ich hoffte, sie könnten überwunden werden -- ob in Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen oder in der DDR, und natürlich erst recht in dem stärksten und weitaus einflußreichsten, lange bestimmenden Land. Nachdem ich alle Mitgliedsländer mehrmals besuchen konnte, wurde mir klar, wie unterschiedlich sie waren, trotz allen aus der Situation heraus erwachsenden Ähnlichkeiten. Persönlich sah ich den Pakt, aber vor allem die Stärke der UdSSR, als Schutz für mich gegen eventuelle Strafen in meiner Heimat. |
||||
¶ Dem Historiker Mark Solomon erscheint Ihre Flucht in den Osten im Rückblick einerseits "irrational", denn eine Gefängnisstrafe wäre Ihnen laut Solomon mit großer Sicherheit erspart geblieben. Andererseits hält er Ihr Desertieren für verständlich vor dem Hintergrund einer "Kultur der Angst" in der McCarthy-Ära. Was halten Sie von dieser Einschätzung? |
||||
Im Nachhinein, durch Gespräche mit Freunden -- auch mit Mark Solomon -- habe ich erfahren, daß ich wahrscheinlich nicht ins Militärgefängnis gekommen wäre. Doch auf mein 'Verbrechen' -- das ängstliche Unterschlagen meiner Mitgliedschaft in mehreren linken und kommunistischen Organisationen beim geforderten Eid, als ich 1951 in die US Army eingezogen wurde (das war während des Koreakriegs) -- stand ausdrücklich "bis zu 10 000 Dollar und fünf Jahre Gefängnisstrafe". Es gab zu diesem Zeitpunkt, soweit ich wußte, gar keine Erfahrungen in dieser Frage. Ich dachte, wenn ich ins Gefängnis komme gibt es keine Möglichkeit einer Verteidigung. Ich hatte eben Fakten verheimlicht. Ins Gefängnis wollte ich keinesfalls. Also schwamm ich bei Linz durch die Donau, von der damaligen US-Zone in Österreich in die sowjetische Zone, wurde eine kurze Zeit festgehalten, dann in die DDR gebracht und bald freigelassen. Es ist gut möglich, daß ich zu viel fürchtete, doch auch meine Entlassungspapiere hätten damals die meisten Arbeitsstellen in den USA unmöglich gemacht, wie ich ebenfalls von Freunden erfahren habe. Übrigens wurde dieser "Treueeid" Jahre später verfassungswidrig und abgeschafft. |
||||
¶ Wie fanden Sie sich in diesem anderen Teil Deutschlands zurecht nach Ihrer Landung in Bautzen? |
||||
Für zwei Jahre lebte ich in der uralten Stadt Bautzen (ohne irgendeinen Bezug zum dortigen Zuchthaus). Meine Arbeit während der ersten sechs Monate war hart; das Tragen von Holzbohlen in einer Waggonbaufabrik. Später lernte ich mit den anderen Ausländern -- dort waren fast alle Deserteure aus westlichen Armeen -- einen Beruf. In meinem Fall Dreher. Das Wohnen war auch nicht luxuriös: In meinem Untermietenzimmer gab es kein fließendes Wasser. Trockenklo eine halbe Treppe tiefer, keine Zentralheizung, und ich lernte nie, den Ofen ordentlich zu heizen. Doch war das Leben in diesem neuen, und in mancher Hinsicht sehr jungen Land -- die DDR war erst zwei Jahre alt als ich ankam -- äußerst konfliktreich, kompliziert, ja, widersprüchlich. Ich war doch in eine Art Revolution hineingeraten. Das war nicht immer angenehm, aber meist interessant. Dazu gab es für eine mittlere Stadt recht viele Konzerte, Theatermöglichkeiten und gute Bücher. Und vor allem traf ich recht bald meine spätere Frau -- also Langeweile spürte ich niemals. |
||||
¶ Fühlten Sie sich als Ausländer oder Amerikaner in der DDR isoliert? |
||||
Nein, als Ausländer fühlte ich mich nie isoliert. In den ersten zwei Jahren in Bautzen war ich ständig unter Ausländern, das heißt 'westlichen' Armeedeserteuren. Aber nachdem ich von Bautzen wegzog, wurde meine Position als Amerikaner ganz anders. Viele waren wir nicht in der DDR, und mein Hiersein verursachte oft Neugierde, wenn nicht Staunen. Doch gerade als Amerikaner -- und mein starker Akzent machte mich fast unmittelbar erkennbar -- war das Resultat eigenartig. Für jene DDR-Bürger, die sich ständig nach westlichen Idealen richteten, war ich eben als Amerikaner ein Gegenstand der Bewunderung. Und sie freuten sich oft, ihre Kenntnisse von amerikanischen Sprachbrocken oder von neuen und alten USA-Schlagern vorzutragen, in der Hoffnung auf Beifall, was für mich nicht immer leicht und ehrlich abzuliefern war. Egal, sie waren immer freundlich. Diejenigen indes, die gegen die Weltrolle der USA waren (und meist gegen die westliche Politik überhaupt), nahmen an, daß ich ebenfalls ein Linker war. Als ich das bestätigen konnte, waren auch sie sehr freundlich. Also wurde ich fast ohne Ausnahme sehr freundlich aufgenommen. Ich fühlte mich nach den ersten zwei Jahren nie isoliert, zumal ich mich in Berlin mit mehreren Leuten anfreundete, die aus englischsprachigen Ländern kamen, oder dort als Flüchtlinge die Nazijahre überlebt hatten. |
||||
¶ Wenige Jahre vor Ihrer Flucht (1947) hatten Sie an einem internationalen linken Jugendfestival in Prag teilgenommen. Vor dem Hintergrund Ihrer multikulturellen Jugend in New York und Ihrer internationalen Ausrichtung, kam Ihnen da die DDR der 1950er Jahre nicht verhältnismäßig grau vor? |
||||
Grau ist nicht das richtige Wort. Ich hatte in den USA zuletzt in der Stadt Buffalo gelebt, die nicht besonders farbenreich war, besonders nicht mein Arbeitsleben als ungelernter, recht einsamer Arbeiter. Gewiß, Bautzen kam mir als New Yorker nach und nach zu klein vor, trotz meiner wachsenden Liebesgeschichte. Als Sonderlehrling hatte ich jeden Tag mit den anderen Deserteuren zu tun. Manche waren sehr interessant. Es gab Marokkaner, Holländer, einen Mexikaner und einen Nigerianer, neben der überwiegenden Zahl Amerikaner, Briten und Franzosen. Doch gerade diese Leute, die meist nicht politisch motiviert waren, sondern wegen verschiedener Delikte oder wegen Alkoholproblemen desertiert waren, machten das Leben nicht immer so angenehm. Ich habe sogar einige Narben im Gesicht, die mich an diese Zeit erinnern. |
||||
Also freute ich mich sehr, zum Studium an der Journalistik-Fakultät in der Großstadt Leipzig zu kommen, wo ich neben mehr Theater-, Konzert- und Filmmöglichkeiten eine Gruppe sehr interessanter ausländischer Studenten aus Ost, West und Süd kennenlernte -- die ersten in der DDR. Dazu kam der tägliche Kontakt (und im ersten Studienjahr bis zu meiner Heirat das Leben im Internat) mit einer recht interessanten Gruppe von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft, also meinen Kommilitonen sowie den Dozenten, wovon mehrere jahrelang aktiv im Kampf gegen die Nazis standen (wie der Dekan und der Pro-Dekan). Probleme gab es im Lande jede Menge. Aber grau, nein, das ist nicht das passende Wort. |
||||
¶ Nahmen Sie an Parteisitzungen teil? |
||||
In den ersten zwei Jahren wollte ich in die SED eintreten, doch hieß es, man müsse DDR-Bürger sein. Ich wies auf die vielen Griechen hin, die in der Partei waren -- Flüchtlinge aus dem niedergeschlagenen Aufstand der griechischen Partisanen nach dem zweiten Weltkrieg. Das sei eine Ausnahmegruppe, sagte man mir, mit einer besonderen Sektion für sich innerhalb der Partei. |
||||
Als ich 1954 Student an der Universität in Leipzig wurde, lud man mich gleich als amerikanischen Kommunisten zu allen Parteisitzungen ein, sowohl auf Fakultätsebene wie in den kleinen Seminargruppen. Später, nach den dramatischen Ereignissen in Ungarn 1956, kann es sein, daß ich nur noch zu den kleineren Gruppensitzungen der Partei eingeladen wurde. Die offenen Parteiversammlungen durfte natürlich jeder besuchen. Ich weiß nicht mehr genau, vielleicht lud man mich wegen der spannenden Situation nicht immer ein, vielleicht weil langsam bekannt wurde, daß ich oft offen meine nicht immer ganz orthodoxe Meinung sagte. Doch im letzten Studienjahr bewarb ich mich nochmals um die Mitgliedschaft, reichte eine Bewerbung ein und fand zwei Bürgen. Am Ende jedoch, bei einer Diskussion mit der Parteigruppe in meiner Seminargruppe, kam es zu einigen Differenzen, vor allem in der Frage der Eigenverantwortung bei der Meinungsbildung, und wir kamen ganz freundlich überein, daß ich am besten meine Bewerbung zurückziehen und, vielleicht einmal nach dem Studium, mich von Neuem bewerben könnte. Jahre später, bei einer Arbeitsstelle an der Akademie der Künste lud mich auch jemand ein, der Partei beizutreten, doch ich sagte nicht zu und blieb ein Parteiloser. Manchmal fühlte ich mich deshalb etwas schuldig, doch wiederum ersparte ich mir bestimmt manche Auseinandersetzungen. Und Probleme. Nach 1980, im Schriftstellerverband, wurde ich wieder eingeladen, als Gast an SED-Sitzungen teilzunehmen. |
||||
¶ Im Blick auf den wachsenden Rechtsradikalismus in Ost- und Westdeutschland in der Nachwendezeit interessiert mich, wie Ausländer in der DDR behandelt wurden. Ich vermute, daß Sie als Amerikaner in die Kategorie der 'besseren Ausländer' fielen? |
||||
Wie schon gesagt, die Tatsache, daß ein US-Amerikaner in der DDR gelandet und geblieben war, erweckte oft Überraschung bis Erstaunen, zum Teil wegen der Minderwertigkeitsgefühle etlicher DDR-Bewohner bzw. ihrer Träume von einem goldenen Land im Westen. Doch waren fast alle Menschen freundlich. |
||||
Daß ich besonders gut (oder schlecht) behandelt wurde, habe ich niemals wahrgenommen. In Bautzen bekamen wir alle die gleiche Behandlung, die Amerikaner wie die Marokkaner. Die DDR-Propaganda und Schulbildung betonten immer 'Internationalismus'. Aber da die politischen Worte der Lehrkräfte oft nicht ankamen, lehnte ein Teil der Schüler nicht nur die Worte über den Sozialismus ab, sondern auch die Worte über die 'internationale Freundschaft'. Auch die Ankunft immer größerer Gruppen arbeitender Menschen aus dem Ausland, zunächst Algerier, später Mosambikaner, Kubaner, am meisten aber Vietnamesen, verursachte Probleme. Sie wurden so gut wie möglich behandelt, was Behausung, Berufsausbildung und gleiche Löhne betraf. Doch entstanden naturgemäß Probleme mit Menschen aus anderen Kulturkreisen, und die DDR-Behörden lernten allzu selten, wie sie diese am besten lösen sollten. Bei den Algeriern z.B., die nur junge Männer waren, entstanden Probleme bezüglich der Frauen, bei den Vietnamesen nicht (denn es kamen Frauen wie Männer), doch waren sie in ihren Neubau-Wohnungsblöcken häufig isoliert. Hinzu kam, daß die Bevölkerung der DDR, anders als Engländer, Franzosen, Holländer oder auch Westdeutsche, relativ wenig Erfahrung mit fremdsprachigen, manchmal andersfarbigen Gruppen besaß. Hinzu kamen rassistische Einflüsse aus West-Berlin und per TV aus Westdeutschland. Leider kehrte die Führung sämtliche Probleme dieser Art unter den Teppich. Es durfte sie 'bei uns' nicht geben, also gab es sie nicht, und man redete nicht davon, jedenfalls nicht öffentlich. Das war der schlimme Fehler. |
||||
¶ Wie beurteilten Sie selbst und Ihre Bekannten in der DDR die Meldungen über den stalinistischen Terror, die nach Chruschtschows Parteitagsbericht von 1956 publik wurden? |
||||
Sie bedeuteten für die meisten DDR-Bewohner einen Schock, zumal da viele meiner Mitstudenten mit dem Stalin-Kult groß geworden waren. Für mich war der Schock nicht ganz so groß, denn ich hatte seit der Kindheit über Stalins Verbrechen zu hören bekommen und war immer zwischen dem Abtun der Partei und der immer größer werdenden Überzeugung zerrissen, daß vieles doch zuträfe. Wenn auch nicht in der Masse, dann doch in einigen Details. Doch meine Betroffenheit vermengte sich mit dem Gefühl: "So war es, endlich erfahren wir die Wahrheit. Nun wird es anders werden, und diese fürchterliche Deformierung kann ausgemerzt und verbessert werden." Also spielte auch Hoffnung eine große Rolle für mich. Für andere in den USA, wie ich durch die USA-Parteipresse erfuhr (und viel später durch Begegnungen mit früheren Genossen), hat es haufenweise zu einem Bruch mit der Partei und manchmal mit der linken Bewegung und vielleicht der ganzen Politik überhaupt geführt. Das war für mich verständlich, aber das war nicht meine Schlußfolgerung. Ich sagte: "Kommunist bin ich nicht wegen Stalin (oder Ulbricht und Honecker) geworden, sondern weil ich glaubte, es gibt zu viel Elend auf der Welt, sie muß sich dringend ändern." |
||||
¶ In den 1960ern lebten Sie in der DDR, als in Ihrem Heimatland die Bürgerrechtsbewegung zu brodeln begann. Hat es Sie nicht gewurmt, daß sie da nicht mittun konnten? |
||||
Gewurmt ist das falsche Wort. Ich hatte ja mein Schicksal selbst bestimmt. Besonders in den ersten Jahren, als der McCarthy-Geist noch herrschte und sehr viele meiner Landsleute darunter litten, spürte ich eine Art Schuldgefühl, daß es mir relativ gut ging, und mir das alles erspart wurde. Dann, als die Anti-Atombomben-Bewegung, die Bürgerrechtsbewegung und später die Antivietnamkriegsproteste das Bild in den USA stark veränderten, verspürte ich tatsächlich einen gewissen Neid. Die harten Kämpfe dort waren gewiß interessanter als die Solidaritätsaktionen in der DDR, die ja ohne Konfrontationen stattfanden. Trotzdem wurde ich aktiv in den Kämpfen zur Unterstützung der 'Wilmington-Zehn' (neun Afroamerikaner und eine Weiße, die wegen Widerstand gegen den Ku-Klux-Klan in den USA eingesperrt wurden), sowie später im Kampf um die Befreiung von der gegen Mordanklage kämpfenden Angela Davis in Kalifornien, aber auch für Vietnam, die Kämpfe in Südafrika (ANC, SWAPO, usw.) und in Lateinamerika. Ich schrieb und redete sehr viel darüber, sammelte Unterschriften und Geld, und habe mein Gewissen auf diese Art ein wenig beruhigt. |
||||
¶ Wie haben Sie auf die Ereignisse der Wendezeit reagiert? |
||||
In den letzten Jahren der DDR, etwa seit 1986, war deutlich zu erkennen, daß sich der lange, oft hügelige, doch meist spürbar aufwärtsbewegende Weg sehr verlangsamte oder zu Ende war. Die Situation verschlimmerte sich. Gerade viele DDR-Bürger aus der schwankenden Mehrheit schauten immer sehnsuchtsvoller nach dem Westen, und in den letzten paar Jahren hatten auch die treuesten DDR-Anhänger Schwierigkeiten, den Abwärtstrend zu leugnen oder zu rechtfertigen. Wie etliche andere hoffte auch ich trotzdem auf eine Besserung. Zum Teil dachten wir, daß ein Wechsel der Parteispitze, in der viele gealtert waren, eine Änderung herbeiführen konnte. Bei der großen Demonstration am Alexanderplatz am 4. November 1989, bei der Maueröffnung am 9.11. und bei der massenhaften Begrüßung Helmut Kohls in Dresden im Dezember schien es immer unwahrscheinlicher, daß eine bessere, freiere DDR zu retten war. Nach den Wahlen im März 1990 war es 'aus'. Ich war sehr, sehr traurig. Seit Jahren hatte ich sehr intensiv die Ereignisse in der Bundesrepublik verfolgt und wußte, daß die mächtigsten Kräfte dort, die Hitler mit zur Macht verholfen hatten, wenn auch 1989 nicht mehr dieselben Personen, so doch häufig die selben Firmen und Banken waren: Thyssen, Krupp, Flick, Siemens, Bayer, BASF, Allianz, Deutsche Bank. Diese Unternehmen hatten Hitler aufgebaut, die Eroberung ganz Europas angestrebt und erreicht, Milliarden durch mörderischste Sklavenarbeit für den Krieg eingenommen, und sehnten sich nun weiterhin, gewiß mit anderen Losungen und Methoden, nach einer Ausweitung ihrer Kontrolle -- erst in Ostdeutschland, dann Osteuropa, dann in Afrika, Asien und in der ganzen Welt. Ich war also verbittert, und als sich meine Befürchtungen bewahrheiteten, blieb ich rebellisch und oppositionell. |
||||
¶ In der Umbruchsphase von 1989 schien eine reformierte DDR, ein reformierter Sozialismus für kurze Zeit möglich. Warum ist es nicht dazu gekommen? |
||||
Die Führung der DDR, besonders der SED, hatten besonders in den letzten Jahren sehr viel Autorität, ja Glaubwürdigkeit verloren und die möglichen demokratischen Nachfolger, die die DDR retten wollten, bekamen so gut wie keine Zeit, Autorität zu gewinnen, zumal sie auch wenige waren, und meist unerfahren. Zweitens wurde der Angriff seitens der Bundesrepublik, der ja seit Jahren angedauert hatte, in den Monaten zwischen Oktober 1989 und März 1990 derart massiv, gut finanziert, raffiniert geplant, daß es fast unmöglich wurde, entgegenzuwirken. Sie versprachen die als 'heilig' angesehene Westmark, die Bananen, den Volkswagen, die Weltreisen, so viele glitzernde Symbole der Freiheit und des Westens, und die Mehrheit der Ossis glaubte alles. Sie kauften lieber teure, wochenalte Eier aus dem Westen als frische, billigere Eier aus dem Osten. Die Offensive der Westpolitiker, von Helmut Kohl bis Willy Brandt, war sehr verlockend für die meisten. Natürlich sprach auch das Nationalgefühl der Menschen als 'Deutsche' sehr stark mit: "Wir sind ein Volk" ersetzte schnell "Wir sind das Volk". Hinzu kam, daß etliche (nicht alle) sogenannte Bürgerrechtler, die immer wegen Demokratie, Bürgerrechten, Friedenspolitik oder Umweltschutz gegen die DDR opponiert hatten, recht schnell nach Posten in der vereinigten Republik griffen, und manche frühere Ideale schnell vergaßen, wenn sie nur gute Positionen bekamen, ganz gleich, ob in der SPD oder in der CDU. Die DDR wurde außerdem durch die Sowjetunion unter Gorbatschow völlig aufgegeben. Um Anleihen aus den USA und der Bundesrepublik zu bekommen, war er bereit, die DDR (und andere Länder) völlig abzuschreiben. Und hinter den Kulissen agierten einige Zaubermeister wie der USA-Botschafter Vernon Walters, der seit Jahrzehnten hinter etlichen Umstürzen in Lateinamerika und anderswo, auch in Polen und sogar auf den Fidschi-Inseln gewirkt hatte, und der vom US-Präsidenten Bush (Senior) eingesetzt wurde, um die Sache zu 'erledigen'. |
||||
Schließlich konnte die DDR kaum weiterbestehen, wenn Polen und die Tschechoslowakei (und dann die UdSSR) kapitalistisch wurden. |
||||
¶ Mehr als die Hälfte aller Ostdeutschen wurde in den Nachwendejahren mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. War das nicht abzusehen? Überspitzt formuliert: Warum tauschten so viele die sozialen Errungenschaften der DDR, das Recht auf Arbeit, die garantierte Ganztagesbetreuung von Kindern und so weiter, gegen die D-Mark ein? |
||||
Fast keiner in der DDR außer den Alten, welche die große Krise noch in Erinnerung hatten, machten sich vor der Wende wegen Arbeitslosigkeit Sorgen. Als ich in Vorträgen davor warnte, sah ich in den Augen sehr vieler Zuhörer Unglauben. Was war denn Arbeitslosigkeit? Höchstens eine kurze Unannehmlichkeit, während der man mehr Geld bekam als manche DDR-Arbeiter Lohn verdienten. Ich sah, wie die Menschen einfach nicht daran glauben wollten: Sie wollten sich ihre Träume vom goldenen Westen partout nicht zerstören lassen. Mit einem Westpaß und der Westmark reisen -- was könnte schöner sein? Vielleicht hinter dem Lenkrad eines BMW, wenn man tüchtig war (und wer ist in eigenen Augen nicht tüchtig)? Waren, Waren, Waren, wie im Westen, und dabei Freiheit und Wiedervereinigung mit den Brüdern und Schwestern in Köln und München! |
||||
Mit der Vernichtung der DDR-Industrie wurden binnen ein bis zwei Jahren viele Träume zerstört, wenn auch manche weiterträumen und hoffnungsvoll auf Glück hoffen und vielleicht Lotto spielen. Heute droht die Vernichtung der Träume viel schneller zu werden, was Arbeitslosengeld, ärztliche Versicherung, Renten, Studiengebühren und Arbeitszeiten und -bedingungen betrifft. Schließlich brauchen die Unternehmer keine Rücksicht mehr auf die Bedingungen im 'anderen Deutschland' zu nehmen. |
||||
¶ Eric Hobsbawm spricht mit Blick auf Stalin und McCarthy vom "Zeitalter der Extreme". Wie sehen Sie Ihre eigene Lebensgeschichte in diesem Kontext? Wäre 'extrem' das passende Wort? |
||||
Ich habe großes Glück in meinem persönlichem Leben gehabt. Erstens war ich gerade einige Monate zu jung, um als Soldat im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Zweitens wurde ich zwar auch betroffen vom Mief und den Ängsten der McCarthy-Ära -- oder wenigstens der ersten Jahre davon. Als ich dann 1952 in die DDR kam, mußte ich mich zwar an ein anderes Leben in einer anderen Kultur gewöhnen, aber mir wurde die Tragik dieser Zeit in den USA erspart, die viele meiner linken Freunde und Genossen hart traf. Es waren also in der Tat Jahre der 'Extreme', markiert durch einen Jahrhundertkampf zwischen den Kräften des Sozialismus -- leider eines recht deformierten, aber doch eines Sozialismus -- und den Kräften des Kapitalismus, zum Teil auch in ihrer Extremform, dem Faschismus, zum Teil in der traditionelleren Form. Aber persönlich, wenn ich von meiner panikartigen Flucht 'in den Osten' im Sommer 1952 absehe, die fürchterlich war, doch nur kurze Zeit dauerte, brauchte ich kaum zu leiden. |
||||
¶ Was ist politisch von der DDR geblieben? |
||||
Im Grunde so gut wie gar nichts, wenn man von den kleinen Gruppen der PDS absieht, der Partei des demokratischen Sozialismus, dem Nachfolger der SED, mit nur einem kleinen Bruchteil der alten Mitgliedschaft und ganz anderer Ausrichtung. Zur Zeit hat sie nur zwei Abgeordnete im Bundestag, die ganz am Rande sitzen und nicht mal richtige Schreibtische bekommen haben. Das kann sich vielleicht bei der nächsten Wahl ändern. Doch die Medien werden alles tun, um eine solche Änderung zu verhindern. Dazu kämen -- auch sehr verändert -- die paar Zeitungen und Zeitschriften, die nicht von westdeutschen Verlagen übernommen wurden, wie Neues Deutschland und die Junge Welt. Alles andere, zum Beispiel die ganze Rundfunk-, Fernseh- und Druckpresselandschaft, wurde binnen weniger Monaten aufgelöst oder übernommen. Entlassen wurden sowohl jene früheren Redakteure, die man als "stur" bezeichnete, als auch jene, die dabei waren, ein offenes, kritisches und volksnahes Medienbild zu schaffen. Ansonsten ist die ganze Politik durch 'Einwanderer' aus den westlichen Landesteilen übernommen worden, oder von einer Schicht Ossis, die meist ihre eigene Vergangenheit leugneten und sich als mutige 'Widerstandskämpfer' entdeckten. |
||||
¶ Wie wird man die DDR in Erinnerung behalten? |
||||
Das ist von einer Person zur anderen vollkommen verschieden. Der eine wird überwiegend an Gutes denken, der andere an Schlechtes, meist abhängig davon, wie es ihm in der DDR ging, oder bei den Jüngeren, wie es den Eltern und Bekannten erging. Hinzu kommt ein nie aufhörendes Bemühen fast sämtlicher Medien, manchmal sehr subtil, oft äußerst plump, bis auf ein paar Nebensächlichkeiten alles in der DDR schlecht zu malen. Es ist klar: Jene, die in Opposition gingen oder versuchten, aus der DDR zu flüchten und dafür litten, werden hauptsächlich Schlechtes denken. Kaum jemand vermißt die ständige, langweilige und meist ungeschickte politische Berieselung von damals. Auch nicht manche hartherzige Bürokratie, manche dumme Entscheidung, den Mangel in der Warenversorgung, von Bananen bis zu modernen Wagen oder Überseereisen. Für manche sind diese Fragen noch maßgeblich in ihrem Urteil über die DDR. |
||||
Andere, auch solche, die die DDR keinesfalls zurückhaben möchten wie sie war, vermissen trotzdem (und wohl zunehmend) die kostenlose Unterbringung der Kinder am Tage, die komplette medizinische Versorgung, das freie Studium mit Grundstipendium für alle Studenten, die äußerst billigen Nahrungsmittel, Verkehrsmittel und Kulturgüter, von Büchern und Platten bis zu Theater, Kino und Oper, die Jugendzentren und vor allem das Gefühl der Sicherheit, daß man den Arbeitsplatz nicht verlieren würde, und daß es fast immer andere Arbeit gab, wenn man wechseln wollte. |
||||
¶ Wenn Sie heute nochmals sechzehn wären, würden Sie sich erneut für den Kommunismus engagieren? |
||||
Der Begriff 'Kommunismus' bedeutet für jeden etwas anderes. Für mich bedeutet er den Kampf für eine Welt, in der Kinder nicht hungern, in der Urangeschosse die Luft nicht verpesten, in der Bauernhochzeiten ohne Bomben gefeiert werden, in der alte hoffnungslose Männer und einige Jugendliche nicht obdachlos auf der Straße schlafen, und in der Frauen aus ärmeren Ländern sich nicht an gut angezogene Autofahrer oder Bordellbesucher verkaufen müssen. Eine Welt, in der die Kluft zwischen arm und reich nicht ständig wächst und in der Krankheiten nicht deshalb weiter grassieren, weil Pharma-Firmen Geld einschaufeln wollen. Der Begriff schließt auch den Traum ein, daß, wenn genügend Menschen darum kämpfen, eine solche Welt nicht leicht, aber doch möglich sei. Meine Gene sind anscheinend so geordnet, daß, solange es Leiden in der Welt gibt, auch große Gefahren für die Umwelt und die künftigen Bewohner der Erde, ich versuchen muß, an Gegenaktionen teilzunehmen. Auch wenn ich wieder sechzehn wäre, vermute ich, daß ich mich wieder dieser schwierigen Genkonstellation beugen müßte, und ungefähr so wieder in die Richtung laufen würde, wie ich es einmal getan habe. |
||||
¶ Ein Wort zur aktuellen deutschen Politik. Der Vorsitzende der regierenden SPD, Franz Müntefering, betrieb im Frühjahr selbst vollmundig Kapitalismusschelte. Alles nur Rhetorik? Oder sehen Sie in der vorgezogenen Bundestagswahl gar eine Chance für eine neue linke Koalition, die eine Alternative zum derzeitigen Kapitalismus konzipiert? |
||||
In den Worten von Franz Müntefering, die er schnell qualifizierte und die auch seine Parteigenossen einschränkten, ist nur Wahlkampf-Rhetorik reflektiert worden. Denn sonst hätte er seit Jahren für eine ganz andere Politik gekämpft. Was eine neue politische Koalition betrifft, bestehend hauptsächlich aus der PDS im Osten und der WASG, kämpferischen Gewerkschaftsmitgliedern, Gegnern der Globalisierung von Attac, und vielen anderen mehr, so sehe ich darin im Moment eine große Chance, endlich eine echte Opposition in ganz Deutschland zu schaffen. Doch sehe ich auch die große Gefahr, daß so etwas nicht zustande kommt, aus politischen aber auch persönlichen Gründen, und ich erwarte auch viel 'Flak' und Sabotage von etlichen Seiten (und verlogene Rhetorik ebenfalls). Im Moment ist noch nichts entschieden. Wenn Sie diese Zeilen lesen, könnte es schon zu spät sein, wenigstens für diesen ersten, doch sehr wichtigen Versuch. Ich hoffe das Beste, denn alle anderen Parteien (im Bundestag) haben in etwa die gleichen miesen Ziele, gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung -- nicht nur in Deutschland. |
||||
|
autoreninfo

Daniel Sturm, Journalist und Autor, half nach seinem Umzug von Leipzig in die USA 2002 als Chefreporter beim Aufbau der alternativen Wochenzeitung City Pulse in Lansing, der Landeshauptstadt Michigans. Daniel studierte Germanistik und Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Tübingen und arbeitet als Chefreporter für die Stadtillustrierte Kreuzer in Leipzig. Er war Redakteur des Internationalen Forschungsberichts Medien Tenor in Bonn und Leipzig und schrieb frei für Tageszeitungen, u.a. Die Welt. Daniel unterrichtet Journalismus an der Youngstown State University im Nordosten Ohios und schreibt frei für Verlage in Amerika und Deutschland.
Veröffentlichungen:
Stadiongeschichten. Leipzig zwischen Turnfest, Traumarena und Olympia. Leipzig: Forum-Verlag 2002 (Mit Cornelia Jeske und Grit Hartmann).
Homepage: http://www.sturmstories.com E-Mail: sturm@sturmstories.com |
||||
|
|