|
rezensiert von Thomas Harbach
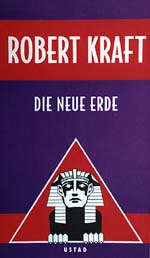 „Die neue Erde“ ist einer der ersten Romane, in denen sich ein Autor fiktiv mit dem Überleben des Menschengeschlechtes nach einem Kometenabsturz auf die Erde beschäftigt. Schon im 19. Jahrhundert erschienen Geschichten aus Mary Shellys Feder „the Last Man“ oder es fanden sich Anklänge im Werk Edgar Allan Poes oder Richard Jeffries „After London“, sowie dem komödiantischen „Jagd auf den Meteor“ von Jules Verne. Diese behandeln mehr die unmittelbaren Folgen des Absturzes und Einschlages, während Robert Kraft an zwei Orten der Erde den Grundstein für ein neues Menschengeschlecht setzt. Dabei geht es ihm weniger um die aktuellen Folgen, sondern die gesellschaftspolitischen Veränderungen über Generationen hinweg. Die beiden ersten Teile des Romans umfassen einmal zweihundert Seiten und dann knappe einhundert Seiten, umfassen thematisch allerdings mehrere Generationen im Spiegel einiger weniger ausgesuchter Protagonisten. Diese Konzentration auf wenige Überlebende unterscheidet Krafts kompakte und eindringliche Vision von vielen anderen Weltuntergangsszenarien, die das Format zu umfangreich und damit auch zu oberflächlich angelegt haben.
„Die neue Erde“ ist einer der ersten Romane, in denen sich ein Autor fiktiv mit dem Überleben des Menschengeschlechtes nach einem Kometenabsturz auf die Erde beschäftigt. Schon im 19. Jahrhundert erschienen Geschichten aus Mary Shellys Feder „the Last Man“ oder es fanden sich Anklänge im Werk Edgar Allan Poes oder Richard Jeffries „After London“, sowie dem komödiantischen „Jagd auf den Meteor“ von Jules Verne. Diese behandeln mehr die unmittelbaren Folgen des Absturzes und Einschlages, während Robert Kraft an zwei Orten der Erde den Grundstein für ein neues Menschengeschlecht setzt. Dabei geht es ihm weniger um die aktuellen Folgen, sondern die gesellschaftspolitischen Veränderungen über Generationen hinweg. Die beiden ersten Teile des Romans umfassen einmal zweihundert Seiten und dann knappe einhundert Seiten, umfassen thematisch allerdings mehrere Generationen im Spiegel einiger weniger ausgesuchter Protagonisten. Diese Konzentration auf wenige Überlebende unterscheidet Krafts kompakte und eindringliche Vision von vielen anderen Weltuntergangsszenarien, die das Format zu umfangreich und damit auch zu oberflächlich angelegt haben.
Der Einschlag des Kometen – von einem französischen Astronomen vorhergesagt – bewirkt eine Drehung der Erdachse um genau 90 %. Der Kohlensäuresturm unmittelbar nach dem Einschlag tötet augenblicklich einen Großteil der Menschheit, der Rest geht zusammen mit vielen Arten der Fauna und Flora in dem anschließenden dramatischen Klimawandel zu Grunde. An zwei Orten der Erde entsteht neues Leben, beide Male unter der Führung der Deutschen. In Asien bildet sich eine von Europäern geführte feudale Gesellschaft, die sich in drei Kasten gliedert – Priester als legislative, die Ritter als exekutive und die ausländischen Arbeiter als klassische Dienerkaste – während in den Ruinen des jetzt tropischen Leipzig eine kleine Gruppe von Menschen zum Nomadentum umschwenkt und in dieser neuen Klimazone ums Überleben kämpft.
Humoristisch verwandte Jules Verne in seinem Roman „Kein Durcheinander“ ein ähnliches Szenario. Hier wollte der berühmte Kanonenclub in Baltimore die Erdachse verschieben, um die frisch erworbenen Gebiete in der Antarktis auszubeuten zu können. Im Gegensatz zu Robert Krafts Katastrophenroman spielte Verne durch seine Figuren die klimatechnischen Komponenten seines Romans bewusst herunter und karikierte die arroganten, selbstverliebten Mitglieder des Kanonenclubs mit spitzer Feder. Am Ende des Buches gab er sie der Lächerlichkeit Preis.
Vor Robert Krafts Tod im Jahre 1916 schrieb dieser noch einige Notizen für die Folgebände nieder. Diese zeigen ein sehr breites Spektrum des Niedergangs und der Wiederauferstehung der menschlichen Kultur und kommt Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“ zuvor. Amazonen, Hunnen, der Konflikt zwischen den Herrschern und Dienern bilden einen farbenprächtigen Vordergrund für eine interessante Chronik.
Geht der Leser einen Schritt zurück, wird ihm zuerst die neue Herrschaft unter der Führung der Deutschen auffallen. Robert Kraft macht allerdings nicht den Fehler, direkt auf das kaiserliche Reiche zurückzugreifen, sein deutscher Held Hermann Claudius lehnt sich eher an die Ideale der Ritterzeit mit ihren Gewaltenteilungen an und der elementaren Aufgabe, eine Grundlage für die kommenden Generationen zu schaffen und andere Völker – oder besser deren Reste - mit entschlossenem aktiven Beispiel zu führen und nicht zu unterdrücken.
Interessant sind die in dieser Perspektive auf den ersten oberflächlichen Blick rassistischen Übermenschenideale, die insbesondere der nach Asien verschlagene deutsche Claudius propagiert. Diese relativieren sich ein bisschen, wenn der Leser objektiv die Mentalitätsunterschiede zwischen einigen Asiaten und Europäern sich vor Augen hält. „Allah wird es schon richten“ ist oft eine Entschuldigung für die eigene Untätigkeit und den fehlenden Impuls, aktiv sein eigenes Schicksal zu gestalten anstatt demütig auf Gaben zu warten. Kraft überspannt in seiner Vision den Bogen an einigen Stellen und macht den Fehler, die beiden Kulturen nicht aus grundlegenden Überlegungen, sondern rassistischen Anklängen zu trennen. Dabei erwähnt er mehrmals, dass diese beiden Kulturen anders sind und anders handeln, aber nicht grundsätzlich in eine bessere – weiße – und eine schlechtere – farbige – Kultur aufgespaltet werden können. Da Robert Kraft auch andere Romane geschrieben hat und er insbesondere in seiner zweiten Handlungsebene in Leipzig und in dem vorhandenen Fragment, in dem er eine englischen Traditionen basierende Amazonenherrschaft beschrieben hat, weitere soziologische Strömungen beschrieben hat, könnte es auch ein literarischer und nicht rassistischer Kniff sein, seine Figuren auf dieser einen Ebene zu agieren zu lassen. Schnell gibt er insbesondere den jungen Indern viele Fähigkeiten, die die vier deutschen Überlebenden nicht haben und nur aus dem Zusammenspiel dieser beiden Gruppen kann eine neue lebensfähige Kultur und vielleicht später Zivilisation entstehen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen einige seiner Thesen in einem milderen Licht.
Interessant ist der statische Aufbau der ersten beiden Teile dieses Buches. Im ersten Teil werden die Folgen des Einschlages, aber nie die Katastrophe selbst beschrieben, im zweiten Teil folgt der Neuaufbau einer jeweils unterschiedlichen Kultur. Im Grunde ähneln sich die Strukturen, es gibt Menschen, die dank ihrer Bildung auf das seit Generationen fast vergessene Wissen der Vorfahren zurückgreifen können und deswegen überleben und die Menschen, die sich den neuen Verhältnissen nicht anpassen können. Zyniker werden insbesondere im ersten Teil von einem gesunden Geist in einem gesunden Körper sprechen, aber Kraft ist sich schon der Problematik einer kleinen isolierten Gruppe durchaus bewusst und weiß, dass der Stamm nicht in sich wachsen kann. Das seine deutschen Charaktere an ihren Aufgaben wachsen und vielleicht deswegen überdurchschnittlich alt werden, steht auf einem anderen Blatt. Nach knapp einem Drittel des zweiten Teils weicht die Extrapolation der hier beschriebenen Gesellschaft deutlich ab. Kraft integriert die jeweiligen klimatischen Umstände in seine Extrapolation und fügt für den Leser ein umfangreiches Wissen an biologischen Vorgängen und simplen Überlebenstrick unauffällig und nicht belehrend in geradlinige, aber manchmal recht langatmige Handlung ein.
Die Zusammenfassung der nicht mehr geschriebenen Romane vertieft den ersten Eindruck. In den nächsten beiden geplanten Abschnitten wollte Robert Kraft zwei weitere unabhängige Zivilisationen beschreiben. Danach schließt sich der klassische Existenzkampf als Triebfeder menschlichen Fortschritts an. Das Ende dieses Zyklus lässt er frustrierend weit offen. Diese komplexe Planung wertet rückblickend die beiden ersten Teile deutlich auf und lässt manche –auf den ersten Blick unbeholfene – Strukturen in einem anderen Licht erscheinen.
Sowohl Leipzig als auch der asiatische Raum weichen – vielleicht auch aufgrund der klimatischen Vorbedingungen von Eis und tropischer Hitze – in ihrem kulturellen Aufbau weit voneinander ab. Die Beschreibung dieser Differenzen fasziniert den Leser und führt ihm im modernen Gewand die historische Entwicklung der Menschheit intelligent und kompakt wieder vor Augen.
Jahre später wird insbesondere Stewart in seinem empfehlenswerten Epos „Leben ohne Ende“ viele Gedanken dieses Romans in der Chronik eines Wiederaufbaus aufnehmen und gänzlich anders reflektieren.
„ Die neue Erde“ ist auch im Vergleich zu dem knapp zehn Jahre später entstandenen Katastrophenromanen Eichhackers – „Panik“ und „Fahrt ins Nichts“ – eine interessante Spekulation mit einer kräftigen Beimischung Abenteuer und der Botschaft, dass selbst in der technologisch fortschrittlichsten Zivilisation unter der Oberfläche ein Barbar steckt, der – wenn die Zeit reif ist – wieder an die Oberfläche kommt. Robert Kraft fungiert hier weniger als fesselnder Abenteuererzähler, sondern als konzentrierter Weltenschöpfer, als intelligenter Prophet und Schöpfer eine weit reichenden Zukunftschronik. Viele seiner interessanten und auch heute noch betrachtenswerten Ideen sind im Anhang kurz zusammengefasst und hätten – von Kraft niedergeschrieben – einen ungewöhnlichen Zyklus ergeben. So bleiben dem Leser nur die ersten beiden Teile, die sich – vielleicht auch wegen des inzwischen altertümlichen und stilistischen manchmal etwas fragwürdigen Deutsches – ungemein ansprechend lesen lassen und unterstreichen, wie viele Facetten die utopische Literatur schon vor dem Ersten Weltkrieg aufweisen konnte.
Robert Kraft: "Die neue Erde"
Roman, Hardcover
Edition Ustard 2005
Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|