|
rezensiert von Thomas Harbach
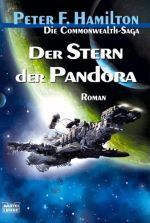 Auch wenn es auf den ersten Blick nicht erscheint, ist Peter F. Hamiltons Buch „Der Dieb der Zeit“ eine Einführung in den neuen Commonwealth- Zyklus, der mit dem vorliegenden auf zwei dicke Taschenbücher aufgeteilten Band „Pandora´s Star“ und im Frühjahr 2006 mit nicht unbedingt dünneren „Judas Unchained“ nur vorläufig abgeschlossen worden ist. Im nächsten Jahr beginnt der britische Autor einen weiteren Zyklus unter dem Arbeitstitel „The Void Trilogy“.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht erscheint, ist Peter F. Hamiltons Buch „Der Dieb der Zeit“ eine Einführung in den neuen Commonwealth- Zyklus, der mit dem vorliegenden auf zwei dicke Taschenbücher aufgeteilten Band „Pandora´s Star“ und im Frühjahr 2006 mit nicht unbedingt dünneren „Judas Unchained“ nur vorläufig abgeschlossen worden ist. Im nächsten Jahr beginnt der britische Autor einen weiteren Zyklus unter dem Arbeitstitel „The Void Trilogy“.
Wie in seiner Armageddon Serie allerdings liegt der Schwerpunkt des Buches auf der Weltenschöpfung und nicht – wie der Klappentext suggeriert – auf einer rasanten Actionhandlung. Es ist bei Hamiltons Romanen immer wieder überraschend, wie er eigentlich aus uralten Themen – eine mysteriöse Barriere verdeckt einige Sterne und bei einer näheren Untersuchung begegnet die Menschheit einer feindlich gesinnten, aggressiven außerirdischen Rasse – des Golden Age durch seine Detailbesessenheit und oft skurrile, aber interessante Charaktere noch lesenswerte Stoffe erschafft.
Die Romane/ der Roman spielt im 24. Jahrhundert. Die Menschheit hat sich auf mehr als sechshundert bewohnbaren Planeten angesiedelt. Politisch hat sich ein eher lockerer Verbund – der Commonwealth – gebildet. Verbunden sind diese Welten durch die von der Menschheit eher durch einen Zufall entwickelte Wurmlochtechnologie. Im Mittelpunkt der verschachtelten und leider mit zu vielen, oft unüberschaubaren und scheinbar endlos langen Subplots ausgestatteten Handlung steht eben die Entdeckung des künstlichen Schutzschildes und die Untersuchung dieser Anlage. Wie in einigen anderen seiner Romane stellt Peter Hamilton ganz bewusst die menschliche Neugierde in einen starken Kontrast zu den unbekannten und uneinschätzbaren Gefahren des Kosmos. Dabei beschreibt er das Geschehen fast ausschließlich aus der Perspektive sehr unterschiedlicher Charaktere. Mit diesem effektiven, aber gefährlichen literarischen Trick bezieht er nicht nur die Leser in das vielschichtige Epos mit ein, er reduziert seine gewaltige und mehr als einmal kaum überschaubare Vision auf eine überschaubare, effektivere Ebene. Das große Risiko liegt – wie bei einigen seiner anderen Bücher – in einer gewissen Isolation der Haupthandlung und bei vielen Lesern kommt nach den ersten zweihundert Seiten der Reiz auf, nur diesem Plot zu folgen und die manchmal belanglosen, manchmal kitschigen Seitenarme zu ignorieren. Das könnte sich im Laufe der Handlung als kleiner Fehler herausstellen, da sich der Autor bemüht, insbesondere auf den letzten hundert Seiten das Geschehen nicht nur zusammenzufassen, sondern eine Ausgangsbasis für den zweiten Roman – im Original sind die Bände zumindest im Hardcover vom Verlag nicht mehr aufgeteilt worden – zu installieren. Zumindest zu Beginn des Buches muss sich Hamilton allerdings den Vorwurf gefallen lassen, dass Querlesen des Textes genauso gut einen Eindruck hinterlässt wie sorgfältiges Studieren der einzelnen Szenarien. Dazu kommt – in klassischer Tradition der Pulpromane – als wiederkehrendes Element das Beenden eines Kapitels auf einem scheinbaren Höhepunkt, der zum Teil erst hunderte von Seiten später wieder aufgenommen wird. Dadurch verliert dieser zuerst so überraschende Einfall sehr viel an Effektivität.
Auf den ersten Blick hat die neue Serie – trotz eines anderen Plots aber wegen einer ähnlichen Intention – Ähnlichkeit mit seiner Armageddon Serie, sehr viele unterschiedliche Charaktere und eine fremde, wieder im Hintergrund agierende außerirdische Rasse, der sich die Menschheit stellen muss. Im Gegensatz zu dieser umfangreichen Serie schlägt Hamilton seinen Bogen fast von der Jetztzeit in diese ferne Zukunft: mit dem Astronauten Wilson Kime fast aus unserer Gegenwart hat Hamilton eine Figur entwickelt, mit der sich der Leser schnell und fast unbürokratisch identifizieren kann und für den der oft rasante technische Fortschritt auch eine stetige Herausforderung darstellt. Der Gegenpol ist der charismatische Sektenanführer Bradley Johansson, der an eine Manipulation durch außerirdische Wesen glaubt und sich selbst mit Gewalt nicht von seinen Zielen abbringen lässt. Dazwischen befindet sich der Wissenschaftler Ozzie Fernandenz Isaac – eine Anspielung auf Isaac Asimov und den durch geknallten Musiker? – das Genie hinter der Wurmlochtechnologie und phasenweise als Späthippie beschrieben. An diesen drei exemplarisch vorgestellten Charakteren erkennt der Leser, wie sehr Hamilton wert darauf legt, exzentrische und stets leicht wieder zuerkennende Figuren zu erschaffen. Auf dieser Basis kann er dann seine Space Opera aufbauen. Dank seines cineastischen und oft rücksichtslos dramatischen Stils konzentriert er sich nach einer kurzen Einführung fast ausschließlich auf den Hintergrund seines Universums. Routiniert verbindet er die persönliche Geschichte seiner einzelnen, sehr unterschiedlichen Figuren mit einem historischen Abschnitt des Commonwealth – von den ersten Schritten ins All über die Entwicklung der Wurmlochtechnologie bis zur Begegnung mit den Aliens. Im Gegensatz zu vielen anderen britischen Autoren im Bereich der neuen barocken Space Opera differenziert er zwischen einer kontinuierlichen soziologischen Entwicklung und technologischen Erfindungen. Seine Figuren sind keine Maschinenmenschen oder Internetjunkies, es sind oft reife, intelligente und mit ausreichender – bis zu dem Augenblick, in dem sie auf Hamiltons kosmische Bühne treten – Lebenserfahrung versehene Menschen, die menschlich agieren und Gefühle zeigen. Die Technik hat zwar ihre Lebensumgebung verändert, die grundlegenden Züge – Liebe oder Hass, Bewunderung oder Neid – bleiben aber intakt. Klassische weiche Technologien wie das Kloning, die Verlängerung der Lebenszeit durch einen kontinuierlichen Körpertausch und Zellerneuerung sowie die Möglichkeit Erinnerungen zu speichern und ggfs. wieder aufzurufen – erweitern das Spektrum, werden aber gezielt eingesetzt, ohne das sie von der grundlegenden Handlung ablenken. In „Der Dieb der Zeit“ hat sich Hamilton ausführlich mit den Vorteilen und Veränderungen eines Jungbrunnens auseinandergesetzt, auf diese Erfahrungen greift der Autor zielstrebig zurück. Die einzige Brücke zu seinen britischen Kollegen ist die Schaffung einer Unisphere, eines modernen Internets, dessen Zugang über so genannte Ebutler ermöglicht wird.
Allerdings muss sich Hamilton deutlich den Vorwurf gefallen lassen, dass der Roman durchaus zwanzig bis dreißig Prozent schlanker und dadurch effektiver hätte geschrieben werden können. Viele der Subplots sind spannende, abgeschlossene Novellen. Sie sind aber für diesen Roman weder notwendig, noch wirklich effektiv. Es wäre besser gewesen, diese Texte gesondert zu veröffentlichen. Andere Szenen – insbesondere eine Partyveranstaltung mit für die Gesellschaft so typischen Ränkespielen – lassen den Plot im wahrsten Sinne des Wortes zum Stillstand kommen und werden später nicht weiter ausgeführt. Es sind diese vielen Ideen, die ungeordnet im Raum stehen und einen kontinuierlichen Lesefluss verhindern.
Das Ende des Romans ist frustrierend offen und zeigt, wie sehr Hamilton auf eine Fortsetzung und damit wahrscheinlich auch auf einen weiteren lukrativen Bestseller hingearbeitet hat. Nach mehr als eintausenddreihundert Seiten bleibt im Leser eine spürbare Leere zurück, die erst gefüllt werden muss. Der Doppelroman – im Deutschen – „Pandora Star“ zeigt Peter Hamilton gleichzeitig von seinen starken – das Erschaffen eines überzeugenden, phantastischen Hintergrunds – und seinen schwachen – eine straffe, gut getimte Handlung – Seiten. Im Gegensatz zu seinen letzten beiden Romanen – trotz deren Schwächen insbesondere in Bezug auf eine Botschaft als auch die Moral - wirkt dieses Epos eher wie ein Rückfall in die Tugenden und Untugenden seiner ersten Bücher und hätte trotz einiger sehr spannender Szenen einen härten Lektor verdient.
Peter F. Hamilton: "Der Stern der Pandora"
Roman, Softcover, 747 Seiten
Bastei 2006
ISBN 3-4042-3290-9

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|