Literatur im Lichthof - Zoom
Thomas Albrich (Hrsg.): Jüdisches Leben im historischen Tirol. Von den Anfängen bis zu den Kultusgemeinden in Hohenems, Innsbruck und Meran
Barbara Aschenwald: Omka. Roman
Diese Kapitel sind Stationen, die Aschenwalds Protagonistin Omka durchleben muss, nachgerade Stationen eines Leidensweges, welcher der Vorsehung folgend im Tod endet. Das Kreuz, das sie unterjocht, ist ihre Seelenlosigkeit, die sie anders und für die anderen unberechenbar macht. Aufgehängt ist die Geschichte am realen Fall der Amoktäterin von Lörrach im September 2010, ein großes Medienereignis damals und von den üblichen Spekulationen über Motive begleitet. Aschenwald erzählt den letzten Tag im Leben der realen Juristin Sabine R. im Schlusskapitel, das den Erzählfaden des Beginns wieder aufnimmt und stärkster Moment im Roman ist. Selbst wenn hier alles so unmärchenhaft endet – alle sind gestorben und keiner lebt „noch heute“ – kommt gerade an dieser Stelle die Nähe zum Magischen zum Tragen. Die Frage an sich, warum es zu diesen drastischen Schicksalsschlägen kommt, die man der Zeitungschronik entnimmt, ist nach wie vor brisant. Die Frage nach psychopahtologischen Handlungsweisen ist auch nach wie vor für die Literatur interessant: Warum bringt Gretchen ihr Neugeborenes um? Warum mordet Woyzeck seine Marie? Warum erschlägt Bahnwärter Thiel seine Lene und ihr Kind? Warum ist der gute Dr. Jekyll an den bösen Mr. Hyde gebunden? Aschenwald stellt sich durchaus eigenständig in diese Reihe, der erzählerische Reflex auf das Märchen findet sich allerdings in der Verbindung zwischen einem starken Anfang und Schluss nicht immer gleich überzeugend. Die Idee, dass Omka aufgrund eines „Schwimmunfalls“ am Romaneinstieg einerseits unter einer temporären Amnesie leidet und dadurch ihr Leben und Leiden mit dem Leser aufarbeiten kann, sie so andererseits zum „Mädchen mit einer Seele aus Wasser“ wird, ist durchaus genial. Und gerade dieser na(t)ive Aspekt Omkas bietet Gelegenheit, einen satirischen Blick auf den Seelentrost der Kirche zu werfen. Nicht Weniges an dieser Bindungsgeschichte und der Frage, warum sie so, wie sie erzählt wird, ent- und besteht und vergeht, ist aber auch ein bisschen banal. Das ließe sich damit rechtfertigen, dass auch das Leben banal ist, schon wahr. Aber darum ist es dieser „Geschichtenerzählerin“ nicht gegangen. Oder doch? Christoph W. Bauer: Die zweite Fremde. Zehn jüdische Lebensbilder
2010 reist Christoph W. Bauer zusammen mit einem Filmteam nach England und Israel, um zehn Menschen zu treffen, die ein gemeinsames Schicksal verbindet. Es handelt sich um jüdische Bürgerinnen und Bürger der Tiroler Landeshauptstadt, die 1938 gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Den meisten gelingt mit einem Kindertransport die Ausreise. Die damals im Alter von acht bis 18 Jahren waren, erfahren ein Trauma und einen Schmerz, der ihr ganzes Leben prägen sollte. Dabei waren ihre Anfänge samt und sonders gut gewesen. In den Gesprächen, die in „Die zweite Fremde. Zehn jüdische Lebensbilder“ dokumentiert sind, sprechen sie von einer schönen Kindheit, die sie in Innsbruck erlebt haben. Bei den meisten handelt es sich um Kinder renommierter Kaufmannsfamilien, die das Groß- und Bildungsbürgertum der Stadt repräsentierten. Die radikale Entwurzelung, die der „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland zur Folge hat, kommt bei ihnen allen einer Vertreibung aus dem Paradies gleich. Ein Grundmotiv von Bauers Buch lautet: „Es ist keine Reise in die Vergangenheit, es ist eine durch die Gegenwart.“ Indem der Autor diese Menschen aufsucht und sich deren Schicksal erzählen lässt, erforscht er zugleich und eigentlich die Gegenwart. Was sind das für Existenzen, die Erinnerungen an eine Kindheit mit sich tragen, aus der sie brutal gerissen wurden? Welches Verhältnis nehmen sie ein zu dieser Kindheit in einem Land, das ihnen einmal feindlich gegenüberstand? Ist erlittenes Leid und Unrecht immer gegenwärtig, solange es nicht gesühnt ist? Ist die Frage nach Sühne, nach Gerechtigkeit eine, die die Befragten beschäftigt? Kann solches Leid gesühnt werden? Um diese unausgesprochenen Fragen kreisen die Gespräche. Ein konkret wiederkehrendes Thema ist die Restitution. Sämtliche Bemühungen darum stoßen unmittelbar nach dem Krieg auf Schwierigkeiten, Ablehnungen, Verzögerungen, manche erleben sie nicht. Doch die Erinnerung ist hartnäckig und nur selten positiv. Wie Michael Graubart ausführt, der immer noch die österreichische Küche liebt: „Wenn ich selbst etwas koche, dann Gulasch und ähnliche Sachen. Das habe ich wohl von meiner Mutter, you know, my mother cooked in a kind of mixture of Russian and Austrian and Jewish sort of cooking.“ In ihren Aussagen wird die Zeit lebendig, und auch das Grauen. Die Zeitzeugen waren damals größtenteils noch sehr jung, ihre Erinnerungen sind teils vage. Ihr Erzählen ist mehr ein Berichten, ein Schildern der Vergangenheit, das versucht, Emotionen möglichst auszublenden, das persönliche Drama als Teil eines umfassenderen Ganzen darzustellen und dadurch zur eigenen Betroffenheit eine Distanz einzunehmen. Die meisten von ihnen haben nach dem Krieg ihre Geburtsstadt wieder besucht. Einigen gelang das nur, wenn und weil ihnen die Stadt fremd geworden war. Das Fremdsein schaffte jene Distanz, die eine Annäherung wieder möglich machte. Manche von ihnen kehren nach Österreich zurück, berichten in Schulen von ihren Erlebnissen und tragen auf diese Weise zu einem tiefgreifenderen Verständnis persönlicher und historischer Zusammenhänge bei. Doch nicht auflösbare Widersprüche prägen diese Erzählungen: „Israel is my home. It isn’t my home. But it could be my home.“ Gerade im Zusammenhang mit Heimat und dem Heimatgefühl geben die Vertriebenen unterschiedlichste, zum Teil Antworten, die tiefe Einblicke in die Verstörungen zulassen. „… Israel ist meine Heimat und in Österreich fühl ich mich zuhause.“, bringt Peter Gewitsch sein Dilemma auf den Punkt. „Er schiebt die Brille zurück, streicht sich über den Kopf und führt lächelnd in einen anderen Bereich des Appartements. ‚Das ist unsere sogenannte österreichische Wand.‘“ Zwischendurch tauchen auch Gedanken auf, ob es zwecklos sei, über die Vergangenheit zu reden. Eindeutige Antworten bleiben aus, ebenso Schuldzuweisungen. „Zur Ruh kommt sie nicht: Am Leben geblieben zu sein, das wirft Fragen auf, für die es keine Antworten geben darf.“ Aufenthaltsorte, Zwischenstationen, an denen sich Wege kreuzen. So entsteht während des Lesens eine Kartographie von Lebenslinien mit Knotenpunkten, mit aktuellen Fotos der Interviewten sowie mit deren Erinnerungsfotos bebildert. Der Einbruch des Grauens in der Normalität und der Zwang, diesem Einbruch zu begegnen. Das geht nicht, ohne Schaden zu nehmen, das wird in der Erinnerung sichtbar. Christoph W. Bauer geht behutsam vor und kommentiert die Einblicke in diese Verwüstungen ebenso einfühlsam. Das zeigt dieses Buch, mit Respekt vor dem, was letztlich nicht gesagt worden ist.
[1] Ulrike Kindl: Kritische Lektüre der Dolomitensagen von Karl Felix Wolff. Band II: Sagenzyklen. Istitut Cultural Ladin „Micurá de Rü“, 1997, S. 116. Oswald Egger: Euer Lenz
Das Frontispiz schmückt ein Stich nach einer Zeichnung aus dem „ABC-Buch für kleine und große Kinder“ aus dem Jahr 1847: ein Narr steht im Schulterstand, die gegrätschten Beine weit zum Himmel streckend. Es ist der Buchstabe Ypsilon. Der Narr im Schulterstand ist zum Laut-Zeichen geworden und schaut seiner eigenen Verwandlung zu. Das Frontispiz hat Programmcharakter: in den folgenden Kapiteln werden die Signifikanten oft auf dem Kopf stehen. Sie lösen sich von den festgefahrenen Signifikaten und weisen in ungewohnte Sinnrichtungen. Die Bedeutungen werden unentwegt gedreht. Eggers Signifikanten schauen sich selbst aus dem Schulterstand zu. Hoch oben zwischen ihren Füßen, im Abgrund des Sprach-Himmels, formen sich neue Signifikate. Sie erzählen vom Zeichencharakter der Signifikanten und dem der Welt. Zu Beginn des Kapitels „Wie heiße ich noch einmal?“ steht ein Kulissenbild („Wald“) des spätbarocken Theatermalers Carlo Galli Bibiena, darunter die Anmerkung: „Einvierung der illusionistischen Erweiterung des Weltinnenraums“. Bild und „Untertitel“ sind ein metapoetischer Kommentar zu dem, was folgt: zu einem „Weltinnenraum“, der ein Ich-und Sprach-Innenraum ist, und zu dessen virtueller Erweiterung. Es folgt ein wörtliches Zitat aus Dantes Göttlicher Komödie („Dantes Panther“ − die Allegorie der Wollust); in Eggers Übertragung („Kommödie des Verstehens“) verwandelt sich die Pantherkatze (Unze) in eine Allegorie der poetischen Wollust; sie stellt sich dem erzählenden Ich (seinem Wunsch nach einem linearen Verständnis) als Närrin in den Weg („mit schellengleichen Ärmelchen am Fell“); sie zwingt es, auf seinem „Kunterweg“ „hundert Volten“ zu vollführen. Der Weg führt (wie bei Dante) durch alle Höllen und alle Himmel, vor allem aber durch einen „Wald“ an inter- und intratextuellen Bezügen, an Fremd- und Eigenzitaten, an Anspielungen und Inversionen (Dante, Büchner, Lenz, Goethe, Eichendorff, Calderon/Grillparzer, „Ossian“ …). Alles verwandelt sich unaufhörlich: das erzählende Ich, die Welt, die Spiegelungen der Welt in Wort und Bild. Das Buch fordert dazu auf, in ihm zu blättern, die Leserichtung zu ändern, Varianten des Verstehens zu probieren. Es lädt dazu ein, bei der Struktur der Sprachzeichen und Zeichnungen zu verweilen, aber auch über die einzelnen Sätze zu sinnieren: „Ich weiß nicht, ich bin verwandert in einem noch ganz anderen Land.“, heißt es (fettgedruckt) auf S. 9. Es folgt eine eingerückte Zeile in Kursivlettern: „Siehe, ich hab so schöne Spiele mit Drehungen der Hände gespielt.“ Da könnte man lange verweilen: beim biblisch anmutenden „siehe“, bei der Schönheit des Satzganzen, bei der figura etymologica „Spiele gespielt“, bei der Unvereinbarkeit von Aufforderung und Ausführung (Wie kann man etwas sehen, das schon vergangen ist?), beim spielerischen Charakter dessen, was gesehen werden soll, bei der Schönheit des Spiels, das aus „Drehungen der Hände“ besteht. Der ins Surreale gedrehte Satz inszeniert das „Drehbare“ der Sprache, ihre Wendung ins Ungewöhnliche, das Abrücken vom Genormten mit den Stilmitteln eines scheinbar einfachen Sprachregisters. Das poetische Sprechen wird zum metapoetischen Sprechen. Eine dritte Stimme sagt: „Meine Scheune ist ein leerer Wald aus eingeremmten Bäumen.“ Unüberhörbar ist hier die Freude an surrealen, paradoxen Verbindungen. Dass die Scheune ein Wald ist, ist die erste Drehung gegen den „Sinnzeigersinn“; dass dieser entleert wird, die nächste; die „eingeremmten“ Bäume als Material und Grundlage des leeren Waldes bilden die Schlussvolte des Satzes. Der Satz ist eine schwindelerregende Folge aus Volten. Der Satz tanzt. Das Proömium „Alineas“ hat das Äußere eines Prosa-Poems. Stimmen in drei verschiedenen typographischen „Tonlagen“ fügen sich zu Prosa-Terzinen. Manchmal fehlt die kursiv gehaltene Stimme, dann sprechen nur zwei Stimmen, die dritte schweigt. Lehnt sich das Proömium formal an die Terzinen der „Göttlichen Komödie“ an? „Euer Lenz“ ist auch dies: eine Verschmelzung von lyrischer Prosa und sprechenden Stimmen. Es ist ein Langgedicht, ein Prosastück und ein dramatischer Text in einem. In einer einzigen „Terzine“ durchmisst das sprechende Ich den Himmel und die Hölle: (S. 10) Ich ging Bienen besichtigen, und der Himmel troff Blitze. Schönes und Schreckliches werden zusammengeführt: die Bienen (bei Egger oft Metaphern für die Dichter) und der blitzetriefende Himmel, ein wunderschöner, vom Aussterben bedrohter Vogel und das auseinanderbrechende Ich. (Ist es ein Aufbrechen oder ein Zusammenbrechen?) Ein polyphones Ich erzählt von sich: von seiner Zartheit, seiner Einfalt und seinem Innenraum („Ich bin ein kleiner, verwachsener, blaß und sensibel aussehender Tropf, knöbbter, aber ein verwölbter, glatt ausgehöhlter Knoten.“, S. 15). Im Kapitel „Durch durchs Gebirg“ erzählt das Ich, Büchners Novelle zitierend und invertierend, von den erlittenen tödlichen Verletzungen („Den 20. wurde ich erschlagen aufgefunden. Ich lag, unter dem Hochjoch, am Waldhang in einer großen Blutlache, mit dem Gesicht nach unten.“ S. 103“). Man hat den Narren erschlagen, seine Verrücktheit war bedrohlich. Auf der gegenüberliegenden Seite aber steht: „Muß ich dran glauben, wenn man sagt, ich bin tot?“ Das totgesagte Ich spricht noch immer, Lenzens närrische Sprache ist nicht totzumachen. Seine Narrheit bringt ihm die Erfahrung der eigenen Ermordung und Zerstückelung ein, aber auch die eines einfältigen Glücks („Ich bin ein wie einer, der lange Bärte trägt, glücklicher Tropf.“, S. 107), einer außerordentlichen Hellhörigkeit, einer Begabung zur gesteigerten Wahrnehmung ( „Man durchbohrt mir die Ohren und ich hörte und verstand die Gespräche und Träume der Farne …“, S. 107). Das Ich erfährt sich als endlos scheltend („Am Beginn der Wuhnen und Trosse: ich schelte ohne Ende.“, S. 108), als lachend („Ich lache nicht, weil ich lustig bin, sondern ich bin lustig, weil ich lache …“, S. 110), als scheu („Ein scheuer Barsch bin ich …“, S. 114), als geschunden ( „Man zieht mir, wie den Kälbern, Haut in Form eines Fellsackes ab.“, S. 120) und verzweifelt („Niedergeschmettert, zerknirscht, und in einzelne Bestandteile zerlegt, ich existiere gewissermaßen nur noch in der Annahme und dem Durchleben dieser von allen Seiten über mich hereinbrechenden Verzweiflung …“, S. 121). Das Ich ist Lenz, Linz und Lunz in einem, es zerfällt, es zerteilt sich, es lacht und weint. Dem Lenz-Kapitel folgt das Goethe-Kapitel „Ich bin ein Goethe in meiner Geode“ und diesem das Kapitel „Lullidalfahabarabbers Brobding“ mit seinen Wortschelmereien, kinderreimähnlichen Lautgedichten und seinem Wortgebimmel („Witzchen, sag Witzchen, / viel oder ein Fitzchen? / Fitzchen sag bald, / Feld oder Wald?“, S. 154). Die Sätze und Buchstaben tanzen, schwirren und albern herum. Eggers Sprache ist ein einziger Klangzauber, eine Ohrenfreude, ein klingender Jux. „Euer Lenz“ ist (um eine Wendung zu übernehmen, die das polyphone Ich verwendet) ein „Ich-Ich-Ich“-Buch. Tausend Ichs sprechen von sich. Zugleich ist „Euer Lenz“ ein ich-auflösender Text. Er sondiert alle emotionellen und geistigen Zustände des Ichs; das Ich wird seziert und zerstückelt; es erfährt keine Gnade. Das Buch liest sich wie eine lange Meditation. In der sprachlichen Umkreisung des Ichs öffnen sich dessen Grenzen, der Ich-„Zaun“ fällt auseinander. Ich und Universum werden als Einheit erfahren, spiegeln einander. Eggers Sprache erweitert die Lexikonsprache um die ihr inhärenten Möglichkeiten. Wie ein „Wurm“ durchwühlt sie das „Erdreich“, die Sprach-Materie, durchlüftet, lockert sie und baut neues Material auf. Eggers poetische Sprache schafft Wortträume („Ossianiden“), Kopfgeburten, gewaltige Sprachschlachten (Verteidigungen und Eroberungen von ganzen Sprachreichen) in einer ästhetisch vollendeten Form. Christine. H. Huber: FORT SCHREIBUNG. Lyrik der Gegenwart31 in reih und glied stehen sie
Otto Licha: Sieben. Hypo-Roman
Von dieser Zweier-Grundkonstellation ausgehend, entwirft der Roman ein Kaleidoskop skurriler Einfälle und Begebenheiten. In die Lebensgeschichte der beiden mischen sich deren Eltern, die teils schablonenhaft gezeichnet sind. Alessandros Mutter zum Beispiel kann als überzeugte Deterministin nichts aus der Ruhe bringen, was litaneiartig in Sätzen wie „Alles sei vorherbestimmt“ wiederholt wird. Wie ein Magier und Jongleur nimmt der Autor Ideen auf, wirft sie in die Luft und fängt sie neu geordnet wieder auf. Alessandros Erfolgsgeschichte führt ihn nicht nur nach Manchester, sondern als Bankdirektor genauso in die Finanzmetropole Frankfurt am Main, wo ihm in Gestalt einer Anhängerin der Occupy-Bewegung die Liebe begegnet. Seelenverwandtschaften stellen sich ein, sowohl mit einem japanischen Finanzguru wie mit einer österreichischen Bundespräsidentin. Die inzwischen reich gewordenen Jugendfreunde von Manchester United fungieren als Sponsoren seiner Bankenidee. Ein geheimnisvolles Buch mit dem Titel „Parallelstruktur“ begleitet Alessandro bei all seinen Unternehmungen. Die Ereignisse nehmen einen parallelen Verlauf. Gesundheit und Krankheit, Österreich – Deutschland, Nord- und Südtirol, Manchester United und Wacker Innsbruck, Bankensektor und Protestbewegung Occupy. Dieser Text ist auf der Höhe der Zeit und an Aktualität kaum zu überbieten. Erzählt wird äußerst humorvoll und beschwingt, in einem angenehmen, flotten Rhythmus. Das Leben, die Ereignisse purzeln dahin. Zwischen all dem Gebälk der geistreichen Konstruktion bleibt noch genügend Raum für allerlei ironische Seitenblicke auf zutiefst österreichische, im Besonderen tirolerische Belange. Zum Beispiel auf den Umgang Österreichs mit bestens ausgebildeten Migranten: „Als die Hürden nur mehr eine Ausreise aus dem Land zur Wahl stellten, heirateten Pilar und Maximilian. Nun mussten die beiden dem österreichischen Staat nur mehr beweisen, dass hier Liebe und nicht reine Zweckmäßigkeit als Ehegrund vorhanden war. Dieser öffentlich gehaltene Liebesbeweis gelang, als Carmen geboren wurde. Andererseits wurde so die Fortsetzung von Pilars Architektenkarriere wieder aufgeschoben.“ Oder das schwer zu durchschauende Politsystem, in dem unsichtbare Fäden gezogen werden. „Auch war es in Tirol noch niemandem gelungen, die Macht bloßzustellen, damit alle sie sehen konnten. Es wollte ohnehin niemand die Macht sehen. Alessandro wähnte sich schon in Berührung mit ihr, da seine Vorgesetzten ihm in einer Sitzung bereits das Ende seiner Bankenidee vor deren Verwirklichung ankündigten. Die Idee sei so alt wie der Mond und schon längst verwirklicht.“ Im Verlauf des Romans wird Alessandro noch einmal mit dieser „Macht“ konfrontiert, als es darum geht, ein für Innsbruck revolutionäres Verkehrsprojekt auf Schiene zu bringen. „Innsbruck ist, was den Verkehr betrifft, die dümmste Stadt der Welt“, sagt Martin Flatscher, der eine Idee hat, die Alessandros Bank sponsern soll. So mangelt es nicht an gezielten Seitenhieben auf bestehende Verhältnisse wie auf Menschliches, Allzumenschliches: „Wieder wird bei den Menschen gespart, wieder macht man sie arm, wieder ‚muss jeder seinen Beitrag leisten‘. Und draußen herum wird nur Unsinn produziert, dafür geworben und gequatscht.“ Den Anstoß zu diesem und neun weiteren Buchprojekten gab die Hypo-Bank-Tirol, die zur 111-Jahr-Feier ihres Bestehens auf die Idee verfiel, zehn Romane zu fördern. Was in vorliegendem Fall wie ein Auftragswerk aussieht, unterläuft mit viel Ironie die Bedingungen seines Entstehens. Realität und Phantasie vermischen sich auf originelle Weise in einer erstaunlichen Leichtigkeit. Letztlich gelingt dem Autor das Bravourstück, eine Geschichte, die sich aus Fiktion und Realitätsfragmenten zusammensetzt, so plausibel zu montieren, dass man dem Fortgang der Story bis zur letzten Seite in einem Atemzug zu folgen bereit ist. Alfons Petzold: Ich mit den müden Füßen. Texte eines Arbeiterdichters. Hrsg. von Ludwig Roman Fleischer
Ich wurde schmerzhaft hellsichtig für die verborgensten Zeichen des Elends, überall wurden mir seine Spuren sichtbar. Es trieb mich dazu, sie in dem reinsten Kindergesicht zu suchen. Immer waren Auge und Ohr auf ihre Entdeckung aus. Ich legte in meiner Seele ein Archiv proletarischer Armut an. Da reihte sich Bild an Bild, eines trauriger, schmachvoller, entsetzlicher als das andere. Weil jedoch nicht sichtbar ist, wo Petzold und wo Fleischer für den Text verantwortlich ist, wird die Lektüre mehr und mehr mühsam: Ich benutzte wieder die Volksbibliothek. Mein Bedenken, daß ich die Bücher mit meinen Bazillen schwängern könnte, war verschwunden. Wenn ich sterben, wen [sic] ich ins Gras beißen mußte, warum sollte ich mich da um die Gesundheit der anderen kümmern... So lieh ich mir „Die Anarchisten“ von Makay [gemeint ist: John Henry Mackay], „Das Totenhaus“ von Dostojewsky [sic] und des russischen Revolutionärs Fürsten Krapotkin [gemeint ist: Fürst Pjotr Alexejewitsch Kropotkin]Lebensgeschichte aus, welche Bücher mich noch mehr zerstürmten und meine Seele zum wildesten Aufruhr brachten. In dieser Form können seine Texte, kann sein Archiv der Armut niemanden mehr zerstürmen. – Es ist indessen gut möglich, dass Petzold schon das russische Sprichwort gekannt hat: Gott schütze mich vor meinen Freunden; mit meinen Feinden will ich schon selber fertig werden. Anna Rottensteiner: Lithops. Lebende Steine. Roman […] es ist die Erinnerungsfähigkeit [...], so fragwürdig sie auch sein mag, die Menschen erst zu Menschen macht. (Aleida Assmann)
Eigentlich sind Steine nichts Lebendiges. Steine sind Metaphern für Verhärtung, auch wenn sie nicht immer so unberührt von ihrer Außenwelt bleiben, wie es den Anschein haben mag. Lithops sind die „lebende[n] Steine, Mittagsblumengewächs […]. Mit ihren Pfahlwurzeln fahren sie tief ins Erdreich hinein, um an Grundwasser zu kommen, an der Oberfläche sind sie klein und unauffällig, ahmen die Formen und Farben der Steine nach, um sich zwischen ihnen verbergen zu können, ziehen sich zusammen, um sich vor extremer Sonneneinwirkung zu schützen. Sie brauchen das Licht, doch nicht zu viel. Erst dann erblühen sie, einmal im Jahr […]. Meint man es zu gut mit ihnen und gibt ihnen zu viel Wasser, gehen sie ein. Sie holen es sich selbst aus der Tiefe gerade so viel, wie sie brauchen“. (115) Die lebenden Steine in Anna Rottensteiners Roman symbolisieren Erinnerungen, die schwer wiegen und denen man oft lange nicht oder nie mehr begegnen will. Mit dem Bild der Steine setzt der Roman ein: Dora nimmt regelmäßig von den Spaziergängen durch die finnischen Wälder Steine mit nach Hause und sammelt sie zunächst hinter dem Haus. In der Bucht wird sie später versuchen, die Steine anzuordnen und aus ihnen Figuren zu entwerfen: zuerst die Figur der Mutter des Ich-Erzählers Franz – Dora begegnet ihr als Kind, als sie auf Besuch bei ihrem Vater Armando war, der als Lehrer während des Faschismus nach Südtirol versetzt wurde und bei Franz‘ Mutter eine Bleibe findet – dann auch diese Vaterfigur. Man wird an Familienaufstellungen erinnert. Geschickt trennt und verknüpft die Autorin in 22 Kapiteln die Parallelhandlungen Vergangenheit und Gegenwart. Erzählt wird aus der Sicht der sich erinnernden Figur Franz, die sich jedoch sehr zurücknimmt und das Leben ihrer Mitmenschen in den Mittelpunkt rückt. Zunächst ist es die eigene Mutter, die als selbstbewusste, „eigenwillige“ (12), „schöne“ (11) Frau dargestellt ist – im Roman bleibt sie namenlos –, eine Bäuerin aus dem fiktiven Südtiroler Ort Maria Lichtmoos, die ihren Sohn mehr oder weniger „schweigend“ aufzieht – „wir sprachen nicht viel miteinander, es herrschte eine Art stummes Einverständnis zwischen mir, ihrem einzigen Sohn, und ihr“ (12). Die Härte der Zeit hat die Frau geprägt: Der Option hat sie sich verweigert, einem Italiener hat sie in ihrem Haus eine Unterkunft gewährt – damit hat sie sich im Dorf zur Außenseiterin gemacht. Doch sie lässt sich nicht entmutigen, sie geht ihren Weg mit der festen Erkenntnis „Das Eigene kann einem auch von den Eigenen gestohlen werden“ (65). Armando dagegen, geboren in Monreale bei Palermo, erzählt in seinen Aquarellen, die er auf dem Bauernhof der Mutter von Franz malt, von seinen Erinnerungen an Sizilien und begegnet dadurch seiner eigenen Lebensgeschichte. Das friedliche Zusammenleben der beiden „Außenseiter unter einem Dach“ (18), ihre stille, jedoch tolerante Art miteinander umzugehen, stehen völlig gegensätzlich zur Feindlichkeit zwischen der deutsch- und italienischsprachigen Gruppe in der Südtiroler Öffentlichkeit in den späten 30er Jahren. Dora und Franz begegnen sich erstmals in Mutters Haus im Sommer 1939 und die lebendige, neugierige, junge Frau wirkt auf ihn zunächst befremdend. Sie lässt sich von Mussolini ebenso begeistern wie für andere Dinge, die das Leben an sie heranträgt. Durch ihren Einsatz für das faschistische Regime, den sie mit ihrem Dienst an einer der Geliebten Mussolinis, Clara Petacci, leistet, entfernt sie sich politisch gänzlich von ihrem anti-faschistisch eingestellten Vater. Dieser schließt sich einer Widerstandsgruppe an und wird dort seinen Tod finden. Auch Franz bringt als ehemaliger Spion für den deutschen Militärdienst im Jahre 1944 seine eigenen Geschichten mit. Einfühlsamkeit und Geduld prägen die Erzählhaltung im Roman: „[A]ufeinander zugehen und den anderen für sich lassen, sobald man dies für richtig erachtet[…]“ (69). In einer poetischen Sprache werden tiefgründige, traurige Stimmungen und Gefühle vermittelt. Nichts ist überzeichnet. Dadurch entsteht ein Raum, in dem es dem Leser gelingen kann, ein Verständnis für die Figuren zu entwickeln. Bemerkenswert ist auch der ausgeprägte Blick der Autorin für besondere Frauen und Frauenschicksale, die sie kunstvoll in den Text einbaut. Erinnerungsprozesse entfalten sich immer anders. Rottensteiners Text ist ein ästhetischer Ort der Erinnerungsarbeit und Dora ein schönes literarisches Beispiel dafür, wie diese „funktionieren“ kann. Die Autorin nähert sich dieser Figur und ihrer Vergangenheit mit sehr viel Sensibilität und auf eine leise, unaufdringliche Art. Sie zeigt ein differenziertes Verständnis dafür, wie und warum sich ein Mensch manchmal so entwickelt, dass sich seine Entscheidungen im Nachhinein als „falsch“ herausstellen. „Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ (46), heißt es im Buch aus dem Mund der Mutter. Allerdings vereinfacht der Text die Erinnerungsvorgänge auch nicht, sondern verweist geradezu auf deren Komplexität. Manchmal können es Gegenstände sein, wie die Steine, die zu Erinnerungsträgern werden, so dass „aus den tiefen Schichten des erinnernden Schlafs, Menschen, Personen, die sich in [ein]Leben eingekerbt haben,“ (41) hervorgehen. Dann wieder sind es Gerüche und der Geschmack, die Erinnerungen auslösen und wenn man sie wahrnimmt, so wie Dora, kann es einem letztendlich zu einer Art Glück verhelfen. Auch Reisen an Gedächtnisorte – Dora und Franz kehren immer wieder auf Spurensuche nach Rom zurück – zählen dazu. Erinnerungsprozesse brauchen auch ihre Zeit, für manche reicht ein Leben nicht aus. Dora hat Glück: Am Ende kann sie sogar ihre schmerzhafte Erinnerung an ihre Beziehung zu ihrem Vater in eine Steinskulptur formen. Und sie hat auch den richtigen Menschen bei sich, der sie auf ihrem Weg mit sehr viel Nachsicht begleitet.
Gesucht (und gefunden) werden in Sarclettis Gedichten Spuren von Bedeutungen, von Sinn und Schönheit, von Emotionen und Erinnerungen. Der sich in die Wörter, zwischen die Bausteine der Wörter schiebende Punkt ist vielleicht das signifikativste Stilmerkmal der lyrischen Sprache Sarclettis. Er markiert Zusammengehörigkeiten und Differenzen und damit die tatsächlichen Spuren des Lebens. Der Gedichtband umfasst vier Zyklen: „närrin“, „ge(h)dichte“, „im Krebsgang“, „die königin überdauert den winter“. Das Coverbild und die Bilder zu Beginn des jeweiligen Zyklus stammen von der Autorin selbst. In ihnen werden die Gedichte zu Bildern. Die Aquarelle (gearbeitet mit Pastellkreide) weisen sanfte Farben und weiche fließende Linien auf. Auf dem Coverbild und den ersten drei Bildern erkennt man zarte, nur angedeutete Frauengestalten. Das Bild zum vierten Zyklus zeigt die sanften, nebelweißen Umrisse einer Blume, vielleicht die Blüte einer Schneerose; sie umschließt eine rötlichgraue Sonne, einen weißgrauen storchähnlichen Vogel und ein goldgelbes Farbfeld, einen Lichtsee, eine Andeutung von Wärme. Auf dem Bild zum Zyklus „ge(h)dichte“ scheint eine Frauengestalt mit einem vom Himmel zur Erde strömenden Lichtfluss zu tanzen. Viele Gedichte kreisen um das Universum „Frau“, den weiblichen Körper, die weiblichen Aspekte des Lebens. Viele Wortkreationen des Zyklus „närrin“ spielen mit den Wortoberflächen und versehen sie mit weiblichen Spuren: „mondin“ (S. 41), „kreuzspinnerin“ (S. 46), „närrin“ (S. 47). Das Gedicht „spieglin“ (S. 26) benennt und personifiziert magische Tätigkeiten, sie sind allesamt weiblich: „morgenseidenspinnerin/ tonmeisterin / klangmalerin / farbkomponistin / tautaucherin / lufttänzerin / spiegelzauberin …“ Die Schwingungen des eigenen (weiblichen) Körpers wahrnehmend und benennend, dehnt das lyrische Ich im Weiteren seine Wahrnehmungen auf das ganze Sein aus und definiert (umgrenzt) es mit „wort.gefühlen“ (S. 25). Die Gedichte verzichten zum größten Teil auf narrative Strukturen, selbst auf minimale narrative Sequenzen. Sehr oft ist es ein Einfall, ein Wort, das weiterentwickelt wird und sich in raumähnliche oder zeitähnliche Dimensionen hinein entfaltet (S. 61: „krähen ziehen / schreiend ihre / kreise / in den ein.fall / der nacht / rütteln mich wach / in den übergang / des lichts“). Sarclettis Gedichte erzählen nicht, sie sind eher Reflexionen, sprachliche Meditationen, freifließende Assoziationen. Der Zyklus „ge(h)dichte“ enthält viele Impressionen aus der Natur (auch aus Irland, aus Rom), so manche Meditation über den Herbst und dessen Spiegelungen im Inneren. Indirekte Artikulationen von Wahrnehmungen, Wiederholungen und Variationen zeigen: äußere und innere Jahreszeiten, die Welt als Wahrnehmung – alles existiert nur in der Sprache. Sprechend er-„dichtet“ sich das lyrische Ich seine Welt: (S. 55) „herbst / zeit / lose / zeit / herbst / lose / zeit / loser / herbst …“. Viele Gedichte des Zyklus „im krebsgang“ sprechen von Neubeginn, von Sehnsüchten, von erotischen Erwartungen. Das titelgebende Gedicht (S. 80) nennt das „ver.knotete sehnen im herz“. Sprachlich aufhorchen lassen jene Gedichte, die mit den semantischen Differenzen von beinah gleichen Wortkonstellationen, mit den Enjambements und mit den Punkten innerhalb der Wörter spielen (S. 90, 110). Über den Zeilensprung und den wortinternen Punkt hinweg können Wörter in mehrere Richtungen (vorwärts, rückwärts) verbunden und gelesen werden. Im letzten Zyklus „die königin überdauert den winter“ finden sich zeitpolitische Themen (S. 109 „tschernoshima“) und zärtliche Verse voller stiller Zuneigung (S. 114: „du / in mein herz / geweht mit / dem südwind …“). Das sehr schöne Gedicht „für sabrina“ (S. 115) vereint Momente eines Liebes- und eines Abschiedsgedichts. Sprachlich am interessantesten sind die Gedichte dort, wo sie die Regeln der Sprache am entschiedensten aufheben (S. 90: „kopf verkopfter / atem.schnee / sturm.tief / schnee.verweht“), wo die Wörter in ihre Bestandteile zerlegt und neue vielfältige Verknüpfungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, dort wo „Sinn“ mehr klanglich evoziert als deutlich gesetzt wird. Am suggestivsten sind die Gedichte dort, wo auf den Sentenzcharakter zugunsten irritierender Verbindungen verzichtet wird, wo sich die Verlaufsrichtung des Wortsinns verzweigt, wo keine Sinnkonstruktion mehr spürbar wird, sondern eine magische Weitung der Wörter, wo die offenen Dimensionen der Wörter, ihr „Flüstercharakter“, im Mittelpunkt stehen (S. 91). Dort, wo sich der Sinn hinter die Bestandteile der Wörter zurückzieht, wo keine „Botschaften“ mehr vermittelt werden, berühren und verzaubern Sarclettis leise Gedichte. Sarclettis Sprache ist sehr zurückgenommen, sie vermeidet alles Laute und Grelle. Man findet kaum strophische Strukturen, sehr oft ziehen sich die einzelnen Wörter an den Rand des Gedichts zurück und werden zu Einwortversen. In dieser Vereinzelung gewinnen die Wörter zugleich an Emphase und Stille. Die zögernden und stockenden Verse besitzen die atmosphärische Dichte eines ganzen spurenreichen Lebens. Ein anderes Ankommen Die Leistung der Literatur besteht darin, dem Gedächtnis eine Fassung zu geben, welche stets präsent hält, dass es diese nicht geben kann. (Hamid Tafazoli)
Schuchters Roman Link und Lerke erzählt von einer Reise: Von einer Reise von Zürich nach Hohenems, von der Gegenwart in die (jüdische) Vergangenheit, vom eigenen Leben in das Leben der Vorfahren und letztendlich vor allem auch von einer Reise von Link zu Lerke hin. Ariel Link, der Antiquitätenhändler und Sohn des Ludwig Link, reist von Zürich nach Hohenems, „in die Kindheit seines Vaters“ (10). Unmittelbarer Grund dafür ist ein Erbstück: ein Sekretär. Der Wunsch der Mutter von Lerke, der weiblichen Protagonistin des Romans, war es, Link als Erben einzusetzen. Das Möbelstück wird von nun an zum Verbindungselement der beiden Figuren Link und Lerke. Seine tatsächliche Bedeutung ist jedoch größer: Lerkes Mutter spricht in ihrem Testament hauptsächlich davon und deutet geheimnisvoll an: „Den Sekretär im Dachboden soll ein Herr Ariel Link, wohnhaft in Zürich, Steinerstraße 8, erhalten. Ich kannte seinen Vater gut. Der Rest ist selbsterklärend“ (48). Um dieses Geheimnis herum entfaltet sich ein vielschichtiger Text, dessen Sinn sich den Protagonisten und auch dem Leser erst nach und nach erhellt. Links Vater war mit seinen Eltern von Wien nach Hohenems gezogen. In seinen Erinnerungen wurden die Wiener Zeiten und die Stadt immer besonders lebendig: Detailliert beschrieb er seinem Sohn das Leben rund um den Franz-Josephs-Bahnhof in der Nähe seiner Wohnung, so als hätte er als Kind die meiste Zeit am Fenster gestanden und das Leben draußen beobachtet. Hohenems dagegen erhält in seinen Erzählungen kaum Platz und der Grund dafür scheint hier tatsächlich „selbsterklärend“ zu sein, wenngleich der Text Erklärungen dafür anbietet: Als Link nämlich die Stadt Hohenems betritt, „wurden [seine Schritte] ein wenig schwerer und seine Glieder träge, je näher er dem Zentrum kam. Das war auch so eine Vorstellung, die Link durch die Erinnerungen seines Vaters in den Sinn kam, die Vorstellung von einer drückenden Schwere, die einen überfiel, kaum dass man die Stadt betrat. So als lastete die Vergangenheit, der lange Schatten über dem Ort, lagerte in den Ritzen und Spalten der Mauern unter den Giebeln der Dächer, eine träge Schwere der vergangenen Tage, der verbrauchten Leben, die sich über die Jahrhunderte wie ein Schleier über die Gassen und Häuser gelegt hatten“ (13). Was anfangs mehr als „zufällige Reise“ (146) geplant war, wird zu einer Reise der besonderen Art. Zufällig oder eben durch die „kalte Hand des Schicksals“ (67) vorangetrieben scheinen sich die gesamten Geschichten im Roman zu entwickeln: „die Frage nach seinem [Links] Vater, den er langsam zu kennen glaubte, Hohenems selbst, seine Arbeit, der Sekretär, die Briefe, die sie gefunden hatten, Lerke. Natürlich Lerke.“ (146) Die Liebesbriefe zwischen Lerkes Mutter und Links Vater, die der Sekretär „freigibt“– beide waren damals verheiratet –, legen letztendlich auch die Tatsache offen, dass Link und Lerke Geschwister sind. Damit zerbrechen auch ihre sehr behutsam geschilderten Träume einer Liebesbeziehung. Neben der gegenwärtigen Geschichte der Begegnung, „[e]ine einfache Begegnung, aber dennoch sehr irritierend, berührend“ (55), wird ein zweiter Handlungsstrang entfaltet, der zurückführt in die jüdische Vergangenheit von Hohenems. Eingesetzt wird wiederum die personale Erzählperspektive, diesmal aber nicht aus der Sicht Links oder Lerkes, sondern aus der Sicht von Paul Grüninger. Der Schweizer Grenzpolizist, bearbeitet die „Akten“ und fälscht Dokumente zugunsten der jüdischen Bevölkerung, bevor er seinen Posten verliert: So ließ er 1938/39 etwa 3000 Juden in die Schweiz einreisen. In dieser zunehmend essayistisch angelegten Parallelhandlung – die sich in ihrer Form vom fiktionalen Teil des Romans abhebt – werden zahlreiche Fakten aus der NS-Zeit vermittelt und in kurzen Erzählabschnitten jüdische Lebensschicksale aufgezeigt. Beschrieben wird unter anderem die Heimkehr Fritz Roubiceks nach Wien: Trotz seiner „Erinnerungen an die Zeit im KZ Buchenwald [fühlt er] ein schönes Heimkommen“. (39) Dr. Hans Elkan dagegen kommt nicht mehr zurück. Er, der „Sohn des letzten Kultusvorstehers der jüdischen Gemeinde in Hohenems, wird am 23. Juli 1944 im KZ Theresienstadt ermordet“ (40). Wörtlich angeführt wird die Antrittsrede des Hohenemser Bürgermeisters, der dezidiert darauf hinweist, dass er die „Geschäfte der Marktgemeinde“ (131) als Nationalsozialist übernehme und nicht „als Beamter“. Die Zitate aus den Archiven – Schuchter hat für sein Buch am Stadtarchiv Dornbirn und am Jüdischen Museum Hohenems recherchiert – werden im Roman immer auch visuell durch Kursivschrift hervorgehoben. Viele Geschichten lassen sich letztlich nicht mehr nachverfolgen und der Text will diese Lücken auch nicht füllen, sondern gerade die „Kritik des menschlichen Gedächtnisses“ weiterschreiben. Das dem Buch vorangestellte Zitat von Milan Kundera verweist bereits darauf: Jene, die die Vergangenheit entstellen, umschreiben, verfälschen, die die Bedeutung eines Ereignisses aufblähen und ein anderes verschweigen, werden immer kritisiert werden; diese Kritik ist berechtigt (anders könnte es nicht sein), doch sie ist nicht sehr erheblich, wenn ihr nicht eine elementare Kritik vorausgeht: die Kritik des menschlichen Gedächtnisses als solches. Was kann es überhaupt, das Arme? Dementsprechend heißt es in der Geschichte der älteren jüdischen Frauen, die sich in die Flucht begeben: „Aber das muss man eigentlich ganz anders erzählen“ (19) bzw. „Auch das ist falsch erzählt“ und am Ende „So könnte es gewesen sein“. (20) Schuchters Roman problematisiert die gegenwärtige Verdrängung und Ausgrenzung der jüdischen Vergangenheiten, u.a. mit dem Verweis auf die Umfunktionierung der Hohenemser Synagoge zu einem Feuerwehrhaus nach dem Krieg, die Umbenennung der Judengasse in die Schweizer Straße sowie die Aussage des damaligen Stadtsekretärs Hubert Amanns, dass es in Hohenems keinen Nationalsozialismus und keinen Antisemitismus gegeben habe. Bezeichnend dafür ist auch die Begegnung Links mit der Buchhändlerin. Ihre Leichtfertigkeit gegenüber der jüdischen Vergangenheit in Hohenems wird an ihrem Dialog mit Link veranschaulicht, beispielsweise, wenn sie über die jüdische Bevölkerung so flüchtig spricht, als spräche sie gar nicht über Menschen: „Nein, keine Juden, die [sic] gibt es bei uns nicht mehr“, lächelte sie (78); im Fortgang des Gespräches meint sie unbedacht, „das ist lang her. Wir sind hier ja auch im ehemaligen jüdischen Viertel“. Angesprochen auf das Museum und auf die eigenen Erinnerungskulturen, ist ihre Antwort „[a]ber das ist mehr für die Touristen […]. Das sind Ehemalige. Ich meine, lang kann das ja nicht mehr gehen“ (79). Als sie doch irgendwann Links Verstörung spürt, rät sie ihm noch beim Hinausgehen „Das Museum ist gleich gegenüber. […] Da finden Sie Ihre [sic!] Juden“ (80). Dabei ist die Figur der Bibliothekarin selbstverständlich nicht als Einzelfall zu lesen, sondern durchaus exemplarisch zu verstehen. Und auch Hohenems bzw. Vorarlberg stehen als Beispiele für ein Land, das sein Erbe lieber verdrängt, anstatt sich damit zu ‚beschäftigen‘. Das bewusste Sich-Hinwegsetzen über Realitäten und die Resistenz gegen Aufklärung stehen im Gegensatz zu der – allerdings zu demonstrativ dargestellten – Belesenheit der Figuren und der Tatsache, dass sie fortwährend Bibliotheken und Buchhandlungen als Orte ihrer Begegnungen wählen. Link wird ständig an Philosophen und Dichter erinnert und es heißt mehrmals: „Das wusste schon Descartes“ (12), „das wusste schon Platon“ (31). Zitiert bzw. erwähnt werden in dem 153 Seiten langen Text u.a. Diderot, Cervantes, Kant, Rousseau, Humboldt, Hölderlin, Kierkegaard, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Mörike, Hoffmann, Meyrink, Brod, Sebald, Thomas Mann, Camus, Hesse, Celan und Bernhard. Am Rande des Textes wird auch der jüdische Opfermythos angesprochen und kritisiert: Erzählt wird, dass Link seinem Vater vorgeworfen habe, dass er die Ursache seines Sprachfehlers am liebsten den Nazis zugeschoben hätte, um mit seiner Geschichte hausieren gehen zu können. Die Verbindung zwischen vergangenen und gegenwärtigen Handlungssträngen und die parallele Anordnung dieser beiden Zeitebenen im Roman (Kap. 1, 3, 5 etc. erzählen die Gegenwart, Kap. 2, 4, 6 etc. die Vergangenheit) verweisen auf Kontinuitäten: Das Vergangene bestimmt in Schuchters Text stets das Gegenwärtige mit; dies beginnt bereits mit der Begegnung zwischen Link und Lerke, die Lerkes Mutter für sie geplant hat. Die zweiteilige Struktur des Romans entspricht dem Inhalt und folgt im Wesentlichen der Struktur einer Rahmennovelle: Kapitel 1 und Kapitel 15 bilden den Rahmen: Im ersten Kapitel trifft Link in Hohenems ein, das letzte endet mit Links Gedanken an die Schweiz. Link scheint sich also gedanklich auf die Rückreise nach Zürich vorzubereiten, nachdem er kurz davor – noch am selben Morgen – den Plan gefasst hat, länger in Hohenems zu verweilen. Dieser Traum zerplatzt allerdings durch Lerkes Mitteilung, dass sie seine Stiefschwester sei. Auch in der Form des Kapitelbeginns unterscheiden sich Einleitung und Schluss von den übrigen Kapiteln, indem sie nicht mit dem Namen einer Figur beginnen, sondern mit dem unpersönlichen „es“ bzw. mit der Zeitangabe „am anderen Tag“. Das letzte Kapitel setzt mit der Beschreibung der besonderen Art des Regens in Hohenems ein, wie ihn der Vater von Link immer empfunden hat. Das Motiv Regen taucht bereits im ersten Kapitel auf und wird am Ende des Romans wiederaufgenommen. Aber auch in anderen Kapiteln regnet es immer wieder und der Text verdeckt nicht, dass der Regen symptomatisch ist. Seine Unvermitteltheit und seine Beharrlichkeit in Hohenems hat der Vater dem Sohn schon damals beschrieben und Link erlebt ihn ähnlich. Der Regen scheint der Fluch der Stadt zu sein, ihre Seuche, ihre Pest. Er wird auch immer wieder personifiziert, u.a. als Stadtschreiber und gilt daher als lebendiges Mahnmal an die jüdische Vergangenheit in Hohenems. Der Hut hat ebenso Symbolcharakter: Link kann sich nicht daran erinnern, „dass sein Vater je ohne Hut außer Haus gegangen wäre“ (11) und dies hat seinen guten Grund: Hat doch sein Vater in den Hut eine einzelne Seite seines Reisepasses eingenäht, um sich damit an der Schweizer Grenze ausweisen zu können. Nicht zufällig trägt Link im letzten Kapitel diesen Hut seines Vaters. Die Kapitel dazwischen stellen stets den Namen einer Figur an ihren Anfang, zunächst abwechselnd Link und Paul Grüninger, ab dem 9. Kapitel dann Link und Lerke bzw. nur Lerke sowie Ludwig Link. Nur das fünfte, sehr zentrale und auch längere Kapitel bildet hier eine Ausnahme: In diesem Abschnitt kommt es zur behutsamen Annäherung zwischen Link und Lerke und zur Enthüllung der Erbschaft als ein Aufruf zur Beschäftigung mit der Vergangenheit. So hatte Lerkes Mutter im Testament u.a. geschrieben: „Das Haus ist dein Erbe, beschäftige dich damit“ (48). Auch wenn Link und Lerke zu Beginn das Gefühl haben, sich nicht erinnern zu wollen, über Link heißt es, „er wollte sich nicht erinnern“(14) und über Lerke, [sie] hatte sich nie für die Vergangenheit interessiert“ (135), bleibt ihnen keine andere Möglichkeit, als sich der Vergangenheit zu stellen. Der Text unterscheidet zwischen der „stattgefundenen“ und der erzählten Vergangenheit: „Wie es wirklich war oder wie es gewesen sein könnte. Wer weiß das heute noch. Ob ein Vater in Wien oder St. Gallen gebürtig ist, Jude oder nicht, ob er Seiler ist oder etwas anderes, am Ende bedeutet es nichts. Die Erinnerung an eine gelebte Kindheit wird immer auch von der Erzählung über diese Kindheit überdeckt. Am Ende bleibt von der wirklichen Kindheit nicht mehr übrig als der Satz: Sie war möglich“ (109). Allerdings erscheint an dieser Stelle die Behauptung der Bedeutungslosigkeit der Unterschiede fragwürdig, bedeuten am Ende doch beide etwas, unabhängig davon, ob es sich um die ‚tatsächlich gelebte‘ Vergangenheit handelt oder um die erzählte. Am Ende des Romans eröffnet sich für Link ein Sinn der Reise, er erklärt ihn mit „Hier beginnt etwas“ (144) und mit einem „irgendwie ganz bei sich Sein“ (146), einer „Art Eigentlichkeit“ (146), in der er von nun an leben will. Er hat das Gefühl in Hohenems angekommen zu sein und ist „voller Ideen“ (149) und Tatendrang. Dabei denkt er an ein Museum, das er mit Möbeln aus jüdischen Wohnungen bestücken will, um „eine Art Fundgrube für verloren gegangenes Leben in Hohenems“ (15) zu schaffen; Links Interesse für Möbelstücke geht nämlich weit über sein berufliches Engagement hinaus, er hat ein Auge und ein Gespür für schöne Erinnerungsstücke, und die Gegenstände wie auch die Häuser sind für ihn immer auch Träger von Geschichten. Link will mit dem Museum das Schweigen über „das andere Leben in Vorarlberg“ (150) brechen. Doch letztendlich kommt alles ganz anders und Link erkennt, „dass er vergessen hatte, dass nicht alles im Leben, nicht jede Entscheidung in seiner Macht lag“ (152). Link hat auch gelernt, dass sich der Sinn „nicht nur durch ein rein visuelles, sondern durch ein intellektuelles Verstehen [erhellt]“ (14), eine Erkenntnis, von der er anfangs „weit entfernt“ war. Der Roman von Bernd Schuchter ist vor allem eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Erinnerungskulturen sowie eine Spurensuche nach den jüdischen Vergangenheiten in Vorarlberg. Dabei entsteht ein Text voll zarter Geheimnisse, der lange verborgene, nun aber aufgedeckte, Erinnerungen erzählt. Der durchdachte Textaufbau, der sich durch eine dem Inhalt entsprechende Kapitelstruktur sowie durch Andeutungen und Symbole auszeichnet, macht den Roman spannend. Am Ende hat die Geschichte – so wie Link – auch den Leser „erwischt“ und „berührt“ (67) und man würde gerne Link und Lerke ein Stück weiter auf ihrem Weg begleiten. „Lilo im Park“ erzählt – nicht mehr und nicht weniger – die Freundschaft eines Mädchens zu einer alten Frau. Und es ist eine Geschichte, die ermutigt auch Trauriges gerade auch für Kinder zu erzählen – um es mitKindern zu besprechen und was könnte ein Bilderbuch wertvoller machen als dies… es ermutigt gemeinsam über den Tod und das Sterben nachzudenken, über Einsamkeit und Alter. Da wird nichts in Rosa getaucht und vermeintlich ‚kindgerecht‘ harmonisiert. Vielmehr ist die Welt gleich schon aus den Angeln gehoben, Lilos Eltern haben keine Zeit für sie, daher ist sie viel allein im Park unterwegs und die Frau, die sie trifft scheint sehr sonderbar, in Wirklichkeit eine Stadtstreunerin. Die zarte Freundschaft zwischen den beiden veranschaulicht Toleranz. Auf den querformatigen Buchseiten vermitteln sich durch die bunt ausgemalten Zeichnungen von Robert Göschl eine verschmitzte Leichtigkeit, ein Augenzwinkern, Humor und eine neugierige, unbeschwerte Offenheit. Die Sätze der Geschichte sind schlicht, voll leiser Klugheit und Poesie. Das Traurige und Lustige liegt ganz nahe beieinander. Die Kunst – so meine ich – liegt darin, die beiden Qualitäten so zu verknüpfen, dass beides, das Traurige und Fröhliche nebeneinander zum Klingen kommen und so feine Nuancen und Zwischentöne entstehen können. Wo auf wenigen Seiten erzählt wird, ist genaues Beobachten wichtigstes Werkzeug. Kinder selbst sind Meister des Beobachtens ihrer Umwelt, Unstimmiges in einer Geschichte würden sie sofort bemerken und beeinspruchen. Auf die Frage, wie es ihr gelingt, die kindliche Augenhöhe beim Schreiben zu halten, sagt sie: „Kinder zwingen uns Erwachsene dazu, uns zu hinterfragen. Wir dürfen genau hinhören, denn sie sind sehr empfindlich, besonders wenn es um Ungerechtigkeiten auf dieser Welt geht. Wenn ich mit meinen Kindern auf einen betrunkenen Bettler oder kranken Menschen treffe, spüre ich, wie betroffen sie das macht. Wirklich traurig. Wir Erwachsene verschließen uns oft gegen das Leid anderer, lassen es nicht zu nahe kommen, weil wir sonst etwas ändern müssten, die Gangart in unserem Leben, die Richtung. Vielleicht würde ein Wertesystem einbrechen und wir stünden da mit leeren Händen, müssten uns neu orientieren. Du hast mich gefragt, wie ich die kindliche Augenhöhe halte. Ich versuche mit ihren Augen zu sehen… dadurch, dass ich selber Kinder habe und oft deren Freunde bei uns zuhause sind, weiß ich etwas von ihrer Welt. Kinder sind neugierig und, wie du gesagt hast, gute Beobachter. Als Schreibende beobachte auch ich die Menschen rundum, die Welt, die mich umgibt, und bin neugierig.“ Kinder lesen oder hören Geschichten mit Phantasie, denken sich ihre eigenen Geschichten aus. Das macht ja auch die Qualität von guten Kinderbüchern aus, dass sie offen bleiben für die Räume der Phantasie, für die aktive eigene Erfahrung, Räume, die die Autorin offen hält mit Sätzen wie „Sie denkt, ein Zauberland. Mein Zauberland. Hier bin ich die Fee.“ Diese Räume durch gemeinsames Lesen oder Vorlesen zu erkunden, ist ein Angebot, das nicht nur die Phantasie, vielmehr auch die Sprache des Kindes fördert. Nur einer Handvoll Sätze spannen eine Sinnes- und Erfahrungswelt auf und subtil öffnen sich dabei Fenster zur Lebenswelt von Lilo und zu jener der alten Frau. Und da ist viel Platz für eigene Gedanken. Die Illustration ist die kreative Umsetzung und Antwort auf den Text, auf die Geschichte. Sie erzeugt eine eigene Wirkung, bringt von vielen möglichen gerade einen speziellen Ton zum Klingen. Auf die Frage, wie es ihr damit gegangen ist, die eigenen Sätze bebildert zu sehen, sagt sie: „Ich glaube, dass Roberts Bilder in meiner Geschichte tatsächlich neue Facetten öffnen. Er bringt Farbe, Leben und vor allem auch eine ordentliche Portion Witz hinein. Leichtigkeit … was in einem Kinderbuch niemals fehlen darf. Wir haben uns im Verlauf des Entstehungsprozesses mehrere Male getroffen. Zuerst war ja der Text da, die Bilder sind danach entwickelt worden. Robert kreierte seine Entwürfe, schickte sie mir per E-mail, fragte mich nach meiner Meinung. Ich war von allem begeistert, freute mich wie beim Ostereiersuchen, wenn du ein Nest findest. Ich versuchte ihm wenig dreinzureden, er sollte sich beim Entwickeln frei fühlen. Er verwarf vieles, was ich schon gelungen fand, und arbeitete bis zum letzten Moment, in den Nächten vor dem Abgabetermin. Robert ist sehr kritisch mit sich selbst und eigentlich nie ganz zufrieden. In dieser Hinsicht sind wir uns ähnlich.“ Themen, die die Autorin auch in ihren Erzählungen immer wieder aufgreift, kehren in „Lilo im Park“ wieder beispielsweise die Begegnung der Generationen, der Kontakt mit fremden Lebenswelten und fremden Erfahrungen. „Bei Kindergeschichten“, sagt Birgit Unterholzner abschließend, „versuche ich mit ihren Augen aufzunehmen und über das Leben zu staunen. Für Kinder vieles neu. Kinderbücher sollen und dürfen schön, unbefangen sein und Humor haben. Durch diese Art des Schreibens kann ich es auch wagen schwierigere Themen wie Krankheit, Alter, Tod oder Anderssein anzusprechen. Vermutlich gibt es kein ‚zu jung‘ für gewisse Fragen des Lebens. Oft gelingt es Kindern leichter als uns Erwachsenen, Ängste zu überwinden und mutig zu sein.“ Die alte Frau spricht vom Tod: „Irgendwann ist der rote Faden zu Ende“. Lilo ist mutig, sie will Astronautin in einem roten Anzug werden und die einsame alte Frau in ihrem Raumschiff nachhause begleiten. „Mein Rot wirst du ewig sehen“, sagt Lilo. „Denn Rot ist eine Farbe, die hört nie auf.“ Buchpräsentation am 11. April 2013 im Kleinkunsttheater Carambolage in Bozen: Christine Riccabona im Gespräch mit Birgit Unterholzner
Klaus Zeyringer/Helmut Gollner: Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650
Eigentlich schade um diesen Schulz, Bruno Schulz, der 1892 im österreichischen Kronland Galizien zur Welt kam. Nicht schade für die deutsche, wohl aber für die österreichische Literaturgeschichte. Immerhin, Doreen Daume, welche seine Erzählungssammlungen „Die Zimtläden“ und „Das Sanatorium zur Sanduhr“ neu übertragen hat, erhielt 2008 den Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung. Im Gegensatz etwa zu Kafka oder Horváth dürfte Schulz für Klaus Zeyringer und Helmut Gollner, die Verfasser vorliegender Literaturgeschichte, „keine umfassende k.u.k.-Sozialisation erfahren“ haben, außerdem schrieb er ja auf Polnisch. Er fällt also aus dem Rahmen. Wer noch? Keine Ausländer (Rose), kein Koestler, Rezzori, Sperber, Tabori, Urzidil, Ungar, Weiß; Polgar, der Kabarettist ja, nicht aber der Feuilletonist Polgar; keine Wissenschaftsprosa von Freud, Mach oder Wittgenstein; keine Südtiroler; kein Bockerer, kein Deix, Haderer oder Mahler (Nicolas), kein Schneider, Simmel oder Reimmichl, kein Haid oder Leitgeb, kein Waterhouse und fast kein Kappacher, keine Lobe, Nöstlinger, Recheis, kein Radek Knapp, keine Attwenger. Nichts von den Österreichischen Jugendkulturwochen in Innsbruck, wo sich Ernst Jandl und Friederike Mayröcker 1954 kennen lernten. Die eigene, hier ex negativo umrissene Identität in dieser Literaturgeschichte – eine fremde gibt es nicht wirklich – erfasst abgesehen von diesen (und klarerweise noch anderen) Abwesenden und abgesehen von diesem (und klarerweise noch anderem) Abwesenden dennoch viele und vieles – eher exhaustiv als selektiv übrigens. Wann beginnt die österreichische Literatur? Das darf man fragen, denn auch ein Buch mit dem Titel „Die 101 wichtigsten Fragen. Deutsche Literatur“[2] stellt diese Frage, und zwar gleich als erste. Um genau zu sein, lautet die Frage natürlich: „Wann beginnt die deutsche Literatur?“ Und: „Um genau zu sein, im März 1774, als Johann Wolfgang Goethe seinen ersten Roman mit noch nicht einmal 25 Jahren vollendet“ – ist die Antwort. Bei Zeyringer/Gollner gibt es keine derart präzise Jahresangabe, man startet Mitte des 17. Jahrhunderts mit Catharina Regina von Greiffenberg, der wichtigsten Barockdichterin deutscher Sprache. Die zweite Frage: „Womit beginnt die österreichische Literatur?“. Nein, selbstverständlich auch hier die Frage nach der „deutschen“ Literatur. Und die beginnt mit den Merseburger Zaubersprüchen. Zeyringer/Gollner beginnen mit der „Wiener Genesis“ und Frau Ava. Aber diese Anfänge nehmen gerade einmal zweieinhalb Seiten ein. Die dritte Frage lautet: „Gibt es eine österreichische Literatur?“, beziehungsweise: „Gibt es eine deutsche Literatur?“ Aber diese Frage ist keine der 101 Fragen, und genau darin liegt wohl der Grund, warum es österreichische Literaturgeschichten gibt, denn bekanntlich lässt sich die österreichische Literatur nicht recht in die Epochenschemata deutscher Literaturgeschichtsschreibung einordnen. (Woher diese im Übrigen wohl ihre Schemata nimmt?) Nolens, volens ergibt sich daraus ein patriotischer Akt, schließlich möchte man sich die eigene Literaturgeschichte nicht von anderen vorschreiben lassen. Für die Zeit nach 1945 wurde die Geschichtsschreibung österreichischer deutschsprachiger Literatur überzeugend geleistet, in Wort[3] und auch in Bild[4]. Das Hauptverdienst der vorliegenden Geschichte der österreichischen Literatur liegt also zwischen ihren spärlichen Anfängen und der Zeit vor 1945. Rund 600 Seiten umfasst die diesbezügliche sozialgeschichtliche Darstellung, die anregend erzählt wird, zweifelsohne den aktuellen Forschungsstand widerspiegelt und frei von verstaubten Ideologien ist. Das Beste am auf weiteren 200 Seiten ausgebreiteten Überblick über die österreichische Literatur nach 1945 sind dann meines Erachtens Gollners Autorenporträts, während besonders das Aktuellste etwas summarisch aufgelistet wird und man möglicherweise andernorts besser bedient ist[5]. Geschrieben ist das Buch für Kenner, die seine Materie nicht erst entdecken, sondern über sie kritisch diskutieren wollen. Hier und dort wird die jüngere heimische Generation weiter recherchieren müssen, um auf den Punkt zu kommen, etwa wenn von einer „bekannten Karikatur“ (S. 669) gesprochen wird[6] oder am äußersten Rand die „Pariser Germanistin Erika Tunner“ auftaucht (S. 760). Die hat übrigens eine Geschichte „der Literaturen deutscher Sprache seit 1945“ geschrieben.[7] Vielleicht wird, wenn die Zeit reif ist, etwas Adäquates auch für die Zeit vor 1945 unternommen, ganz im Sinn Jandls, für den die deutsche Sprache bei allem Trennenden, doch das Verbindende ist: „du wundern mein schön deutsch sprach?/sein sprach von goethen/grillparzern stiftern/sein sprach von nabeln/küßdiehandke/nicht sprach von häusselwand“. Bernhard Sandbichler [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Schulz (14.06.2013)
Joseph Zoderer: Hundstrauer. Gedichte. Mit Zeichnungen von Josef Fürpaß. 51 S.
|
|||
zoom.html - zoom.html
 Als im Jahr 1999 der von Thomas Albrich edierte Sammelband „Wir lebten wie sie“ im Innsbrucker Haymon Verlag erschien, öffnete sich die Tür zu einem historischen Raum, in dem vieles im Dunklen lag: Die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Tirol und Vorarlberg. Ihr widmeten sich damalige Studentinnen und Studenten am Innsbrucker Institut für Zeitgeschichte, legten ein Buch mit ausgewählten Biographien vor, boten eine Darstellung jüdischen Lebens in der Provinz. Sie griffen Schicksale auf, beleuchteten sie – wissend, dass dies nur ein Anfang sein könne. So erfuhr man von einer Großfamilie zwischen jüdischer Tradition und österreichischem Alltag, von einem Fremdenverkehrspionier am Arlberg, von der Ermordung eines Innsbrucker Kaufmanns im Lager Reichenau und von der Flucht eines Mädchens, die mit dem Tod im KZ Auschwitz ein schreckliches Ende fand.
Als im Jahr 1999 der von Thomas Albrich edierte Sammelband „Wir lebten wie sie“ im Innsbrucker Haymon Verlag erschien, öffnete sich die Tür zu einem historischen Raum, in dem vieles im Dunklen lag: Die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Tirol und Vorarlberg. Ihr widmeten sich damalige Studentinnen und Studenten am Innsbrucker Institut für Zeitgeschichte, legten ein Buch mit ausgewählten Biographien vor, boten eine Darstellung jüdischen Lebens in der Provinz. Sie griffen Schicksale auf, beleuchteten sie – wissend, dass dies nur ein Anfang sein könne. So erfuhr man von einer Großfamilie zwischen jüdischer Tradition und österreichischem Alltag, von einem Fremdenverkehrspionier am Arlberg, von der Ermordung eines Innsbrucker Kaufmanns im Lager Reichenau und von der Flucht eines Mädchens, die mit dem Tod im KZ Auschwitz ein schreckliches Ende fand. 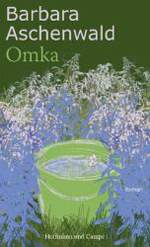 Barbara Aschenwald hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Zuvor kam der Erzählungsband „Leichten Herzens“ (2010), dann der Jürgen-Ponto-Literaturpreis, schließlich das Große Literaturstipendium des Landes Tirol: für eine junge Schriftstellerin ein fulminanter Start. „Omka“ startet mindestens so fulminant: „Es war einmal oder war auch nicht vor langer Zeit ein Mädchen mit einer Seele aus Wasser, das nicht zur Welt kommen konnte, weil seine Mutter nicht bemerkt hatte, dass sie ein Kind unter dem Herzen trug. Das Kind wurde trotzdem geboren und glaubt seitdem, es sei gar nicht da. Ich kannte die Mutter, aber das Mädchen kenne ich nicht, seine Seele war niemals auf der Welt. Sie ist noch im Bauch seiner Mutter, am Meeresgrund, und das Mädchen sucht sie./Diese Geschichte ist keine wahre Geschichte. Sie ist gemacht aus Luft und Phantasie./Aber das Mädchen gibt es wirklich, ich habe es selbst gesehen.“ Dieses Changieren zwischen wirklich und nicht wahr könnte sich motivisch durch den Roman ziehen. Aber die etwas kokette Ich-Erzählerin („Und die Geschichte beginnt so: …“) geht auf der ersten Seite unter und mit ihr der changierende Erzählgestus. Auf den nächsten Seiten des ersten Kapitels schneidet die Autorin noch die Perspektiven der beiden Hauptfiguren gegeneinander, dann übernimmt eine allwissende Erzählerin das Ruder und spult die Geschichte einer „Bindung“ – so das erste Kapitel – in 14 weiteren mehr oder minder chronologisch ab.
Barbara Aschenwald hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Zuvor kam der Erzählungsband „Leichten Herzens“ (2010), dann der Jürgen-Ponto-Literaturpreis, schließlich das Große Literaturstipendium des Landes Tirol: für eine junge Schriftstellerin ein fulminanter Start. „Omka“ startet mindestens so fulminant: „Es war einmal oder war auch nicht vor langer Zeit ein Mädchen mit einer Seele aus Wasser, das nicht zur Welt kommen konnte, weil seine Mutter nicht bemerkt hatte, dass sie ein Kind unter dem Herzen trug. Das Kind wurde trotzdem geboren und glaubt seitdem, es sei gar nicht da. Ich kannte die Mutter, aber das Mädchen kenne ich nicht, seine Seele war niemals auf der Welt. Sie ist noch im Bauch seiner Mutter, am Meeresgrund, und das Mädchen sucht sie./Diese Geschichte ist keine wahre Geschichte. Sie ist gemacht aus Luft und Phantasie./Aber das Mädchen gibt es wirklich, ich habe es selbst gesehen.“ Dieses Changieren zwischen wirklich und nicht wahr könnte sich motivisch durch den Roman ziehen. Aber die etwas kokette Ich-Erzählerin („Und die Geschichte beginnt so: …“) geht auf der ersten Seite unter und mit ihr der changierende Erzählgestus. Auf den nächsten Seiten des ersten Kapitels schneidet die Autorin noch die Perspektiven der beiden Hauptfiguren gegeneinander, dann übernimmt eine allwissende Erzählerin das Ruder und spult die Geschichte einer „Bindung“ – so das erste Kapitel – in 14 weiteren mehr oder minder chronologisch ab. Innsbruck, März 1938. Der 10-jährige Erich Weinreb ist der einzige Jude in seiner Schulklasse, doch spielt das bis zu diesem Augenblick keine Rolle. Als ein neuer, nationalsozialistisch gesinnter Lehrer die Klasse betritt, stolpert er über seinen Namen und deklariert den Buben zum Juden und Volksfeind, mit drastischen Folgen für ihn: „Ich hatte über Nacht keine Freunde mehr.“
Innsbruck, März 1938. Der 10-jährige Erich Weinreb ist der einzige Jude in seiner Schulklasse, doch spielt das bis zu diesem Augenblick keine Rolle. Als ein neuer, nationalsozialistisch gesinnter Lehrer die Klasse betritt, stolpert er über seinen Namen und deklariert den Buben zum Juden und Volksfeind, mit drastischen Folgen für ihn: „Ich hatte über Nacht keine Freunde mehr.“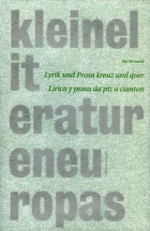 Der Mohorjeva-Hermagoras Verlag gibt seit 2010 die Reihe „kleine literaturen europas“ heraus. Das Motto der Herausgeber Karl Hren, Reinhard Kacianka und Johann Strutz ist Franz Kafkas Diktum „Das Gedächtnis einer kleinen Nation ist nicht kleiner als das Gedächtnis einer großen, es verarbeitet daher den vorhandenen Stoff gründlicher.“ Nun handelt es sich zwar nicht um die Literatur kleiner Nationen, die in den bisher drei erschienenen Büchern im Zentrum stehen, sondern vielmehr um die Literatur von Sprachgruppen und Sprachinseln Europas. So begann die Reihe 2010 mit der Publikation von Werken des walisischen Autors Emyr Humphreys (2010), der in der „großen“ Landessprache, dem Englischen, und auf Walisisch schreibt; 2011 folgte der Band „Resia. Der Gesang der Erde“ mit Gedichten von Rino Chinese, Silvana Paletti und Renato Quaglia aus dem Resiatal, einem Seitental des friulianischen Kanaltals, in dem sich eine eigenständige slowenische kulturelle Tradition bewahrt hat. Ebenso 2011 erschien „Lyrik und Prosa kreuz und quer / Lirica y prosa da piz a cianton“, in dem ein Großteil der bisher erschienenen Werke der ladinischen Autorin Rut Bernardi versammelt sind. Der Band enthält neben ihrem ersten Roman „Briefe ins Nichts“, der 1996 auf ladinisch mit dem Titel „Lëtres en te fol“ und 2003 zweisprachig erschienen ist sowie ihren „Gherlanda de sunëc: Antenates – Sonettenkranz der Ahnen“ weitere Gedichte, Erzählungen und Essays. Die Lyrik ist im vorliegenden Buch auf deutsch und ladinisch abgedruckt, wohingegen die Prosatexte sowie das Theaterstück „Abgesang für die Letzte ihrer Art – Romana Sellana ist nicht mehr“ ausschließlich auf deutsch wiedergegeben sind. Als Übersetzer scheinen Rut Bernardi sowie Hans-Georg Grüning auf, der auch der Verfasser des sehr aufschlussreichen Nachworts ist. Auch dies ist ein Anspruch der Reihe: die Texte von AutorInnen, die in einer kleinen Sprache schreiben, in die „große“ Sprache zu holen, um sie so einem größeren Publikum erschließ- und lesbar zu machen. Rut Bernardi nimmt in einem Beitrag des Bandes selbst fundiert Stellung dazu; so meint sie, es sei für in einer Kleinsprache Schreibende meistens nötig, selbst ÜbersetzerInnen der eigenen Texte zu sein, einerseits aus rein pragmatischen Gründen, um größerer Publikationsmöglichkeiten willen, zum anderen, um nicht in der „Geheimschrift“, die nur von wenigen rezipiert werden kann, gefangen zu bleiben.
Der Mohorjeva-Hermagoras Verlag gibt seit 2010 die Reihe „kleine literaturen europas“ heraus. Das Motto der Herausgeber Karl Hren, Reinhard Kacianka und Johann Strutz ist Franz Kafkas Diktum „Das Gedächtnis einer kleinen Nation ist nicht kleiner als das Gedächtnis einer großen, es verarbeitet daher den vorhandenen Stoff gründlicher.“ Nun handelt es sich zwar nicht um die Literatur kleiner Nationen, die in den bisher drei erschienenen Büchern im Zentrum stehen, sondern vielmehr um die Literatur von Sprachgruppen und Sprachinseln Europas. So begann die Reihe 2010 mit der Publikation von Werken des walisischen Autors Emyr Humphreys (2010), der in der „großen“ Landessprache, dem Englischen, und auf Walisisch schreibt; 2011 folgte der Band „Resia. Der Gesang der Erde“ mit Gedichten von Rino Chinese, Silvana Paletti und Renato Quaglia aus dem Resiatal, einem Seitental des friulianischen Kanaltals, in dem sich eine eigenständige slowenische kulturelle Tradition bewahrt hat. Ebenso 2011 erschien „Lyrik und Prosa kreuz und quer / Lirica y prosa da piz a cianton“, in dem ein Großteil der bisher erschienenen Werke der ladinischen Autorin Rut Bernardi versammelt sind. Der Band enthält neben ihrem ersten Roman „Briefe ins Nichts“, der 1996 auf ladinisch mit dem Titel „Lëtres en te fol“ und 2003 zweisprachig erschienen ist sowie ihren „Gherlanda de sunëc: Antenates – Sonettenkranz der Ahnen“ weitere Gedichte, Erzählungen und Essays. Die Lyrik ist im vorliegenden Buch auf deutsch und ladinisch abgedruckt, wohingegen die Prosatexte sowie das Theaterstück „Abgesang für die Letzte ihrer Art – Romana Sellana ist nicht mehr“ ausschließlich auf deutsch wiedergegeben sind. Als Übersetzer scheinen Rut Bernardi sowie Hans-Georg Grüning auf, der auch der Verfasser des sehr aufschlussreichen Nachworts ist. Auch dies ist ein Anspruch der Reihe: die Texte von AutorInnen, die in einer kleinen Sprache schreiben, in die „große“ Sprache zu holen, um sie so einem größeren Publikum erschließ- und lesbar zu machen. Rut Bernardi nimmt in einem Beitrag des Bandes selbst fundiert Stellung dazu; so meint sie, es sei für in einer Kleinsprache Schreibende meistens nötig, selbst ÜbersetzerInnen der eigenen Texte zu sein, einerseits aus rein pragmatischen Gründen, um größerer Publikationsmöglichkeiten willen, zum anderen, um nicht in der „Geheimschrift“, die nur von wenigen rezipiert werden kann, gefangen zu bleiben.  Oswald Eggers neues Buch „Euer Lenz“ ist, wie schon seine vorhergehenden Bücher, ein Buch zum Anschauen und zum Lesen. Die optische Gestaltung des Bandes ist sehr schön. Der vom Autor selbst gemeinsam mit Nina Knapitsch gestaltete Satz verwandelt die Seiten in harmonische, elegante Wort-Bild-Kompositionen. Die Wortfelder, die leeren Flächen und die feinen, filigranen Zeichnungen, die an Illustrationen in Lehrbüchern der Botanik, Zoologie und Geologie erinnern, sind Gestaltungselemente eines Buch-Gesamtkunstwerks, das nicht nur mit dem semantischen Aspekt der Sprache arbeitet, sondern auch mit ihrem materiell-visuellen und (im Idealfall) auch mit ihrem klanglichen Aspekt; d.h. „Euer Lenz“ sollte nicht nur gelesen und betrachtet, sondern auch vernommen werden. Eggers Sprache ist − laut vorgetragen − ein Klangerlebnis.
Oswald Eggers neues Buch „Euer Lenz“ ist, wie schon seine vorhergehenden Bücher, ein Buch zum Anschauen und zum Lesen. Die optische Gestaltung des Bandes ist sehr schön. Der vom Autor selbst gemeinsam mit Nina Knapitsch gestaltete Satz verwandelt die Seiten in harmonische, elegante Wort-Bild-Kompositionen. Die Wortfelder, die leeren Flächen und die feinen, filigranen Zeichnungen, die an Illustrationen in Lehrbüchern der Botanik, Zoologie und Geologie erinnern, sind Gestaltungselemente eines Buch-Gesamtkunstwerks, das nicht nur mit dem semantischen Aspekt der Sprache arbeitet, sondern auch mit ihrem materiell-visuellen und (im Idealfall) auch mit ihrem klanglichen Aspekt; d.h. „Euer Lenz“ sollte nicht nur gelesen und betrachtet, sondern auch vernommen werden. Eggers Sprache ist − laut vorgetragen − ein Klangerlebnis. FORT SCHREIBUNG nennt Christine H. Huber ihren neuen Lyrikband und es geht darin nicht nur um das Weiterschreiben, um ein schreibendes Lebenszeichen, sondern es geht auch um den Wunsch sich wegzuschreiben, um die Flucht hinein in fremde Welten, um die Flucht ins Gedicht.
FORT SCHREIBUNG nennt Christine H. Huber ihren neuen Lyrikband und es geht darin nicht nur um das Weiterschreiben, um ein schreibendes Lebenszeichen, sondern es geht auch um den Wunsch sich wegzuschreiben, um die Flucht hinein in fremde Welten, um die Flucht ins Gedicht. In seinem jüngsten Buch „Sieben“ erzählt Otto Licha die Geschichte zweier Freunde, von ihrer Kindheit bis zum Mannesalter. Der eine, Alessandro, begabt, intelligent, erfolgreich, der andere, Maximilian, durchschnittlich, psychisch krank und untalentiert. Alessandro weiß schon als Kind, dass er Bankdirektor werden will, und verfolgt dieses Ziel mit einer unbeirrbaren Strebsamkeit. Seiner Umgebung nötigt er für sein mit Leichtigkeit geführtes Leben Bewunderung ab. Das Erlernen von Sprachen, Fußballspielen, das Lösen von Sudokus, die Schule, das Studium – all das gelingt ihm ohne jede Mühe. Maximilian dagegen verbringt sein Leben stets einen Schritt hinter oder neben Alessandro. Dieser Freundschaft zuliebe verzichtet Alessandro darauf, in die Jugend-Mannschaft von Manchester United einzutreten, was dem Talentierten angeboten wurde. Aus einem gemeinsamen Trainingslager rührt seine Bekanntschaft mit den späteren Fußballgrößen Paul Scholes, Steve Gerrard, Ryan Giggs und Nani. Nur was das Heiraten und Familiengründen betrifft, ist Maximilian Alessandro einen Schritt voraus.
In seinem jüngsten Buch „Sieben“ erzählt Otto Licha die Geschichte zweier Freunde, von ihrer Kindheit bis zum Mannesalter. Der eine, Alessandro, begabt, intelligent, erfolgreich, der andere, Maximilian, durchschnittlich, psychisch krank und untalentiert. Alessandro weiß schon als Kind, dass er Bankdirektor werden will, und verfolgt dieses Ziel mit einer unbeirrbaren Strebsamkeit. Seiner Umgebung nötigt er für sein mit Leichtigkeit geführtes Leben Bewunderung ab. Das Erlernen von Sprachen, Fußballspielen, das Lösen von Sudokus, die Schule, das Studium – all das gelingt ihm ohne jede Mühe. Maximilian dagegen verbringt sein Leben stets einen Schritt hinter oder neben Alessandro. Dieser Freundschaft zuliebe verzichtet Alessandro darauf, in die Jugend-Mannschaft von Manchester United einzutreten, was dem Talentierten angeboten wurde. Aus einem gemeinsamen Trainingslager rührt seine Bekanntschaft mit den späteren Fußballgrößen Paul Scholes, Steve Gerrard, Ryan Giggs und Nani. Nur was das Heiraten und Familiengründen betrifft, ist Maximilian Alessandro einen Schritt voraus.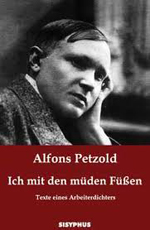 Anlässlich des 90.Todestages von Alfons Petzold (1882-1923) veranstalteten der Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen und das Renner-Institut Tirol am 11. April 2013 in der Buchhandlung Haymon in Innsbruck eine Lesung. Es las: Ludwig Roman Fleischer (geb. 1952 in Wien), ein Autor, der Jahr für Jahr sich vornimmt, einen neuen Roman auf den Markt zu bringen, um auf diesem Weg immer neue Sittenbilder, am Ende vielleicht ein einziges riesiges Sittenbild aus Österreich zu vermitteln; ein Autor, der auch als Verleger und Herausgeber hervorgetreten ist, u. a. als Herausgeber Petzolds: Alfons Petzold, Ich mit den müden Füßen Texte eines Arbeiterdichters, erschienen im Klagenfurter Sisyphus Verlag.
Anlässlich des 90.Todestages von Alfons Petzold (1882-1923) veranstalteten der Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen und das Renner-Institut Tirol am 11. April 2013 in der Buchhandlung Haymon in Innsbruck eine Lesung. Es las: Ludwig Roman Fleischer (geb. 1952 in Wien), ein Autor, der Jahr für Jahr sich vornimmt, einen neuen Roman auf den Markt zu bringen, um auf diesem Weg immer neue Sittenbilder, am Ende vielleicht ein einziges riesiges Sittenbild aus Österreich zu vermitteln; ein Autor, der auch als Verleger und Herausgeber hervorgetreten ist, u. a. als Herausgeber Petzolds: Alfons Petzold, Ich mit den müden Füßen Texte eines Arbeiterdichters, erschienen im Klagenfurter Sisyphus Verlag. Eine menschliche, sich um Reflexion und Auseinandersetzung bemühende Beziehung zu schwierigen Vergangenheiten ist es, von der Anna Rottensteiner in ihrem Buch erzählt.
Eine menschliche, sich um Reflexion und Auseinandersetzung bemühende Beziehung zu schwierigen Vergangenheiten ist es, von der Anna Rottensteiner in ihrem Buch erzählt. Der Titel such.spuren wirft Fragen auf und enthüllt zugleich das poetologische Programm: Handelt es sich um ein Kompositum? Sind es zwei getrennte Wörter? Holt der Punkt die Wortelemente in eine große Nähe, setzt er sie in Beziehung zueinander oder markiert er eine mögliche Nicht-Zusammengehörigkeit? Hebt er eine enge Verbindung auf? Signalisiert er ein Zögern? Stellt er die Wortbeziehung in Frage?
Der Titel such.spuren wirft Fragen auf und enthüllt zugleich das poetologische Programm: Handelt es sich um ein Kompositum? Sind es zwei getrennte Wörter? Holt der Punkt die Wortelemente in eine große Nähe, setzt er sie in Beziehung zueinander oder markiert er eine mögliche Nicht-Zusammengehörigkeit? Hebt er eine enge Verbindung auf? Signalisiert er ein Zögern? Stellt er die Wortbeziehung in Frage? „Es war ein anderes Ankommen. Mehr eine Vorstellung als ein wirkliches Erlebnis“ (9).
„Es war ein anderes Ankommen. Mehr eine Vorstellung als ein wirkliches Erlebnis“ (9). Das Erscheinen des ersten Erzählbandes von Birgit Unterholzner, „Die Blechbüchse“, liegt bereits sieben Jahre zurück, vor zwei Jahren erschien ihr Debütroman „Flora Beriot“, im Herbst wird der zweite Roman „Für euch, die ihr träumt“ in der edition laurin erscheinen. Viele ihrer Texte sind in Anthologien publiziert, manche wurden auch im Rundfunk gelesen. Lesungen und Teilhabe an literarischen Initiativen etwa die Betreuung der Literaturseite in den „Dolomiten“ sowie auch ihre Schreibwerkstätten für Jugendliche im Literaturhaus am Inn zeigen, dass sie längst eine erfahrene und präsente Autorin ist. Im Frühjahr überraschte Birgit Unterholzner mit ihrem ersten Kinderbuch „Lilo im Park“. Ein Kinderbuch ist eine spezielle Herausforderung, ist verbunden mit einem anderen Verlagsumfeld, mit einer anderen Zielgruppe. Die bildliche Vorstellungskraft und Zusammenarbeit mit dem Illustrator sind wichtig. Die Illustration, die Bilder sind die zweite Stimme. „Lilo im Park“ ist ein gelungenes Projekt. Am 11. April wurde es im Kleinkunsttheater Carambolage in Bozen präsentiert. Begleitet wurde die Präsentation von der stimmungsvollen Musik des Akkordeonspielers und Musik-Perfomers Matteo Facchin.
Das Erscheinen des ersten Erzählbandes von Birgit Unterholzner, „Die Blechbüchse“, liegt bereits sieben Jahre zurück, vor zwei Jahren erschien ihr Debütroman „Flora Beriot“, im Herbst wird der zweite Roman „Für euch, die ihr träumt“ in der edition laurin erscheinen. Viele ihrer Texte sind in Anthologien publiziert, manche wurden auch im Rundfunk gelesen. Lesungen und Teilhabe an literarischen Initiativen etwa die Betreuung der Literaturseite in den „Dolomiten“ sowie auch ihre Schreibwerkstätten für Jugendliche im Literaturhaus am Inn zeigen, dass sie längst eine erfahrene und präsente Autorin ist. Im Frühjahr überraschte Birgit Unterholzner mit ihrem ersten Kinderbuch „Lilo im Park“. Ein Kinderbuch ist eine spezielle Herausforderung, ist verbunden mit einem anderen Verlagsumfeld, mit einer anderen Zielgruppe. Die bildliche Vorstellungskraft und Zusammenarbeit mit dem Illustrator sind wichtig. Die Illustration, die Bilder sind die zweite Stimme. „Lilo im Park“ ist ein gelungenes Projekt. Am 11. April wurde es im Kleinkunsttheater Carambolage in Bozen präsentiert. Begleitet wurde die Präsentation von der stimmungsvollen Musik des Akkordeonspielers und Musik-Perfomers Matteo Facchin.






 „Schulz developed his extraordinary imagination in a swarm of identities and nationalities; a
„Schulz developed his extraordinary imagination in a swarm of identities and nationalities; a  Joseph Zoderer ist ein Prosaschriftsteller durch und durch, auch noch in seinen Gedichten. Er denkt nicht als Lyriker, er schreibt als einer, der Klarheit schaffen will. Auf Mehrdeutigkeiten verzichtet er, Worte werden zu Gebrauchsartikeln, die sich einer deutlichen Botschaft unterzuordnen haben. Kein Zweifel an der Sprache, kein Rhythmus, keine innere Kraft, der Welt einen eigenen Ton abzuringen. Es geht weitgehend alltäglich zu , jedes Gedicht ein Satz, der nur durch seine Zeilenbrüche daran gemahnt, als Lyrik genommen zu werden.
Joseph Zoderer ist ein Prosaschriftsteller durch und durch, auch noch in seinen Gedichten. Er denkt nicht als Lyriker, er schreibt als einer, der Klarheit schaffen will. Auf Mehrdeutigkeiten verzichtet er, Worte werden zu Gebrauchsartikeln, die sich einer deutlichen Botschaft unterzuordnen haben. Kein Zweifel an der Sprache, kein Rhythmus, keine innere Kraft, der Welt einen eigenen Ton abzuringen. Es geht weitgehend alltäglich zu , jedes Gedicht ein Satz, der nur durch seine Zeilenbrüche daran gemahnt, als Lyrik genommen zu werden.