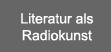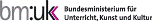Margherita Spiluttini – Fotografische Fährten ( Christiane Zintzen )
Camera Austria 103 – 104 | 2008 ( → English version )
Augen, meine lieben Fensterlein,
Gebt mir schon so lange holden Schein,
Lasset freundlich Bild um Bild herein:
Einmal werdet ihr verdunkelt sein !
I.
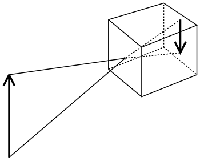 “Lasset Bild um Bild herein “: Was – mag sich Mancher fragen – sollen diese lieblich. naiven und in der Prosodie hinkenden Verse ausgerechnet in einem Text über Margherita Spiluttini, einer der führenden (Architektur-) Fotografinnen Europas ? – Das – den künstlerischen Gesichtssinn in Analogie zur fotografischen Blende setzende – Zitat mag vornehmlich signalisieren, dass unser assoziativ- chronologischer Pfad durch das Oeuvre Margherita Spiluttinis eher der vorsichtig- freundlichen Begehung eines weit reichenden Werkgeländes ähnelt denn einem Spitzentanz der Superlative. Über Probleme und Konnexe zum fotografischen Diskurs, zur spezifischen Methode wurde an anderer Stelle mehrfach gehandelt.¹
“Lasset Bild um Bild herein “: Was – mag sich Mancher fragen – sollen diese lieblich. naiven und in der Prosodie hinkenden Verse ausgerechnet in einem Text über Margherita Spiluttini, einer der führenden (Architektur-) Fotografinnen Europas ? – Das – den künstlerischen Gesichtssinn in Analogie zur fotografischen Blende setzende – Zitat mag vornehmlich signalisieren, dass unser assoziativ- chronologischer Pfad durch das Oeuvre Margherita Spiluttinis eher der vorsichtig- freundlichen Begehung eines weit reichenden Werkgeländes ähnelt denn einem Spitzentanz der Superlative. Über Probleme und Konnexe zum fotografischen Diskurs, zur spezifischen Methode wurde an anderer Stelle mehrfach gehandelt.¹
“Lasset freundlich Bild um Bild herein”: Der Mensch als Schauender. Der Künstler als Kamera. Gottfried Keller hat diese Verse einer ‘visuellen Poesie’ avant la lettre gedichtet. Derselbe Gottfried Keller, der mit dem Grünen Heinrich ein beredtes Zeugnis abgab für die Krise realistischer Repräsentation. Dieser merkwürdig moderne und zerrüttete Entwicklungsroman ist durch und durch aus Motiven des Augenscheins gewebt: Sehen als Erkennen, konzentriertes Fokussieren als allmählicher Verstehensprozess und endlich die Transformation polyperspektivischer Eindrücke in der Dunkelkammer des mind’s eye ( mind’s I, homophon nach Vladimir Nabokov ) zur konkreten ästhetischen Manifestation.
Schliesslich: Schauen als Glück. Nicht ‘Hingucken‘, sondern eben jene dem Betrachtungsgegenstand sich erbaulich hingebende ‘Schau ‘, welche der ontologisch- existenzielle ( nach zwei Weltkriegen ins Ahistorische geflohene ) Kunstdiskurs der 1950er Jahre usurpierte und solcherart für Jahrzehnte verdarb.
Schauen als Glück. Dies gilt nicht nur für das die Konfrontation mit dem ‘Naturschönen’ des Idealismus, sondern auch für den kairos der Begegnung mit einem ästhetischen Artefakt. Erhellung und “Choc” ( Walter Benjamin ), jähe Erkenntnis, Sinnlichkeit und Gewissheit.
Die Fotografie ist die klassische Metapher für diesen kairos. Erfasst mit der Hand am Auslöser. Stillgestellt und übertragen auf lichtempfindliches Material. Eine Materialisierung, welche ihrerseits sofort Gegenstand wird und damit Geschichte. Als maximal selektiver Abdruck einer Szene und als still dem unablässigen Kontinuum der Zeit entrissen, verlässt die Fotografie in der Sekunde ihres Entstehens das, was sie bildlich fasst. Nun zieht das sekundenkurz der Matrix des Films Aufgeprägte ( empreinte ) seine eigene Spur ( trace ).
|||
II.
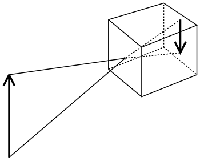 Seit den frühen 1980er Jahren legt Margherita Spiluttini solche fotografischen Fährten: urbane Situationen, bauliche Charaktere, Verfasst- und Beschaffenheit von Landschaft. Implizit bildnerisch wie dezidiert prononciert bleibt stets der Hinweis auf den Eigensinn ihrer Sicht der Dinge, das produktive Potential der Subjektivität. Und dies – nota bene – im Manövrieren mit einem Medium, welches nach wie vor Indiz, Ikone und Fetisch des ‘Objektiven’ darstellt. Zwischen der Realität baulicher Artefakte und dem fotografischen “Realitätseffekt” ( Roland Barthes ) hat “The Woman with the Camera ” ( frei nach Dziga Vertov ) über die Grenzen der Genres hinweg den Spielraum der Architekturfotografie eminent erweitert.
Seit den frühen 1980er Jahren legt Margherita Spiluttini solche fotografischen Fährten: urbane Situationen, bauliche Charaktere, Verfasst- und Beschaffenheit von Landschaft. Implizit bildnerisch wie dezidiert prononciert bleibt stets der Hinweis auf den Eigensinn ihrer Sicht der Dinge, das produktive Potential der Subjektivität. Und dies – nota bene – im Manövrieren mit einem Medium, welches nach wie vor Indiz, Ikone und Fetisch des ‘Objektiven’ darstellt. Zwischen der Realität baulicher Artefakte und dem fotografischen “Realitätseffekt” ( Roland Barthes ) hat “The Woman with the Camera ” ( frei nach Dziga Vertov ) über die Grenzen der Genres hinweg den Spielraum der Architekturfotografie eminent erweitert.
Uns als Betrachtenden ermöglicht Margherita Spiluttinis Werk ein erhellendes Sehen. Wir finden bei ihr die scheinbar so selbst- verständliche Realität in Fassungen und Formulierungen, nach welchen wir nie zu suchen wussten. Images iluminés, deren Entschiedenheit uns momentan ein- und nachhaltig er- leuchtet: Hinter die Sekunde ihres Gesehen- Habens können wir nicht zurück. Splittinis Bildfindungen haben uns die Augen geöffnet. So, wie uns Johann Sebastian Bachs Fugen die Ohren aufgetan haben. Oder Miles Davis’ “Bitches Brew “.
Drei Werkgruppen mögen daran erinnern, dass und wie Margherita Spiluttinis fotografisches Werk uns das Sehen lehrte. Da wäre 1.) die fotografische Bestandsaufnahme für und mit Dietmar Steiners Führer “Architektur in Wien ” ( 1984 ). Da sind 2.) die in der Ausstellung “Nach der Natur ” 2002 im Technischen Museum Wien versammelten Landschaftsaufnahmen. Da gibt es 3.) das von Margherita Spiluttini nach multiplen Kriterien komponierte Katalog- Kunstwerk “räumlich | spacious “.²
Erschienen als Komplement zur Ausstellung “Atlas Austria “, welche ihrerseits als temporäre Installation im Architekturzentrum Wien der Fotografie ein raumgreifend- sinnliches Aggregat assemblierte:³ Die von Nicole Six und Paul Petritsch originell und hintersinnig arrangierten Betrachtungsstationen für verschiedene Werkgruppen – gezeigt ausschliesslich via Dia- Projektion – ermöglichten eine entspannte Situation der mise en abyme. Die meist in Form des Papierprints wahrgenommene Fotografie wurde so auf ihr Wesen als Lichtbild zurückgeführt und der museale Raum in eine Dunkelkammer verwandelt. Dieser ( im Dialog mit der Künstlerin eingerichteten ) temporären Installation danken wir erhebliche Einblicke in den raum- zeitlichen Vektor von Margherita Spiluttinis fotografischem Dispositiv.
|||
III.
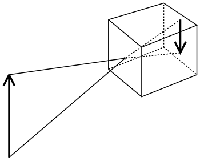 “300 sehenswerte Bauten“: Listig spielt der Untertitel des 1984 von der Österreichischen Gesellschaft für Architektur herausgegebene Brevier “Architektur in Wien ” mit dem konservativ- affirmativen Begriff des Sehens- Werten.⁴ Geschürzt zu 14 topographischen Knoten und in je chronologischer Reihung treten Wiens Bauwerke in Text und Bild auf den Plan. In ihrer strikt seriellen Anordnung erstellen die en face – Gebäudeportaits eine Typologie von Proportionen, Idiomen und Formen.
“300 sehenswerte Bauten“: Listig spielt der Untertitel des 1984 von der Österreichischen Gesellschaft für Architektur herausgegebene Brevier “Architektur in Wien ” mit dem konservativ- affirmativen Begriff des Sehens- Werten.⁴ Geschürzt zu 14 topographischen Knoten und in je chronologischer Reihung treten Wiens Bauwerke in Text und Bild auf den Plan. In ihrer strikt seriellen Anordnung erstellen die en face – Gebäudeportaits eine Typologie von Proportionen, Idiomen und Formen.
Von Dietmar Steiner: Zu jedem Bauwerk ein knapper Paragraph. Text, Daten, Kommentar. Von Margherita Spiluttini: Je ein Bild. Korrekt formuliert: eine Auswahl von 300 aus insgesamt 2.500 Aufnahmen von 500 Objekten, sämtlich unternommen in den Jahren 1982 bis 1984. Dieser beeindruckende quantitative Aspekt soll hier allerdings nicht das qualitative Unterfangen der konsequenten Bestandsaufnahme eines architektonischen Stadtkörpers verdecken. Pro Seite: Fünf Gebäude, fünf Legenden, fünf Prints. Schwarzweiss gehalten, in gleicher Grösse parataktisch angeordnet, mag eine solche Reihung an die Physiognomik des späten 19, Jahrhunderts erinnern. Als gelte es – ähnlich der Galton’schen “Durchschnittsbilder” – eine Art ‘architektonische Mimik ‘ Wiens zu dokumentieren.⁵
Die Wahrnehmung, an Wiens reale und symbolische Grössenordnungen gewohnt, gibt sich schockiert: Der ausgreifenden und respektheischenden Kubatur von Macht wird kein Quäntchen mehr Raum zugewiesen als dem vermeintlich bescheidenen Zweckbau und dessen funktionaler Form. Solcherart macht Architektur in Wien den demokratischen – wenn nicht gar antiautoritären – Geist der 60er und 70er fruchtbar für einen Katalog des Vorhandenen. Zugleich präpariert dieses Brevier der eben anhebenden Postmoderne ein Inventar: Einen Katalog bestehender Formen, Figuren und Fantasien als Grundlage für zukunftsträchtiges Bauen im Kontext eines historisch überdeterminierten Stadtraumes.
Wie Bodo Hells 1983 erschienene “Stadtschrift “⁶ mochten Manche den Band Architektur in Wien als Indiz ansehen für ein neues Bewusstsein von Urbanität: Eine Urbanität, die in den frühen 1980ern aufregend rau und roh sein konnte. Eine Urbanität, welche die Stadtlandschaft ansah als einen Raum für Exkursionen in die noch nicht völlig durchformte Makro- und Mikrostruktur. Die Glättung und Färbung der Oberflächen – sie sollten erst später erfolgen. Ebenso wie der Neue Narzissmus, die Städtekonkurrenz und die Architektur des Spektakels.
Mit nie nachlassender Neugier hat Margherita Spiluttinis Kamera in der Folge auch die jüngeren Bauformen und jüngsten Raumgestaltungen begleitet: kein namhafter österreichischer – wenn nicht gar europäischer – Architekt ( feminin | maskulin | Singular | Plural ) dessen Werk sie nicht dokumentiert hätte. Spiluttinis dezidiert aktive und oft subjektiv artikulierte Auseinandersetzung mit Form, Formierung und Formulierung von Raum via Architektur ist nicht lediglich im Sinne einer visuellen Mitschrift oder einer plan dokumentarischen Indexierung zu werten, sondern als Teil eines von ihr wesentlich mitgeprägten Prozesses: nämlich Brücken zu schlagen über den Graben zwischen angewandter ( “Auftrags-” ) und künstlerischer ( “freier” ) Fotografie.
|||
IV.
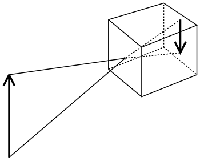 Szenenwechsel: Ausstellung und Werkkomplex “Nach der Natur “: Zu sehen 2002 im Technischen Museum Wien. Plus Katalog. Untertitel: Konstruktionen der Landschaft.⁷
Szenenwechsel: Ausstellung und Werkkomplex “Nach der Natur “: Zu sehen 2002 im Technischen Museum Wien. Plus Katalog. Untertitel: Konstruktionen der Landschaft.⁷
Im Unterschied zu Architektur in Wien, wo die grossstädtischen Gebäude- Portraits ihre Objekte in strikter Zentralperspektive fokussieren, befinden wir uns nun in den Weiten einer archaischen, vor- und inhumanen Hochgebirgs- Landschaft. Die am menschlichen Mass und seinen Zweckdienlichkeiten orientierte Wohn-, Funktions- und Repräsentationsarchitektur weicht einer ‘wilden’ Abfolge ungefüger Formen, allenfalls gebändigt durch basale Eingriffe zur verkehrstechnischen Überwindung der nicht aus dem Wege zu räumenden Restnatur sowie deren präventiver Bändigung.
Zu Zeiten von revolutionärer Romantik, Zivilisationsverdruss und Nationalismus als Naturform des ‘Erhabenen ‘ glorifiziert, im Fall von Naturkatastrophen als befremdlich Undomestiziertes perhorresziert, hat nicht zuletzt die Tourismuswirtschaft alpine Abstraktionen in saisonale Kader montiert.
Dem von der Ideologie ‘Natur‘ unbefangenen Auge bietet sich dahingegen eine alpine Kulturlandschaft dar, welche, salopp gesprochen “einfach so herum liegt”. Rundherum. Allerdings durch und durch erschlossen. Ästhetisch muss diese Welt aus Stein und Zeit mit ihren geologischen Geschieben, ihrem Ineinander von Faltungen und Halden, Abbrüchen und Aufbauten zunächst wirr wirken. Will die Photographie weiter gehen als es die pittoresken Perspektiven der sogenannten scenic routes oder view points definieren, muss sie sich in die Rolle der teilnehmenden Beobachtung begeben.
In geduldiger ( und in situ jedes Mal neu erfolgender ) Auseinandersetzung mit den paraten Attitüden von Pathos | Idylle, Dekor | Eigentlichkeit wird der Werkkomplex “Nach der Natur” zur skeptischen Replik auf den Abbild- Realismus, welcher die Fotografie als bloss mechanisch reproduzierte Analoge zur ‘Wirklichkeit‘ begreift. Nicht zufällig fasst die – in hohem Masse sprachbegabte und dem Wörtlichen anhangende – Fotografin das polymorphe Bündel entsprechender Reflexionen in einen doppeldeutigen Begriff: Zum Einen wird der terminus technicus für die alte Lehrdisziplin des Zeichnens nach der Natur evoziert. Anderseits ist “Nach der Natur” als ein post naturam zu verstehen: ‘Natur ‘ ist – seit sie so heisst – ohne kulturelle Durchformung nicht zu haben.
Im Wissen um die Aporien jeder Annäherung an ‘Natur‘ fasst Margherita Spiluttinis rahmender Blick Szenen und Situationen nach den klassischen Regeln der Komposition. Dramatische Diagonale. Suggestive Symmetrie. Wärme der Flächen mächtiger Betonwände und welliger Wiesengründe. Im Kontrast zu den kalten Falten, Kanten und Graten von Felswerk und Steinbruch.
Kulturbauten “im Gebirg“: Trassen, Terrassen, Tunnels, Röhren, Kanäle. Hier ist die Werkstatt des oft anonym bleibenden Ingenieurs und Baumeisters. Kaum je betritt der “Autor-Architekt” das Terrain. An diesem gut sichtbaren Punkt berühren wir das Leitmotiv von konstruktivem Ingenium im Unterschied zum expressiv Künstlerischen. Ein eminentes Thema, spricht man von Margherita Spiluttini, Tochter eines Gebirgs- Baumeisters, geschult an den bildgebenden Verfahren der Medizin.
Unwillkürlich mögen uns manche Anmutungen dieser höchst körperhaften Landschaften in die assoziative Nähe zur Pathologie katapultieren. Das Gebirge als Intensivstation. Tunnel- Röhren, Abfluss- Systeme wie Katheter. Klaffende Steinbrüche. Leitungen, Läufe und Schläuche wie Adern. Serpentinen, Lawinenverbauungen wie Bandagen. Brücken als Krücken und Stützen.
Allerdings drängt sich dieses Paradigma nicht notwendig auf. Wer es erblickt, sieht dies nicht aufgrund einer demonstrativen Agenda. Sondern im diskreten Setting und stillen Spiel der Linien und Formen, Strukturen und Texturen.
|||
V.
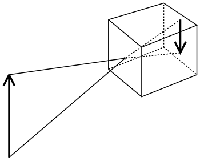 Wieder stossen wir auf Wort und Wert von ‘Spiel‘ und ‘Spielraum‘. Spielraum zwischen den künstlerischen Ressourcen von Ratio und Intuition. Spielraum zwischen dem Subjekt hinter der Kamera und dem Objekt davor. Unter dem schwarzen Tuch der Sucherabdeckung bleibt die Künstlerin während ihres visuellen Dialoges mit dem Gegenstand auf der Mattscheibe der Grossformat- Linhof verborgen. – Black Box ? Beichtstuhl ? Traumdeutung ? – Wie auch immer der uneinsehbare Spielraum beschaffen sein mag: Hier jedenfalls flektiert sich das Abbild zum Inbild.
Wieder stossen wir auf Wort und Wert von ‘Spiel‘ und ‘Spielraum‘. Spielraum zwischen den künstlerischen Ressourcen von Ratio und Intuition. Spielraum zwischen dem Subjekt hinter der Kamera und dem Objekt davor. Unter dem schwarzen Tuch der Sucherabdeckung bleibt die Künstlerin während ihres visuellen Dialoges mit dem Gegenstand auf der Mattscheibe der Grossformat- Linhof verborgen. – Black Box ? Beichtstuhl ? Traumdeutung ? – Wie auch immer der uneinsehbare Spielraum beschaffen sein mag: Hier jedenfalls flektiert sich das Abbild zum Inbild.
Den Begriffen von ‘Spiel‘ und ‘Spielraum‘ eignet in der Kultur der Moderne etwas Infantiles: Verdacht auf Unordnung, Unernst, Unsitte. Skandal ökonomischer Abundanz. Dabei wird allerdings meist verkannt, dass jedes Spiel eine hoch komplexe Abfolge von Einzelentscheidungen in sich schliesst. In dieser Hinsicht ist Margherita Spiluttini eine bekennende Agentin des Sprachspiel- Konzepts von Ludwig Wittgenstein, dessen Haus sie eingehend fotografierte. Der von Dietmar Steiner und dem Architekturzentrum Wien edierte Werkkatalog “räumlich | spacious ” widmet dem “Palais Stonborough ” ein eigenes Kapitel.⁸
In diesem aus Text und Bild von der Autorin | Fotografin durchkomponierten Buch- Kunstwerk manifestiert sich die Lust am spielerischen Kombinieren, die Hingabe an die Verführungen des Visuellen und … vielleicht sogar die eine oder andere subliminale Parodie auf gängige Genres der coffee- table- book – Ästhetik.
Linien und Flächen. Strukturen, Figuren und Muster. Korrespondenz, Dissonanz. Das Serielle. Das Singuläre. Die Faktur einer Farbe. Der Fund einer Form. Spiegelungen, Transparenzen.
“räumlich | spacious ” ordnet das Palimpsest fotografischer Mitschriften eines Vierteljahrhunderts unkonventionell um. In dem, was dieser Katalog zeigt, aber auch in dem, wie er es zeigt, ist dieses Buch- Kunst- Werk zugleich ein Discours de la methode . Versehen mit strukturell- motivischen, zugleich rhetorisch reizvoll überdeterminierten Titeln ( “Form der Zeit” |”Infiltration Reflexion” | “Bau Körper” | , “Innensicht Einsicht” | “Anspielung Täuschung” ) führen die Kapitel dieses Katalogs verschiedene Verfahren vor, wie aus den unendlich vielen möglichen Bildern einzelne Kompositionen zu verwirklichen sind. Aufzunehmen. Auszulesen. Aufzulesen.
Letzteres gilt für die Buchedition übrigens buchstäblich: Margerita Spiluttini hat der Auslese an Bildern auch ein Auswahl von essayistischen und literarischen Texten beigesellt: Als Komplement und Ergänzung zu historischen und aktuellen Arbeiten über Spiluttinis spezielles Werk ( etwa von Friedrich Achleitner, Monika Faber, Otto Kapfinger und Dietmar Steiner ) finden sich internationale Referenztexte, welche gewisse Auffassungen der Fotografin kaleidoskopartig auffächern ( John Berger, Thomas Bernhard, Rainer Fuchs, Rudolf von Laban, Cathrin Pichler, Julian Schutting, Allison und Peter Smithson, etc. ).
Und siehe da: In Bild, Wort, in Auswahl und Komposition beider Komponenten bereitet Margherita Spiluttini unsere Augen, unser Hirn und unsere Phantasie hinreichend vor, die Chiffren- Schrift dieser Bilder und ihrer zu Buche geschlagenen Beziehungen zu entziffern. Sie leistet dieses – ihr künstlerisches, persönliches, kulturelles – Bild(ungs)werk freilich auf ihre Weise: undogmatisch und sehr diskret. Dignität der Disziplin, Genauigkeit des Denkens, technische Transparenz – und dies stets im Federkleid der Ironie.
|||
VI.
Margherita Spiluttini hat in und mit dem Material Wiens gearbeitet, sie hat mitgeschrieben an der Geschichte der Ansichten und Einsichten europäischer Architektur. Wäre man jetzt pathetisch, würde man sagen: Die Fotografin hat mit ihrer ausdauernden und genauen Arbeit über dreissig Jahre hinweg unsere geistige, visuelle und formsensitive Wissens-, Denk- und Diskurskultur erheblich geprägt.
Aber wir sind nicht pathetisch und sagen es deshalb nicht. Das würde Magherita nämlich nicht billigen. Deshalb sei das abschliessende Wort wieder an Gottfried Keller delegiert und an die letzten Verse seines “Abendlieds ”
Doch noch wandl’ ich auf dem Abendfeld,
Nur dem sinkenden Gestirn gesellt;
Trinkt, O Augen, was die Wimper hält,
Von dem goldnen Überfluss der Welt !
|||
Endnoten:
¹ – Christiane Zintzen: Werkstatt. Nach der Natur. Die österreichische Architekturfotografin Margherita Spiluttini – In: NZZ, 15. 5. 2002; Dies.: Margherita Spiluttini. Beyond Nature, translated by Steve Gander – In: METAMORPH. Catalogue 9th International Exhibition of Architecture | Biennale di Venezia, September – November 2004. Venezia: Marsilio Editore 2004, S. 215; – Dies.: In der Falle: Leib und Bau | The Trap: Body and Building, translated by Steve Gander – In: Margherita Spiluttini. räumlich | spacious – Salzburg: Fotohof edition Band 85, 2007
² – Margherita Spiluttini: räumlich | spacious , hg. Architekturzentrum Wien, Dietmar Steiner – Salzburg: Fotohof edition 2007
³ – Margherita Spiluttini: Atlas Austria , Ausstellung Architekturzentrum Wien, Alte Halle, 21. 6. bis 24. 9. 2007 – Gestaltung: Nicole Six und Paul Petritsch
⁴ – Dietmar Steiner ( Texte und Daten ), Margherita Spiluttini ( Fotografie ): Architektur in Wien, 300 sehenswerte Bauten – Wien: Magistrat 1984
⁵ – Für die Ausstellung “Facies” ( Österreichisches Fotoarchiv im Museum moderner Kunst, 1985 ) wurde eine Auswahl dieser Aufnahmen zu einer Serie von Tafeln à acht Bildern montiert.
⁶ – Bodo Hell ( Text und Fotografie ): Stadtschrift – Linz: Edition Neue Texte 1983
⁷ – Margherita Spiluttini: Nach der Natur. Konstruktionen der Landschaft . Ausstellung, Technisches Museum Wien, 22.3. bis 22. 9. 2002; Katalog hg. Technisches Museum Wien, Elisabeth Limbeck-Lilienau – Salzburg: Fotohof edition 2002
⁸ – Siehe Anm. 2
|||