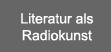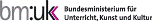Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text
Salon Littéraire | Lisa Spalt :
TULPE 2 | Textkarte 1 – (Ritual)
Der Text TULPEN hat seinen Kristallisationskern in der so genannten Tulpenhausse oder Tulpenmanie des siebzehnten Jahrhunderts, in der Frage nach der Gestaltung der Verbindung zwischen der Welt und ihrer Bewertung. Damals wurden Tulpen, deren bizarre Schönheit unter anderem – was allerdings erst 1924 bekannt wurde – davon herrührte, dass ihre Blüten von einem Mosaikvirus teilentfärbt wurden, zum Gegenstand von Geschäften mit Optionen. Man spekulierte somit mit Tulpenzwiebeln, deren Blütenentwicklung (gebrochen oder nicht gebrochen) nicht vorhersehbar war. 1637 platzte die Spekulationsblase, nachdem bereits ganze Häuser um drei Tulpenzwiebeln verscherbelt worden waren.
Was ist schön? Was ist Verzückung, ein Fan, Gläubigkeit? Mit welchen Sätzen schreibt man aufgrund welcher Muster – zum Beispiel der Natur – Wert zu? Welche Formulierung der Natur ersetzt den Begriff von ihr et cetera.
Die Tulpe als ein Shuttle zur bewertenden Natur; es geht darum, mit einem solchen Granum-Spielzeug Auslassungen, Serialisierungen und Blendeffekte der Bewertungsvorgänge prismatisch zu streuen oder vielleicht eine fassungslose Beleuchtung zu strukturieren als eine Art Hand, durch deren Finger man– dem Begriff des immer dem Nutzen folgenden Eindringens in die Natur auf der Spur – sieht. (Lisa Spalt)
Endlos wird in jenem Ritual ein originales Geschäft nachgespielt, endlos. Die zum daher fruchtlosen Zeitvertreib gestellte Frage nach dem Zweck bringt die Empfindung zu Tage, dass wahrscheinlich das erste Objekt, das in dieser Eiswüste in den Himmel gehoben werden wird, als endlich erscheinen wird müssen. Man wird hier ein Geschäft im Sinn des Gotischen Gaskafts bewerkstelligen wollen, im Sinn von Geschöpf, Schöpfung, stimmts?
Man kriegt keine Antworten.
Man kann diesem Widerhallen aus Langeweile Tulpen einschreiben, in Form von Parabeln. Man hebt sie in den Himmel, das Herzblut der Gesellschaft darin zu symbolisieren. Wieder welken die Arme, das gelb-wächserne Einrollen. Man brabbelt etwas von einem Fundament zusammen, in welches die Blüten einziehen müssen, wodurch es sich auf mysteriöse Weise dann erst bildet.
Ein Priester spielt mit seinem schweren Schreiten einen zur Symbolik passenden Ackermann.
Man will seinen Körper jetzt paradox bewahren, nämlich als vergehenden, bittebitte aber nie mehr wiederholen.
Man fühlt sich in den ästhetisch-zeremonialen Radschlag projiziert, in diese Verwechslung von Echtheit und Wiederholung, die auf dieselbe Weise die originale Reaktion des Schwindelns lockt.
Ein Symptom des bewegten, Natur in uns genannten Tieres ist, was unversehens auf die Werkbank des Zelebrateurs kotzt.
1/ Das Mirakel zu beschwören; zum Beispiel so, wie in der Bibel dieser verblüffende Stoffwechsel behauptet wird in den fürs menschliche Auge mit keinem Hilfsmittel erkennbaren Zellen des Wortes, das vor allem anderen war. Diese Kraftmaschinen wurden mit Energie angefüttert bis zum Umschlag, der dann mit einem Knaller zur Automobilität wurde in der Verbrennung des Wortes in menschliches Fleisch. Es ist ein Objekt zwischen Anfangen und Anpacken, das hier beschrieben wird, zwischen Abstraktion und Begreifen, da sind die Limits. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Abstraktion nicht nach dem Begreifen kommt, dass sie nicht aus dem betasteten Objekt abgezogen wird, sondern dass genau umgekehrt vorgegangen wird. Die Abstraktion liegt vor der Zauberei. Das ist die pure, duftende Essenz, die dann verdünnt wird.
So eine Geschichte muss die Kryptohistorikerinnenseele, die in jeder Autorin steckt, dringend zur Hermeneutik verlocken; zur wundersamen Vermehrung von Phantasien über den Ursprung des Kults, wobei die entstehenden Texte ausschließlich von Menschen beglaubigt und mit dem Originaltext zum Glück nie verglichen werden können. Das Ritual ist eine Nachricht, die uns jemand über ein veraltetes Krypto-Handy schickt, und heute kennt niemand mehr den Schlüssel.
Das Ritual muss dann aber auch als Nachvollzug der originalen Bewegung im Zug aller Verunsicherung idolisiert werden, nachdem man es als einziges verbliebenes Indiz auf das Vorbild für unantastbar zu halten hat. Man wird bald das goldene Kalb undeutlich darin erkennen können, das durch die wiederholende Einverleibung im tastenden Verdauungstrakt seinen klaren Umriss erhielt.
Die Imitation des göttlichen Handelns durch den menschlichen Stellvertreter erscheint in dieser Vision parodistisch, da klar wird, wie sehr letzterer den Funken ausschließlich im Sinn der Animation eines Abbilds beherrscht – an Orson Welles’ Definition des Zauberers zu denken als jenen Schauspieler, der die Rolle eines echten Zauberers nur spielt.¹
Welch anrüchige Verquickung des Bedürfnisses nach weltlicher Anleitung mit dem nur logisch erschlossenen Göttlichen; welche Anmaßung, zur Beruhigung bedürfnisgebeutelter Menschen, sich am Übermenschlichen zu versuchen; das ist der Moment, in dem sich die kindliche Aversion gegenüber dem Suppe schlürfenden Pfarrer mit dem Aufblitzen eines weißen Flecks auf lose mit Stroh bestreutem Beton in Erinnerung bringt. Beide Bilder riechen nach sauer Milch: hier die Kälber, mit verdrehten Augen an Gummizitzen saugend, die aus dem Tränkeeimer ragen; dieser teilt sich mit der Kuh eine Funktion; dort der Demiurg, der ragt in Gestalt des schicken Großbauern; Demiurg von Griechisch Handwerker. Er beschallt die Kühe aus dem Stallradio mit Mozart, weil das den Jahresertrag hektoliterweise steigert.
Meine Meinung wäre, dass die Götter keines Handelns weniger als eines solchen Kults – des Lateinischen Anbauens, das man nebenbei auch auf Kürbisse anwendet – bedürfen dürften. Jeder religiöse Kult fühlt sich doch in mehr als einer Hinsicht blasphemisch an, insofern, als kein menschliches Handeln dem Gott, sollte es einen geben, das Bild machen sollte.
Und so sehr das nun nach Chiffren aussieht: Manchmal fühlt sich so ein Begreifen an wie ein im Park gefundener Minilanghaardackel aus Plastik (ein Zufall), den man mit geschlossenen Augen betastet, spürend, dass die Finger zu dick sind, auf dem Grund der Rillen etwas zu wissen. Manchmal wieder begreift es sich wie ein glatt-lackartiger Würfel (unsere Rationalität), spiegelnd; aus Kunststoff ebenfalls, aber mit sehr, sehr scharfen Kanten, dessen Oberfläche die Vorstellung von Inhalt gar nicht zulässt. Vielleicht bedeutet mehr das Material, was man mit den Objekten, die aus ihm bestehen, zu vergleichen sucht. Aber jedenfalls kann das Glauben durchaus als eine auf dem Kopf stehende neo-korinthische Säule empfunden werden (der Mythos); warum? Wir führen zwei Finger durch die breiten Kanellierungen, durch diese halbrunden Einbuchtungen, die Sie sicher kennen, deren Glätte dort, wo die Form ihre Zähne mit einem Schmatzen aus dem Material gezogen hat, rau abschließt, krümelt. Es befinden sich die schmückenden Akanthusranken am Fundament | es bildet dieser Kapitell-Himmel das Fundament | unserer Welt. Das beweist, dass eine Verkehrung oder Umkehrbarkeit das Fundament des Glaubens (und der Referenz) bildet et cetera.
Weiter dazu bei ⇒ zur ortho-geotropischen Ausrichtung der Tulpe
¹ Orson Welles (Regisseur und Darsteller): F for Fake, 1974
|||
- Winterweiss
- T-U-L-P-E _1 ( Nukleus zu TULPEN )
- T-U-L-P-E _2 ( Nukleus zu TULPEN )
- T-U-L-P-E _3 ( Nukleus zu TULPEN )
- TULPE 1/5 | Bildkarte 1 (Gaumensegel)
|||
Hinweis
Lisa Spalts Band “TULPEN” wird im Herbst 2010 im Czernin- Verlag erscheinen .
|||