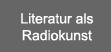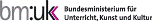Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text
Salon Littéraire | Benedikt Ledebur :
Montaigne – Von den Cannibalen
Illustration : Hans Staden – Warhaftige Historia . Zwei Reisen nach Brasilien , 1548–1555
( Tupinambá- Indianer als Kannibalen )
Im ersten Buch, im berühmten Kapitel Des cannibales, bei dem Shakespeare für The Tempest Anleihen genommen haben soll [1], und im dritten Buch in Des coches (Von den Wägen [Kutschen]) ist die Entdeckung Amerikas das Hauptthema, das spektakulärer als jedes andere Montaignes Neugierde für fremde Kulturen entspricht, und ihm dazu dient, die Ansprüche der eigenen Zivilisation kritisch zu untersuchen. In der Gleichsetzung des menschlichen, krankheitsanfälligen Körpers mit dem für Entdeckungen und neuen Welterklärungen anfälligen Kosmos finden sich die driftenden Kontinente und sich abspaltenden Inseln seltsam beunruhigt: “Es ist nicht anders als ob in diesen großen Körpern, eben so wie in den unsrigen, von Zeit zu Zeit einige fieberhafte Bewegungen wären.”[2] Nach einer Warnung vor den Meynungen des Pöbels (opinions vulgaires), Erwägungen, warum es unwahrscheinlich sei, daß es sich bei der entdeckten Insel um das sagenhafte Atlantis handelt, und nach einer allgemeinen Abhandlung über die Glaubwürdigkeit von Zeugen und darüber, wie man richtig schildert, berichtet Montaigne in Des cannibales über die Bräuche brasilianischer Ureinwohner und ihrer kulturellen Leistungen, darunter das Liebeslied eines Kannibalen, das eine Schlange um Farbe und Muster für den Gürtel der Liebsten bittet (und das Goethe zu Nachdichtungen motivierte).[3]
Seine Kritik setzt am Sprachgebrauch seiner Landsleute an, die, weil sie die getöteten Feinde nicht fressen, sondern ihre lebendigen Gegner grausam martern, geglaubt hätten, sich für zivilisierter als die Menschenfresser [4] halten zu dürfen:
Ich befinde, damit ich wieder auf mein Vorhaben komme, bey dieser Nation, soviel man mir erzählet hat, nichts wildes oder barbarisches [‘rien de barbare et de sauvage’]: ausgenommen, weil ieder dasienige Barbarey nennt, was bey ihm nicht gebräuchlich ist. Denn wir haben auch in Wahrheit keine andere Richtschnur der Wahrheit und Vernunft, als das Beyspiel und die Vorstellung der Meynungen und Gebräuche, die in unserm Lande üblich sind. … Sie sind wilde, eben so wie wir die Früchte, welche die Natur für sich und nach ihrem ordentlichen Laufe hervor gebracht hat, ‘wilde‘ nennen: da wir doch vielmehr diejenigen, welche wir durch unsere Kunstgriffe verderbet, und von der gemeinen Ordnung abgebracht haben, ‘wilde‘ nennen sollten.[5]
Montaigne schildert die Stammesgewohnheiten eines Volkes, das auf einem von ihm geographisch nicht näher bestimmten Küstenstreifen lebt, vom Hinterland durch hohe Berge getrennt. Der Leser erfährt, wie sie wohnen, was sie essen, was sie glauben und wie sie ihre Priester behandeln (z.B. wenn sie falsch prophezeien), ihre Begabungen und vor allem über ihre Tapferkeit in der Kriegsführung. Neben ihrem unbeugsamen Mut zeichne sie vor allem ihre Bescheidenheit in den Lebensgewohnheiten aus.
Sie sind noch in der glückseligen Verfassung, daß sie nichts weiter verlangen, als ihre natürliche Bedürfniß erfordert. Alles was darüber ist, halten sie für überflüßig.
Weder die Literatur mit ihren Beschreibungen des goldenen Zeitalters noch die Philosophie mit ihren Konzepten vom idealen Staat hätten eine Vorstellung von dem geben können, was die Erfahrungen in der neuen Welt gezeigt, nämlich mit wie wenig menschlichem Aufwand und Kunst sich eine Gesellschaft aufrecht erhalten lasse. Am Ende des Kapitels berichtet Montaigne von drei Indianern, die er in Rouen getroffen hatte, “elende Leute, die sich von der Neugierde hatten blenden lassen, und ihr schönes Land verlassen hatten, um das unsrige zu besehen.” Auf die Frage, wie sie das beurteilten, was sie in Frankreich gesehen hätten, wunderten sie sich darüber, daß der König ein Kind sei.
Zum andern wunderten sie sich darüber (nach ihrer Art zu reden nennen sie einen Menschen des anderen Hälfte) daß sie unter uns Leute gesehen hätten, welche an allem einen Überfluß hätten, da hingegen ihre Hälften von ihren Thüren, verhungert und nackend, bettelten; und es käme ihnen seltsam vor, daß diese dürftigen Hälften dergleichen Ungerechtigkeit erduldeten, und daß sie sich nicht über die andern hermachten, oder ihnen die Häuser ansteckten.[6]
In Des coches, dem 6. Kapitel des 3. Buches, das unter anderem den prunkvollen Kulturen in Peru und Mexico gewidmet ist, erklärt sich Montaigne unfähig für weite Seereisen, wie sie die Entdeckung Amerikas erfordert hatte, indem er anfangs seine Disposition zur Seekrankheit zum Anlaß nimmt, um über die Furcht nachzudenken, die Plutarch als Ursache dieses Übels anführt. Wie Schriftsteller im Allgemeinen wissentlich falsche Gründe anführen würden, wenn diese nur genug Eindruck erwecken und zur Eleganz der Argumentation beitragen, so sei auch diese Begründung falsch.
Ich für meine Person bin sehr damit geplaget; allein ich weiß gewiß, daß sich diese Ursache bey mir nicht befindet: und ich weiß es nicht durch Schlüße, sondern aus einer notwendigen Erfahrung.[7]
… et le scay non par argument, mais par necessaire experience, diese abschließende Bekräftigung der Wahrheit seiner Aussage durch die Erfahrung, läßt die Waage Montaignes sich auf die Seite der Vernunftskepsis neigen, während sonst die Gewichtung eher dem Zweifel an den Sinnen den Vorrang gibt. Montaigne spart nicht mit Selbstlob, und nachdem er sich als Furchtlosen dargestellt hat, der allen Gefahren, auch dem Tod, ruhig in die Augen sehe, zitiert er den Feldherrn Alcibiades, der des Sokrates kluge und mutige Haltung im Feld preist. Von dieser unterschwelligen Identifikation kommt er schließlich auf die in Krieg und Frieden gebräuchlichen Fortbewegungsmittel.
So kann ich nicht lange Zeit weder Kutsche, noch Sänfte, noch Schiff, leiden, (und konnte es in meiner Jugend noch weniger leiden), und hasse alle andere Arten von Fuhrwerke, bis auf das Reiten, so wohl in der Stadt als auf dem Lande. Allein die Sänfte kann ich noch weniger, als eine Kutsche leiden: und aus gleichem Grunde eher ein etwas starkes Schlagen auf dem Meere, wovon die Furcht entstehet als die Bewegung, die man bey stillem Wetter empfindet.[8]
Montaigne bleibt nicht lange bei dem titelgebenden Gegenstand, mit Betrachtungen über Kriegsführung, die Tugenden der Könige, öffentliche Schauspiele und ihrem Dekor übt er sich noch eine Weile in der Kunst der Umwege, bis er zum eigentlichen Thema des Kapitels kommt: die Grausamkeit und Hinterlist der spanischen Eroberer und die Einsicht, Tapferkeit und Unbeugsamkeit der Ureinwohner und ihrer Häuptlinge in Peru und Mexico. Montaigne geht von einer eigenen, körperlichen Schwäche aus und stellt eine vorübergehende Übelkeit der todbringenden Qual von Gefolterten gegenüber.[9] Diese Unverhältnismäßigkeit reflektiert in einer chiastischen Umkehrung das Kräfteverhältnis zwischen den Angreifern und ihren Opfern. Der leidensfähige Körper dient ihm auch zu dem Vergleich, der die Folgen dieses Aufeinanderprallens ungleicher Kulturen gesamthaft ins Bild bringen soll:
Wenn unser Schluß auf unser Ende, und jenes Dichters Jugend auf die Jugend seines Jahrhunderts, richtig ist: so wird diese andere Welt erst an das Licht kommen, wenn die unsrige dasselbe verlassen wird. Dieses ganze wird gelähmet werden: ein Glied wird steif, das andere aber gesund seyn. Doch, ich besorge, daß wir dieselbe angesteckt, ihren Verfall und Untergang dadurch sehr befördert, und ihr unsere Meynungen und Künste theuer verkaufet haben. Diese Welt war noch ein Kind. Gleichwohl haben wir sie nicht durch unsere Tapferkeit oder natürliche Stärke unter die Ruthe und Zucht gebracht, noch durch unsere Gerechtigkeit und Güte gewonnen, noch durch unseren Großmuth überwältiget. Ihre meisten Antworten, und die meisten mit ihnen getroffenen Unterhandlungen, bezeugen, daß sie nicht weniger natürliche Einsicht und Geschicklichkeit besessen hat, als wir.[10]
Ein Zitat im Kapitel, das einige Antworten der Bedrängten auf die Ansinnen der Spanier wiederzugeben vorgibt, und das Montaigne die Kulturkolonialisten seiner Zeit verspottend das Lallen dieser Kindheit (la balbucie de cette enfance) nennt, soll die, was die Umgangsformen und Moral betrifft, unvergleichlich höher stehende Art der Einwohner dieser neuen Welt bezeugen:
Als einige Spanier um ihre Bergwerke auf zu suchen, an dem Ufer hinfuhren, stiegen sie in einer fruchtbaren, lustigen, und sehr volkreichen Gegend, an das Land, und thaten diesem Volke ihre gewöhnliche Vorstellungen: Sie wären friedfertige Leute, die aus fernen Ländern kämen, und von dem Könige von Castilien, dem größten Herrn der bewohnbaren Erde abgesandt wären, welchem der Pabst, der Gott auf der Erde vorstellete, die Herrschaft über ganz Indien ertheilet hätte: Wenn sie diesem zinsbar werden wollten, so würde man ihnen sehr freundschaftlich begegnen. Sie verlangten dabey Lebensmittel zu ihrem Unterhalte, und Gold zu Verfertigung einiger Arzeneyen: stellten ihnen ferner den Glauben an einen einzigen Gott, und die Wahrheit unserer Religion vor, welche sie ihnen an zu nehmen riethen; und fügten diesem allen noch einige Drohungen bey. Die Antwort lautete so: ‘Was die Friedfertigkeit anbelangte: so sähen sie nicht gar friedfertig aus, wenn sie es wären. Ihr König müßte arm und dürftig seyn, weil er verlangte: und derjenige, welcher ihm dieses zugetheilet hätte, müßte die Zwietracht lieben, da er einem Dritten etwas schenkte, was nicht sein eigen wäre, um ihn mit den ersten Besitzern zusammen zu hetzen. Gold hätten sie wenig, und sie machten aus demselben nichts, weil es ihnen nichts in ihrem Leben nutzte, und alle ihre Sorgfalt dahin gienge, dasselbe glücklich und ruhig zu führen. Daher möchten sie alles, was sie davon fänden, ausgenommen das, was zum Dienste ihrer Götter gebraucht würde, kühnlich nehmen. Der Vortrag von einem einzigen Gott hätte ihnen gefallen: allein, sie möchten ihre Religion nicht vertauschen, bey welcher sie sich so lange Zeit wohl befunden hätten; und sie wären nicht gewohnt, von andern, als ihren Freunden und Bekannten, Rath an zu nehmen. Ihre Drohungen betreffend, so wäre es ein Zeichen, daß es ihnen an Ueberlegung fehlen müßte, da sie Leuten droheten, deren Art und Umstände ihnen unbekannt wären.’ … [11]
Die ironische Satz-für-Satz-Analyse der spanischen Behauptungen und Forderungen, die hier den Angegriffenen in den Mund gelegt wird, macht, auch wenn es gegen alle Wahrscheinlichkeit wirklich so gesagt worden sein sollte, mit jedem Gegenargument Montaignes Punze sichtbar. Daß (auch im Original) die indirekte Rede unter Anführungszeichen gesetzt wird, könnte als Anzeichen dafür gesehen werden, daß sich die direkte Rede des Autors indirekt Ausdruck verschafft. Die offene Kritik des Papstes und der bei Montaigne so oft durchschimmernde Pluralismus, wenn von Religionsbekenntnissen die Rede ist, der den Wechsel vom Bekannten zum Unbekannten für abwegig hält, von welcher Seite er auch vollzogen wird, und damit auch jede missionarische Bemühung, konnten die Prüfungen des Vatikans auch in toleranteren Zeiten wahrscheinlich dann eher passieren, wenn sie als Meinungen von Indianern verkauft wurden. Montaignes zustimmendes Zitieren genügt, um seine Einstellung zu verraten; auch erfundene Koautoren oder Zitate aus undurchsichtigen Quellen hatten neben der Wirksamkeit eines literarischen Stilmittels, umso länger die Gegenreformation lief, desto stärker, wenn nicht lebens- so gesellschaftliches Ansehen rettende Funktion. Ihre Ehrlichkeit habe den Eingeborenen den Untergang gebracht, während die Spanier durch Lüge und Betrug das Land unterworfen hätten. Wie Montaigne sich selbst von außen zu sehen versucht, so sieht er das unzivilisierte Verhalten der Europäer aus der Sicht der Ureinwohner. Am Martyrium des Königs von Peru und des Königs von Mexico, der durch falsche Versprechungen in die Falle gelockt noch am Scheiterhaufen seinen Mitstreitern Mut zuspricht, führt er die feige Grausamkeit [12] und Profitgier der Eindringlinge vor Augen, und geißelt ihre Motivation:
Wer hat jemals den Nutzen der Kaufmannschaft und des Handels so hoch gesetzt, des Perlen- und Pfefferhandels wegen so viele Städte zu schleifen, so viel Nationen aus zu rotten, so viele Millionen Menschen nieder zu machen, und den reichsten und schönsten Theil der Welt zu verwüsten! Niederträchtige Siege![13]
Die wirklich Primitiven sind die Entdecker, weil sie mit engem, geistigen Horizont in See gestochen sind, bleibt ihnen nicht nur das, worauf sie hinter dem von der spanischen Küste aus sichtbaren stoßen, verschlossen, sondern sie verpassen auch die Chance des “Regard éloigné”, eines neuen Blicks auf die eigene Kultur. Die Naturverbundenheit der sogenannten Primitiven beschreibt Claude Lévi-Strauss als nicht allein auf den Nutzen abzielendes, magisches Denken, das auf genauer Beobachtung der Umgebung beruht. Der Drang, zu ordnen und zu klassifizieren, würde dabei ähnlich dem wissenschaftlichen Denken von empirischen Werten, Sinnesdaten, aber auch von ästhetischen Kriterien geleitet. Es sei der allgemeine Versuch, “durch solche Gruppenbildungen von Dingen und Lebewesen den Anfang einer Ordnung im Universum zu bilden.”[14]
Montaigne bringt Beispiele von solchem rein ästhetischen, wilden Klassifizieren im Kapitel Des noms (Von den Namen), wo er erzählt, “wie es bei dem Kaiser Geta gewesen, der die Gerüchte bey seinen Mahlzeiten nach dem Namen der Fleischgerüchte setzen ließ, man trug nemlich dieienigen zugleich auf, welche sich im Französischen mit einem M anfingen, als Mouton, Marquasin, Merbus, Marssoin. usw.”[15] Nach Lévi-Strauss läßt sich das wilde Denken (La pensée sauvage) als formale Analogie zum wissenschaftlichen verstehen, “die sie beide einander näherbringt und die aus dem ersten eine Art metaphorischen Ausdrucks der letzteren macht.” Sie seien “hinsichtlich ihrer theoretischen und praktischen Ergebnisse ungleich …, nicht aber bezüglich der Art der geistigen Prozesse, die die Voraussetzung beider sind und sich weniger der Natur nach unterscheiden als aufgrund der Erscheinungstypen, auf die sie sich beziehen.”[16]
Wenn Lévi-Strauss das gemeinsame Bedürfnis von Kunst und Wissenschaft als die Forderung nach Organisation bestimmt, so könnte man Montaigne und seinen Essais als die reine Natur (Sainte-Beuve) einen Mangel an dieser vorwerfen. Weil er seinen Körper metaphorisch für sein Denken einsetzt, wird er nicht nur für formale Analogien empfänglich, sondern begreift jene Kulturen, die sich durch Regeln des Zusammenlebens im selbstbeschränkenden Einklang mit ihrer Umwelt befinden, gegenüber den von rein merkantilen Bedürfnissen geleiteten als höhere Organisation. Ich weiß nicht, auf welche Stelle Peter Burke sich bezieht, wenn er schreibt: “Claude Lévi-Strauss erwies dem Ethnologen Montaigne seine Ehrerbietung, indem er eins seiner Bücher La pensée sauvage (Das wilde Denken) nannte, mit Bezug auf den Essay über Kannibalen.”[17] Dem Buch selbst ist ein Satz aus Balzac [18] vorangestellt, es ist Merleau-Ponty gewidmet und erwähnt mit keinem Wort Montaigne. Allerdings bezieht sich Lévi-Strauss in dem Buch auf Rousseau (drei mal). Er stellt fest, “daß das Wissen zugleich objektiv und subjektiv sein kann und daß die konkreten Beziehungen zwischen dem Menschen und den Lebewesen zuweilen das ganze Universum der wissenschafltichen Erkenntnis mit Gefühlsmomenten beleben (Ausdruck jener ursprünglichen Übereinstimmung, in der Rousseau die solidarische Bedingung jeden Denkens und jeder Gesellschaft gesehen hat), besonders in Zivilisationen, deren Wissenschaft durch und durch ‘natürlich’ ist.”
Der Gegensatz von Kultur und Natur hat nach ihm nur methodologischen Wert. Die Versöhnung dieses Gegensatzes im Wirklichen wird vom ästhetischen Erfassen versucht, das in magischen Ritualen und im Metaphorisieren der Körper genauso seinen Ausdruck finden kann, wie in Philosophie oder Literatur.
Wir akzeptieren also die Bezeichnung Ästhet, weil wir meinen, daß das letzte Ziel der Wissenschaften vom Menschen nicht das ist, den Menschen zu konstituieren, sondern das, ihn aufzulösen. Der eminente Wert der Ethnologie liegt darin, daß sie der ersten Etappe seines Vorgehens entspricht, der weitere folgen: hinter der empirischen Vielfalt der menschlichen Gesellschaften will die ethnographische Analyse Invarianten ermitteln …. Rousseau hatte das mit seiner gewohnten Scharfsicht geahnt: ‘Wenn man die Menschen erforschen will, muß man sich in seiner eigenen Umgebung umsehen; doch um den Menschen zu erforschen, muß man es lernen, seinen Blick in die Ferne zu richten; man muß zuerst Unterschiede beobachten, um die allgemeinen Eigenschaften entdecken zu können.’
Doch es würde nicht ausreichen, einzelne Menschenheiten in einer allgemeinen Menschheit aufgehen zu lassen; dieses erste Unternehmen leitet weitere ein, die Rousseau nicht anerkannt hätte und die den exakten und den Naturwissenschaften zufallen: “die Kultur in die Natur und schließlich das Leben in die Gesamtheit seiner physikochemischen Bedingungen zu reintegrieren.”[19] Hier zeigt sich das ästhetische Ideal Montaignes in seiner wissenschaftlichen Variante als Umkehrung. Wenn Montaigne der Vergleich des Verhaltens der Abenteurer (Alexander von Humboldt oder Lévi-Strauss selbst geben ein anderes Bild des abendländischen Forschers) mit der Eingeborenenkultur letztere verklären und (auch aus in ihr selbst liegenden Gründen) moralisch höher bewerten läßt, so bringt Lévi-Strauß der Glaube an seine Wissenschaft zum Fortschrittsgedanken, der in der Magie zwar nicht eine schüchterne und stammelnde Form der Wissenschaft sehen will, was innerhalb eines engen Rahmens zulässig sei, so doch den “Schatten, der den Körper ankündigt, und in gewissem Sinn ebenso vollständig wie er, in all seiner Stofflosigkeit ebenso fertig und kohärent wie der feste Körper, dem er lediglich vorausgeht.”[20]
Montaignes Mißtrauen gegen die Wissenschaften läßt ihn als Gegensatz zur Proklamation solcher Entwicklungen erscheinen, die dem Vorläufer die Festigkeit abspricht, die das wissenschaftliche Denken haben soll, das sein Objekt als Eigenständiges oder zumindest das einzelne Element in den Beziehungen, die es eingehen kann, auflöst. Seine Reflexionen zerlegen den Reflektierenden in seine ihm äußerlichen Bedingtheiten, um jene falsche Identifizierungen auflösende Selbsterkenntnis zu fördern, die das eigene Vergehen miteinberechnet und, was er am eigenen Körper erfährt, in ein Verhältnis bringen soll, das ihm am besten entspricht. In Strukturale Anthropologie II, im Kapitel Jean Jaques Rousseau, Begründer der Wissenschaften vom Menschen kommt Lévi-Strauss explizit auf Montaigne zu sprechen, wobei er, auch wenn er in ihm einen neuen Anfang sieht, eher auf seine philosophische Einordnung im Hinblick auf Descartes und Rousseau als auf seine Relevanz für die Anthropologie bedacht zu sein scheint:
Rousseau drückt […] eine Wahrheit aus, die überraschend bleibt, obgleich sie uns durch die Psychologie und die Ethnologie vertrauter geworden ist, daß nämlich ein ‘Drittes’ existiert, das sich in mir denkt und das mich zweifeln läßt, ob ich es bin, der denkt. Dem ‘Was weiß ich?’ Montaignes (von dem alles seinen Ausgang nahm) glaubte Descartes antworten zu können, daß ich weiß, daß ich bin, da ich denke; worauf Rousseau mit einem ‘Was bin ich?’ erwidert, einer Frage die ohne bestimmte Bedeutung bleibt, da ihre Beantwortung die Antwort auf eine andere, wesentlichere Frage voraussetzt: ‘Bin ich?’ Die innerste Erfahrung bietet nur dieses Dritte, das Rousseau entdeckt und dessen Erkundung er mit so großer Klarheit unternommen hat.[21]
Auffallend ist, dass Lévi-Strauss in seinem Bezug auf Montaigne an den philosophisch ausbeutbaren Bewußtseins- und Ichformeln festhält, trotz seiner Distanzierung von Descartes und entgegen seiner sonst praktizierten strukturalen Methode, für deren Ziel, dem Individuum unbewußte, durch gesellschaftliche Verhältnisse und Institutionen bedingte Regeln und Prozesse freizulegen, genug Ansätze in den Essais gegeben sind.
Sie haben nicht glauben können, daß sich unsere Gesellschaft mit so weniger Kunst, und fast ohne menschliches Zuthun, erhalten könne.[22]
Damit durch Tauschmöglichkeiten etc. generierte gesellschaftliche Strukturen von Dauer sein können, sind sie auf ihre Verankerung, auf eine bestimmte Repräsentation ihrer selbst (ihrer Regeln) im Bewußtsein der Einzelnen angewiesen:
Und auf einem Wege, den sie in derselben Richtung zurücklegen, ist allein ihre Orientierung verschieden: der Ethnologe geht vorwärts, indem er durch ein Bewußtes, das er niemals aus dem Auge verliert, immer mehr Unbewußtes anzutreffen sucht, dem er sich zuwendet; der Historiker dagegen geht sozusagen rückwärtsgehend vorwärts, indem er die Augen starr auf die konkreten und besonderen Handlungen gerichtet hält, von denen er sich nur entfernt, um sie unter einer reicheren und vollständigeren Perspektive betrachten zu können. Als wahrer Januskopf mit zwei Gesichtern gestattet die Zusammenarbeit der beiden Disziplinen, und sie allein, das Ganze des Weges im Auge zu behalten.[23]
|||
[1] vgl. Hans Stilett 2008, S. 236 ff.
[2] Montaigne 1992, I., S. 366
[3] vgl. Stilett 2008, S.73 ff. “Bei der Schilderung der Sitten und Gebräuche dieser Eingeborenen bezieht sich Montaigne, seinem Gewährsmann folgend, auf den brasilianischen Indianerstamm der Tupinambá. Es war Durand de Villegagnon, der zuerst auf ihn stieß, als er 1557 in der Gegend des heutigen Rio de Janeiro an Land ging und ihr den Namen Antarktisches Frankreich gab.”
[4] In einer anderen, kulturrelativierenden Gegenüberstellung, die sich in der Schutzschrift für Raimond Sebonde findet, steigt die Menschenfresserei beim Vergleich von Begräbnisritualen besser aus: “Man kann sich nichts so abscheuliches vorstellen, als seinen Vater zu fressen. Diejenigen Völker, welche ehedem diese Gewohnheit hatten [Sextus Empiricus, Pyrrh. Hypot. L.III.c.34.p.157.], betrachteten dieselbe gleichwohl als ein Zeugniß der kindlichen Liebe und Zuneigung, und suchten hiedurch denenjenigen, die sie gezeuget hatten, das anständigste und herrlichste Begräbniß zu verschaffen. Sie glaubten, die Leiber ihrer Väter, und deren Überbleibsel, auf diese Art gleichsam in ihr eigenes Mark zu bringen, und sie durch die Verwandlung in ihr lebendiges Fleisch, vermittelst der Verdauung und Nahrung, gewissermaaßen wieder zu beleben und wieder zu gebähren. Man kann leicht denken, wie grausam und abscheulich es Leuten, die diesen Aberglauben eingesogen hatten, gedünkt haben würde, den Leichnam ihrer Aeltern in der Erde verwesen zu lassen, oder den Thieren und Würmern zur Speise hin zu werfen.” (Montaigne 1992, II., S.335)
[5] Montaigne 1992, I., S. 369 ff.
[6] Montaigne 1992, I., S. 386 ff.
[7] Montaigne 1992, III., S.2
[8] Montaigne 1992, III., S. 5 ff.
[9] Vgl. Starobinski 1982, S. 191: “Das merkwürdige Kapitel ‘Über Kutschen’ ist … besonders aufschlußreich: seine Gliederung hat zu Auseinandersetzungen Anlaß gegeben, sein inhaltlicher Verlauf aber – von einem auf den eigenen Körper bezogenen Teil zu einem Abschnitt über die von anderen erlittene Tortur – ist von beispielhafter Klarheit.”
[10] Montaigne 1992, III., S. 24 ff.
[11] Montaigne 1992, III. S. 28 ff.
[12] Montaigne widmet der Grausamkeit zwei Essais (1992, I., S.834 u. II. S.556); das zweite ist mit Die Feigheit ist die Mutter der Grausamkeit betitelt und enthält die Beschreibung verschiedener Martern und Todesstrafen, während das andere Essai Von der Grausamkeit mehr eine ethische Abhandlung über die Kriterien echter Tugend, was die stoische und die epikureische Lehre darüber sagen, und Selbstbekenntnisse Montaignes darstellt.
[13] Montaigne 1992, III., S. 31 ff.
[14] Lévi-Strauss 1972, S.21
[15] Montaigne 1992, I., S.542 Was aufgetragen wurde, sind Fleisch vom Schaf und Ferkel und die Fische Stockfisch und Tümmler.
[16] Lévi-Strauss 1972, S. 25
[17] Keel (Hrsg.) 1992, S. 480
[18] Niemand ist in seinen Berechnungen so genau wie die Wilden, die Bauern und die Provinzler; wenn sie vom Gedanken zur Wirklichkeit kommen, ist daher alles schon fertig. (Aus “Das Antiquitätenkabinett”)
[19] Lévi-Strauss 1972, S. 52 ff. u. S.284
[20] Lévi-Strauss 1972, S. 25
[21] Lévi-Strauss, 1999, S. 49, auch in Mythologica I, II kommt zitiert Lévi-Strauss Montaigne in Fußnoten. In einer Fußnote zur Kultur polychromer Töpferei, die eine aus Gift gewonnene braune Farbe “Exkrement der Großen Schlange” nennt, besagtes Liebeslied aus Des Cannibales. Vgl. Lévi-Strauss Mythologica I, 1976, S.414.
[22] Montaigne, 1992, I, S. 371
[23] Lévi-Strauss, 1997, S. 39
|||
Literatur
Burke, P.: Montaigne zur Einführung, Hamburg 1993
Descartes, R.: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen, Hamburg 1994
Keel, D.(Hrsg.): Über Montaigne, Zürich 1992
Lévi-Strauss, C.: Das wilde Denken. Frankfurt am Main 1972
Lévi-Strauss, C.: Strukturale Anthropologie I, II, Frankfurt am Main 1997, 1999
Lévi-Strauss, C.: Mythologica I, II, Frankfurt am Main 1976
Montaigne, M. de: Essais [Versuche] nebst des Verfassers Leben nach der Ausgabe von Pierre Coste ins Deutsche übersetzt von Johann Daniel Tietz, Zürich 1992
Sextus Empiricus: Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, Frankfurt am Main 1993
Starobinski, J.: Montaigne, Denken und Existenz, München Wien 1986
Starobinski, J.: Montaigne en mouvement, Paris 1982
Stilett, H. : Von der Lust auf dieser Erde zu leben, Wanderungen durch Montaignes Welten, Frankfurt am Main 2008
|||
- APHATISCHER MUSE REDE – Laudatio auf Brigitta Falkner anlässlich der Verleihung des österreichischen Förderungspreises für Literatur 2007 ( 11. 4. 2008 )
- LETZTE LOCKERUNGEN schnellzeichnungen & schnellgedichte 1 | Matthias Goldmann ( Translation ) : LAST ROUND OF LOOSENING UP – quick poems 1
- LETZTE LOCKERUNGEN schnellzeichnungen & schnellgedichte 2 | Matthias Goldmann ( Translation ) : LAST ROUND OF LOOSENING UP – quick poems 2
- LETZTE LOCKERUNGEN schnellzeichnungen & schnellgedichte 3 | Matthias Goldmann ( Translation ) : LAST ROUND OF LOOSENING UP – quick poems 3
- SIE WISSEN WAS SIE TUN – Die geistige Wiedererschaffung als Fortleben des Originals . Zu Barbara Köhlers und Ulf Stolterfohts Übersetzungen von Texten Gertrude Steins ( = Laudatio anlässlich der Zuerkennung und Überreichung des “Erlanger Literaturpreises für Poesie als Übersetzung” im Rahmen der Eröffnung des 29. Poetenfestes Erlangen am 27. 8. 2009 )
|||
Hinweis :
- Benedikt Ledebur – “Montaigne . Versuche der Selbstauflösung” ist 2010 im Klever- Verlag erschienen .
|||