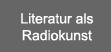espace d’essays | English Version
Benedikt Ledebur : Das Paradox des Realen in der Kunst *
|||
* Hyper Real: Die Passion des Realen in Malerei und Fotografie – Katalog Wien Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien ( MuMOK) – 22. Oktober 2010 bis 13. Februar 2011 ; Deutsch | English , Texte von Monika Faber , Edelbert Köb , Benedikt Ledebur , Susanne Neuburger , Interview von Brigitte Franzen mit Jean-Christoph Ammann – Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2010 , ca. 350 Seiten, 274 Farb-Abb., € 38.-
|||
There’s nothing behind it.
Andy Warhol
Nature is a product of art and discourse.
Nelson Goodman
Let the atrocious images haunt us.
Susan Sontag
Eine erste rationale Unterscheidung, die die Bestimmung von Merkmalen selbst von ihrer Nichtbestimmung trennt, die im Sprechen über das Reale dem Realen einen anderen Ort zuweist als der unter Konstruktverdacht stehenden Realität, ist jene zwischen dem Begrifflichen und dem Unbegrifflichen. Das also nur ex negativo benannte Reale würde unter Letzteres fallen, während es der durch die Benennungen codierte, Merkmale filternde Blick, die durch die Interessen der Gattung geprägten und durch die jeweiligen Konventionen des Sehens geschulten Augen wären, die einem Realismus die Möglichkeit geben, sie über seine zeit- und stilgebundene Künstlichkeit zu täuschen. Ob jetzt aus einer kantischen Sicht die prinzipielle Unzugänglichkeit des Realen oder aus konstruktivistischer Sicht die Künstlichkeit jeder Wirklichkeit hervorgehoben wird, bei Anschauungen, die Beobachter, Betrachtungsweisen, Methoden oder Versuchsanordnungen ins Kalkül ziehen, wird das Reale oft als jener Bereich gehandelt, der sich den Symbolisierungen von Wissenschaft und Kunst entzieht, obwohl er den Grund für die Erkenntnisse, Entdeckungen und Erfindungen liefert, die in ihnen formuliert oder mit ihrer Hilfe ausgeführt werden.
Zeuxis und Parrhasios
Wie anthropozentrisch es in den Reflexionen und Theorien über Kunst weiterhin zugeht, illustriert das Einverständnis, mit dem die alte Anekdote aus der Antike über den Wettstreit in täuschender Mimesis zitiert wird. Denn immer noch wird jenem Künstler der Vorrang eingeräumt, der seinen Kontrahenten mit einem gemalten Schleier so zu täuschen vermochte, dass dieser ihn vom dahinter vermuteten Bild wegzuziehen suchte, statt ihn jenem zuzuerkennen, der sogar die Vögel mit seiner zweidimensionalen Illusion verführte. Auch wenn von einem analytischen, wissenschaftlichen Standpunkt aus der Blick der Vögel und die mit ihm gekoppelten kognitiven Fähigkeiten sich als einfachere Zusammenhänge und Mechanismen darstellen lassen als die menschlichen, so müsste sich, von einem synthetischen Standpunkt der Kunst aus gesehen, der entsprechende visuelle Symbolismus um einiges erweitern oder allgemeingültiger gestalten, dass ihm auch Tiere auf den Leim gehen. Eine Behandlung der Anekdote, die das Augenmerk stärker auf die Vögel richtet, findet sich bei Jacques Lacan, wenn er über die “natürliche Funktion der Täuschung und der Augentäuschung” spricht:
“Wenn die Vögel sich auf die von Zeuxis mit Pinselstrichen bearbeitete Fläche stürzten und so das Bild für Trauben ansahen, müssen wir bemerken, daß der Erfolg dieses Unternehmens durchaus nicht davon abhängt, daß die Trauben auf jene wundervolle Art wiedergegeben waren, wie wir sie etwa bei jenen Trauben beobachten können, die sich im Korb von Caravaggios Bacchus in den Uffizien befinden. Wären die Trauben von der Art gewesen, wäre es sogar sehr unwahrscheinlich, daß die Vögel sich hätten täuschen lassen, denn wie sollten Vögel in solch forcierter Malweise Trauben erkennen? Es muß da in dem, was für die Vögel eine Traubenbeute darstellt, etwas sein, das reduzierter ist, das dem Zeichen nähersteht. Dagegen zeigt das Beispiel von Parrhasios, wenn man einen Menschen täuschen will, braucht man ihm nur das Bild eines Vorhangs vor Augen zu halten, das heißt das Bild von etwas, jenseits dessen er zu sehen verlangt. [1]
Interessant ist, wie an dieser Stelle Lacan “reduziert” mit “Zeichen” in Verbindung bringt, damit das Dargestellte auch für Vogelhirne “von Bedeutung” sein könne. Plausibel würde doch genauso scheinen, der Zweidimensionalität die Fähigkeit abzusprechen, Vögel zu täuschen, und nur dreidimensionalen Nachbildungen zuzutrauen, die perfekte Illusion zu erzeugen, die sogar den Blick der nach Beute suchenden Tieraugen anzieht.
Brunelleschis Spiegelexperiment und das fixierte Objektiv
Die historische Bedingtheit der menschlichen Wahrnehmung erhellt ein anderes, viel zitiertes Experiment eines Baumeisters der Renaissance, Filippo Brunelleschi, um 1425, das – neben Erwin Panofsky oder in jüngerer Zeit Jean-François Lyotard [2] – Paul Feyerabend in Wissenschaft als Kunst [3] bringt.
 Brunelleschi malt die Außenansicht des Baptisteriums von San Giovanni in Florenz und nimmt als Hintergrund einen polierten Spiegel. In die Mitte des Bildes bohrt er ein kleines Loch, das sich für den bequemeren Durchblick mit einem Auge zur Rückseite hin weitet. Das Experiment besteht nun darin, dass sich eine Betrachterin oder ein Betrachter an den Ort begibt, von dem aus das Bild gemalt worden war, nämlich in den Eingang des florentinischen Domes, und dort in bestimmter Höhe mit einem Auge durch das Loch in der Rückseite des Bildes blickt, während in einem genau berechneten Abstand, der im kleineren Maßstab des Abbilds der Entfernung des Baptisteriums vom Betrachter entspricht, ein Spiegel gehalten wird. In diesem Spiegel sieht der Betrachter nicht nur das reflektierte gemalte Baptisterium, sondern auch den doppelt reflektierten natürlichen Himmel, und die Wolken, so welche am Himmel sind und der Wind sie treibt, ziehen in einer doppelten Spiegelung in dieselbe Richtung wie jene, die sich dem Blick bieten, der sich direkt auf das Baptisterium richtet, wenn der Spiegel weggezogen wird. Brunelleschi will damit beweisen, dass sich das Auge so täuschen lässt, dass der Betrachter nicht mehr zwischen Kunst und Wirklichkeit zu unterscheiden vermag. In Della pittura liefert Leon Battista Alberti die Theorie nach, die bald ihre ersten Kritiker findet.
Brunelleschi malt die Außenansicht des Baptisteriums von San Giovanni in Florenz und nimmt als Hintergrund einen polierten Spiegel. In die Mitte des Bildes bohrt er ein kleines Loch, das sich für den bequemeren Durchblick mit einem Auge zur Rückseite hin weitet. Das Experiment besteht nun darin, dass sich eine Betrachterin oder ein Betrachter an den Ort begibt, von dem aus das Bild gemalt worden war, nämlich in den Eingang des florentinischen Domes, und dort in bestimmter Höhe mit einem Auge durch das Loch in der Rückseite des Bildes blickt, während in einem genau berechneten Abstand, der im kleineren Maßstab des Abbilds der Entfernung des Baptisteriums vom Betrachter entspricht, ein Spiegel gehalten wird. In diesem Spiegel sieht der Betrachter nicht nur das reflektierte gemalte Baptisterium, sondern auch den doppelt reflektierten natürlichen Himmel, und die Wolken, so welche am Himmel sind und der Wind sie treibt, ziehen in einer doppelten Spiegelung in dieselbe Richtung wie jene, die sich dem Blick bieten, der sich direkt auf das Baptisterium richtet, wenn der Spiegel weggezogen wird. Brunelleschi will damit beweisen, dass sich das Auge so täuschen lässt, dass der Betrachter nicht mehr zwischen Kunst und Wirklichkeit zu unterscheiden vermag. In Della pittura liefert Leon Battista Alberti die Theorie nach, die bald ihre ersten Kritiker findet.
“Von Euklid hatte Alberti das Prinzip übernommen: ‚Wenn der Winkel am Auge spitzer wird, dann erscheint das gesehene Ding kleiner.‘ Dieses Prinzip spielte später, nach Kepler und Descartes, eine wichtige Rolle in der abendländischen Optik. Modern ausgedrückt bedeutet es die Gleichsetzung von Sehraum und physikalisch-optischem Raum. […] Der Maler malt aber nicht für Einäugige mit unbeweglich festgeschraubtem Kopf, er malt für Menschen, die sich frei vor einem Bilde bewegen. Soll das Bild auch für solche Beobachter natürlich und nicht verzerrt erscheinen, dann muß es nach anderen Gesetzen aufgebaut werden.”[4]
Mehr noch als Brunelleschis illusionistische Abbildung mit doppelter Spiegelung gilt die Camera obscura als paradigmatisches Modell sowohl für das Auge, für ein objektives Sehen, als auch für die Rolle, die das Objektiv in der Fotografie spielt. Wieder ist es ein kleines Loch, nur projizieren nicht von einem Spiegelbild ausgehende Lichtwellen durch dieses ein Bild in das Auge des Betrachters, sondern Licht fällt in einen hinter dem Loch liegenden dunklen Raum, auf dessen gegenüberliegender Wand ein umgekehrtes Bild erscheint. In seinem Aufsatz “Die Modernisierung des Sehens” (1988) [5] kritisiert Jonathan Crary die Auffassungen, die eine kontinuierliche Entwicklung von der Camera obscura als “zentraler epistemologischer Figur” zur Fotokamera sehen wollen. Ähnlich wie Paul Feyerabend zielt er auf die Monokularität des zugrunde liegenden Modells:
“Die Öffnung der Kamera korrespondierte mit einem einzigen, mathematisch definierbaren Punkt, von dem aus die Welt logisch deduzierbar und repräsentierbar war. […] Die sinnliche Wahrnehmung, die in jeder Hinsicht vom Körper abhängig war, wurde zugunsten der Repräsentationen dieses mechanischen, monokularen Apparats, deren Authentizität jenseits allen Zweifels verortet wurde, verworfen. […] Ein monokulares Modell dagegen schloß das schwierige Problem der Versöhnung der ungleichen und darum provisorischen, tentativen Bilder, die sich jedem der beiden Augen bieten, aus.”[6]
Crary gelingt es zu zeigen, wie im 19. Jahrhundert das statische Modell der geometrisierenden Optik, die den Betrachter mit einem Blickpunkt gleichsetzt, durch eine Auffassung ersetzt wird, die Sehen als zeitgebundenes Wechselspiel von Reizen und körperlichen Prozessen versteht. Bestätigt sieht er sich auch von Michel Foucault, der in Die Ordnung der Dinge den Bruch zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert ansetzt, der die alten, kategorisch fixierten Repräsentationssysteme verabschiede, und mit “archäologischen” Freilegungen in Naturgeschichte, allgemeiner Grammatik und ökonomischem Wertesystem diese historische Dekonstruktion der enzyklopädischen Erkenntnis zu demonstrieren versucht.
Repräsentation und Malcolm Morleys Raster
Als Abgesang auf die Repräsentationssysteme stellt Foucault in Die Ordnung der Dinge der wissenschaftsgeschichtlichen Analyse seine hervorragende Bildanalyse von Velázquez’ Las Meninas (Die Hoffräulein) voran. Auch wenn dort die Wirklichkeit der Modelle, wie sie Brunelleschis Spiegelkonstruktion und die Camera obscura ausnützen, durch die Reflexivität des zweidimensionalen symbolischen Bildraums ersetzt wird, klingt etwas von den Strukturen der Modelle nach: Fast als eine Inverse der Camera hüllt das Licht, “indem es die Szene überflutet (sowohl das Zimmer als auch die Leinwand, das auf der Leinwand repräsentierte Zimmer und das Zimmer, in dem die Staffelei aufgestellt ist), die Personen und Betrachter ein und zieht sie durch den Blick des Malers zu dem Punkt, wo der Maler sie repräsentieren wird”.[7] Und dort, wo sich der malende Velázquez befunden hat und wir als Betrachter uns wiederfinden, sitzt in der angenommenen Wirklichkeit des Bildes das vom gemalten Maler zu malende Königspaar, das sich im gemalten Spiegel am Ende des Bildraumes undeutlich zeigt. Wenn Thomas Struth für eines seiner Museumsbilder, Museo del Prado 7, Madrid 2005, den Raum vor dem Bild fotografiert, hat sich der Blickwinkel verschoben. Velázquez’ Bild findet sich in der rechten oberen Ecke der Fotografie wieder, und vor den Hoffräulein stehen Mädchen in Schuluniform, in Strümpfen und karierten Röcken. Ein historisch markierter Bildraum kommentiert hier einen anderen und thematisiert gleichzeitig das Verhältnis zwischen Fotografie und Malerei sowie zwischen Kunst und ihrer (Nicht-)Rezeption im Museum.
Zu einer anderen Form von Reflexivität findet Malcolm Morley, wenn er eine Plakatreproduktion von Jan Vermeers Malkunst malend reproduziert. Während auf Struths Foto der gemalte Spiegel immer noch sowohl den Bildraum des fotografierten Bildes als auch den des Fotos erweitert, spannt Morley eine gerasterte Reproduktion des Fotos gleichsam als Farbfilter zwischen zwei gemalte Bilder. Nicht so raffiniert wie bei Velázquez, wo sich die Blicke der Betrachter mit dem des gemalten Malers treffen, blicken wir bei Vermeers Malkunst in dieselbe Richtung wie der in Rückenansicht abgebildete Maler und haben freie Sicht auf sein Modell. Dass der Bildraum Vermeers wie bei ihm üblich von links und vom Hintergrund her beleuchtet ist, während bei Velázquez’ Las Meninas das Licht im Vordergrund und von rechts einfällt, zwingt Vermeer, anders als bei Velázquez’ dunklen Andeutungen der an den Wänden hängenden Bilder, die Wandkarte im Hintergrund genau darzustellen, sodass sie als topologische Darstellung der Niederlande vor 1581 bestimmbar ist. Statt Velázquez’ Rückseite einer Leinwand zeugt Vermeers schwerer, zurückgezogener Vorhang am linken Bildrand von einer noch ungebrochenen, klassischen Auffassung von Repräsentation und Realismus, die auf dem Tisch liegende Maske symbolisiert die Mimesis. Auch hier wird also ein System von Repräsentationen aufgefahren, für das die Landkarte als paradigmatisch gelten kann und das Jean Baudrillard gleich am Anfang seiner Schrift Agonie des Realen verabschiedet. Er fängt dort mit einer Erzählung von Jorge Luis Borges an, nämlich mit der von der Karte, die sich mit dem von ihr abgebildeten Gebiet deckt, um zum Schluss zu kommen:
“Heutzutage funktioniert die Abstraktion nicht mehr nach dem Muster der Karte, des Duplikats, des Spiegels und des Begriffs. Auch bezieht sich die Simulation nicht mehr auf ein Territorium, ein referentielles Wesen oder auf eine Substanz. Vielmehr bedient sie sich verschiedener Modelle zur Generierung eines Realen ohne Ursprung oder Realität, d. h. eines Hyperrealen. Das Territorium ist der Karte nicht mehr vorgelagert, auch überlebt es sie nicht mehr. Von nun an ist es umgekehrt: […] Nicht die Karte, sondern Spuren des Realen leben hier und da in den Wüsten weiter, nicht in den Wüsten des REICHES, sondern in unserer Wüste, in der Wüste des Realen selbst.”[8]
Wie eine Baudrillard zuvorkommende Illustration dieser kartografischen These wirkt es, wenn Malcolm Morley seine Vorlage rastert, um 180 Grad dreht, um beim Malen den Gestalt wahrnehmenden Gesamteindruck zu stören, um Raster um Raster die von diesen erfassten Farbverhältnisse zu übertragen. Allerdings vergröbert Morleys flächiger Auftrag von Acrylfarbe die Darstellung, der Vierfarbendruck des Plakats wird im Gemälde an den Rändern der Figuren und vor allem der schwarzen und weißen Platten des Atelierbodens sichtbar. Jean-Claude Lebensztejn weist darauf hin, dass Morley selbst für seine Malerei einen anderen Namen als Hyper- oder Fotorealismus bevorzugte:
“Post-Pop? Radical Realism? Sharp-Focus Realism? Photographic Realism? Ektachromism? In France and other countries, ‘Hyperrealism’ became the catchword, while in the United States ‘Photo-Realism’ took hold. Morley didn’t like this term […]. He chose ‘Superrealism’ for himself (Mondrian had already used the phrase ‘Superrealist art’ in 1930); later, perhaps to maintain his distance, he spoke of ‘fidelity paintings.’”[9]
Morleys Gemälde Race Track, die Übertragung eines Posters einer südafrikanischen Reisagentur (1970), zeigt eine Pferderennbahn. Indem er die Bildfläche mit dem monotypieartig aufgedruckten X konkretisiert und damit gleichzeitig das gemalte Zitat der Reproduktion durchstreicht, bricht Morley mit der eigenen superrealistischen Malweise. Seine Eingriffe werden in dieser Phase immer drastischer und finden sowohl auf der illusionistischen Bildebene statt, indem die Vorlage zerknittert und zerrissen dargestellt wird, als auch auf der gegenständlichen selbst, indem das Bild zum Beispiel von einem Küchenmesser durchbohrt wird (Disaster, 1972–1974). Performance und Collage beziehungsweise Assemblage lassen offenbarer werden, was die akribische Malerei beim Hyperrealismus, die Serienproduktionen in der Pop-Art vergessen lassen: dass mit der Vorlage – Foto, Poster, Buchdeckel, Suppendose oder Brillo-Box – das Readymade am Ausgangspunkt dieser Kunstproduktionen und -richtungen steht.
Fotografischer Realismus im Zeichen der gekappten Indexalität
In der 1972 in Kassel von Harald Szeemann kuratierten documenta 5 wurden in der Neuen Galerie im Erdgeschoß viele Vertreter der von den Veranstaltern “fotografischer Realismus” genannten Richtung gezeigt – etwa Jasper Johns, Richard Artschwager, Chuck Close, Gerhard Richter, Ralph Goings, Duane Hanson, Franz Gertsch oder Malcolm Morley –, und damit wurde ihnen Geltung verschafft. Jean-Christophe Ammann nennt im Katalog sechs Kriterien, die diese Richtung auszeichnen:
a) Wie bei Richter bildet die Vorlage fast immer ein Foto oder ein Diapositiv.
b) Durch die Wahl der fotografischen, auf die Bildunterlage projizierten Vorlage wird die traditionelle Komposition ersetzt.
c) Das handschriftliche Merkmal tritt völlig zurück.
d) Der Bildgegenstand wird entsprechend der Vorlage präzis wiedergegeben.
e) Die Motive entstammen prinzipiell dem Alltag des Künstlers und seiner Umgebung.
f) Die fotografische Unterlage ist nicht ein Hilfsmittel, sondern die bewusste Ausgangssituation für das Bild eines Bildes (in der in diesem Zusammenhang extremen Formulierung Richters: ‚Das Foto ist nicht Hilfsmittel für die Malerei, sondern die Malerei Hilfsmittel für ein mit den Mitteln der Malerei hergestelltes Foto‘).”[10]
So mutig und sinnvoll es ist, für einen Katalog solche Kriterien zu formulieren, so sicher werden sie schon wegen des Mediums, in dem sie formuliert werden müssen, einer eingehenden Überprüfung nicht standhalten können. Denn wie präzis zum Beispiel gibt “präzis” die geforderte Malweise wieder? Schon Morleys einer direkten Übersetzung nahe kommende Rastermethode zeigt nicht nur die mögliche Bandbreite von Genauigkeit, sondern auch, dass sie bei gröberem Pinselstrich den expressiven Gestus nicht ausschließt; nicht anders verhält es sich mit den Malweisen, die sich der Vorlagen bemächtigen, indem diese als Lichtbild direkt auf die Leinwand projiziert werden.
Die Fixierung auf das Foto als Vorlage hat unter anderem den Vorteil, dass Fotografien selbst nicht nur historisch einen Einschnitt in die Möglichkeiten der Darstellung bedeuten, sondern, werden sie als Zeichen aufgefasst, einen idealen Gegenstand für die Diskussion über den Status von Abbild und Zeichen bilden. Charles S. Peirce teilt die Zeichenklassen ein in “ikonische”, die sich durch Ähnlichkeit, “indexalische”, die sich durch Wirkzusammenhang (wie Rauch auf Feuer), und “symbolische”, die sich durch Konvention auf ihren Referenten beziehen. Fotografien werden schon bei Peirce der indexalischen Zeichenklasse zugeschlagen. Roland Barthes folgt ihm darin, wenn er der direkten Einwirkungen der Lichtwellen auf die chemische Reaktionsfähigkeit des Fotopapiers den Vorrang einräumt vor allen Manipulationsmöglichkeiten für die Fotografierenden, sowohl was die Entwicklung in der Dunkelkammer betrifft, als auch hinsichtlich Kameraeinstellung, Objektiv, Blickwinkel, Lichteinfall, Tiefenschärfe, Blende et cetera. So kommt Barthes zu dem Schluss, dass nicht Kunst oder Kommunikation, sondern die Referenz das Grundprinzip der Fotografie sei. Dass die Fotografie im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit, Verfügbarkeit und errechneter Veränderbarkeit ein noch weniger vertrauenswürdiges Medium der Dokumentation darstellt als zur Zeit der Retuschen, ändert nichts an der Plausibilität dieser prinzipiellen Sichtweise. Wenn Camera obscura und Fotokamera als Modell für das Auge gegolten hatten – für den Physiologen Helmholtz stand schon damals die technische Defizienz (blinder Fleck, Farbenzerstreuung, Gefäßschatten et cetera) des Organs gegenüber den Apparaten fest –, so wird jetzt die auf elektronischen Impulsen basierende digitale Codierung und Prozessierung der Bilder als Modell für das Sehen gehandelt, ohne sich um die Unterschiede in Mächtigkeit und in der Organisation zu kümmern. Die digital vermehrten Möglichkeiten der Bildbearbeitung sollten den Blick eher auf die Grenze richten lassen, die Roland Barthes zwischen Kunst und Fotografie zu ziehen versucht. Seine Reflexionen in Die helle Kammer beziehen sich ja auf Erinnerungsfotografien und historische Fotografien und sind mit “studium” (Wissen) und “punctum” (ansprechendem Detail) vor allem an der eigenen Reaktion auf die betrachteten Fotografien interessiert, wobei das “punctum” als jene Verkörperung des Realen verstanden werden könnte, die sein Interesse am Bild zu wecken vermag, während für Walter Benjamin in “Kleine Geschichte der Photographie” es das Wissen ist, das Fotografien lesbar, de chiffrierbar und sie als historischen Index erkennbar macht.
Die Indexalität als neues Kunstparadigma zu installieren, versucht die amerikanische Kunsttheoretikerin Rosalind E. Krauss. Sie führt Linguistik und Lacan ins Feld und will sich – wie ihre Mitstreiter Hal Foster und Benjamin Buchloh – gegen das formalistische Modernismusverständnis der vorhergehenden Theoretikergeneration abgrenzen. In ihren Untersuchungen über Indexalität in Notes on the Index I + II geht Krauss von der Kunstfotografie (Man Ray) aus und bringt diese als physikalischen Lichtabdruck mit Marcel Duchamps Readymades in Verbindung, die für sie den eigentlichen Paradigmenwechsel von subjektiver, von expressiven Zügen nie freier Autorenkunst zum objektiven Kunstwerk darstellen. Angesichts der Vielfalt der Kunst der 1970er-Jahre fragt sie sich:
“But is the absence of a collective style the token of a real difference? Or is there not something else for which all these terms are possible manifestations?” [11]
Anlässlich von Air Time, einer Videoarbeit von Vito Acconci (1973), die ihn im Dialog mit seinem Spiegelbild zeigt, das er manchmal mit “you” anspricht, kommt sie auf Jakobsons linguistische Kategorie des “shifter” zu sprechen, zu der die Personalpronomina gehören, die nur deshalb Bedeutung hätten, weil sie diese wechseln können, weil sie “leer” seien und von Sprechenden wechselweise appropriiert werden könnten. Die gleiche Arbeit gibt Krauss Gelegenheit, Lacans “Spiegelstadium” ins Spiel zu bringen, in das Kleinkinder zwischen sechs und 18 Monaten eintreten sollen. Die Identifikation mit etwas, dass in einer primären Entfremdung als außerhalb wahrgenommen wird, ist nach Lacan die Wurzel des “Imaginären”, während der Spracherwerb mit präexistenten Rahmenbedingungen konfrontiert und damit die historische Dimension eröffne, die Grundlage alles “Symbolischen”. Für das Erlernen der Bedeutung des Symbolischen sei bei der Konfrontation des Kleinkinds mit dem eigenen Spiegelbild wichtig, dass eine dritte Person anwesend ist, die es zur Identifikation anleitet, sodass die so genannte “Triangulierung” stattfinden könne, die die Unterscheidung zwischen imaginär, symbolisch und real ermögliche, denen “Bild”, “Signifikant” und “Signifikat” entspreche.
In The Return of the Real spricht auch Hal Foster von einem Lacan’schen “shift”, einer Verschiebung, die die zeitgenössische Kunst auszeichne und sich am Werk Cindy Shermans besonders eindrücklich zeigen lasse. Er bezieht sich dabei auf drei Schemata, die Lacan in Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse bringt. Das erste Schema, Objekt – Bild/image – Geometralpunkt soll “in drei Termen an die Optik erinnern, die zur Anwendung kommt bei der operativen Montage, bei der es um eine umgekehrte Anwendung der Perspektive geht”.[12]
Die umgekehrte Anwendung besteht nach Lacans bildlicher Ausdrucksweise darin, dass der Betrachter durch das Objekt dem Blick ausgesetzt und zum Bild wird. Dieser Position ordnet Hal Foster das Frühwerk Cindy Shermans mit den Film Stills zu: “Im frühen Werk von 1975 bis 1982, von den Standfotos über die Hintergrundprojektionen zu den Centerfolds und Farbtests, beschwört Sherman das Subjekt als Bild. […] Ihre Subjekte können freilich sehen, aber viel eher werden sie gesehen.”[13]
Das zweite Schema, Lichtpunkt – Schirm – Tableau, lässt nach Lacan das Subjekt am Bildpunkt das Objekt am Lichtpunkt wahrnehmen, geschützt durch den Schirm, ohne den es vom Realen berührt und geblendet würde. Der Schirm als Fleck deckt in Lacans Illustration, die zwei konzentrische Kreise zeigt, das Zentrum ab. Sich auf die Phänomenologie der Wahrnehmung Maurice Merleau-Pontys berufend, in der Lichtexperimente mit Blendeffekt besprochen werden, bei denen ein kleiner Schirm hilft, das vom Lichtstrahl verdeckte Objekt wieder zu sehen, deklariert Lacan: “In ihrem Verhältnis zum Begehren erscheint die Realität nur als marginal.” [14] Hier sieht Foster Cindy Shermans mittleres Werk (von 1987 bis 1990) – Modefotos, Märchenillustrationen, kunstgeschichtliche Porträts und Katastrophenbilder – entsprechen. Es gelingt ihm nicht wirklich, die zweite Phase (außer zeitlich) zur ersten hin abzugrenzen, auch weil unklar bleibt, was unter “moves to the image-screen, to its repertoire of representations” verstanden werden soll.
Das dritte Schema Lacans legt die beiden ersten übereinander, so kommen in der Mitte Bild/image und Schirm zu liegen, rechts das Subjekt der Vorstellung und links der Blick. “Nur das Subjekt – das menschliche Subjekt, das Subjekt des Begehrens, welches das Wesen des Menschen ausmacht – unterliegt, im Gegensatz zum Tiere, nicht ganz diesem imaginären Befangensein. Es zeichnet sich aus. Wie das? In dem Maße, wie es die Funktion des Schirms herauslöst und mit ihr spielt. Tatsächlich vermag der Mensch mit der Maske zu spielen, ist er doch etwas, über dem jenseits der Blick ist. Der Schirm ist hier Ort der Vermittlung.”[15] Das Spiel mit der Maske soll den Blick abhalten, so wie er bei Lacan gedacht wird, nämlich böse und gefährlich, entsprechend dem begehrlichen, gefräßigen Auge. Der Schirm soll, wie Lacan sich ausdrückt, den Blick zähmen, ihn zwingen, die Waffen niederzulegen. Versagt der Ort der Vermittlung, reißt der Schirm, trete das Reale als Chaotisches, Formloses zutage. Auch Pop-Art, die er vom Surrealismus her verstehen will, besonders die Serien Andy Warhols wie die Disaster-Serie, bringt Hal Foster mit Lacans Traumatheorie und Barthes’ “punctum” in Verbindung. Gerade die “silkscreens” sollen hier die Rolle spielen, Lacans Schirm zu durchbrechen. In den Figuren von Duane Hanson oder John De Andrea sieht er den Illusionismus ihrer Künstlichkeit so weit getrieben, dass sie das Reale berühren: “This art does intentionally what some superrealist art did inadvertently, which is to push illusionism to the point of the real. Here illusionism is employed not to cover up the real with simulacral surfaces but to uncover it in uncanny things […].” Dieser Strategie stellt er eine andere zur Seite, die direkter zum Ziel führen soll: “The second approach runs opposite to the first but to the same end: it rejects illusionism, indeed any sublimation of the object-gaze, in an attempt to evoke the real as such.”[16]
Unter die zweite fallen nach Foster eben die Arbeiten Cindy Shermans. Die Gefahr beziehungsweise das Unvermeidliche, dass auch hier sich Konventionen und damit eine Formensprache bilden, sieht Hal Foster zwar, besonders hinsichtlich eines “coded expressionism”, aber die prinzipielle Möglichkeit einer Entschleierung des Realen wird nicht bezweifelt.
Michael Fried sieht in Why Photography Matters as Art as Never Before “a vast critical literature on Sherman’s work, much of it in my opinion theoretically overblown”, und in ihren Film Stills seinen eigenen schon in “Art and Objecthood” entwickelten Begriff des Antitheatralischen in der Kunst verwirklicht: “that by her own account, despite the fact that she was in effect ‘performing’ for the camera […] Sherman at the same time felt impelled to avoid displays of emotion and by implication entire scenes that might strike the viewer as theatrical in the pejorative sense of the term.”[17] Wie schon der Buchtitel ankündigt, hat Fried anders als Barthes weder Probleme damit, Fotografien als Kunst, die gerahmt als Tableau an die Wand gehängt wird,[18] gelten zu lassen (er stellt ihnen Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts gegenüber), noch damit, sie vom Genre Film her zu interpretieren, neben Shermans Stills etwa durch Arbeiten Hiroshi Sugimotos oder Jeff Walls motiviert (Letzterer teilt in seinem Catalogue raisonné die Fotografien in “dokumentarische” und “cinematografische” ein). Durch zunehmende Präsenz der Kunstfotografie sieht Fried viele seiner Themen zum Verhältnis von Realismus und Modernismus neu aufgeworfen. Er widmet ein ganzes Kapitel Barthes’ “punctum”, für den dieses nur im Nichtgestellten fotografischer Szenen zu erwarten ist. Fried will seinen “chief critical text ‘Art and Objecthood’” in Übereinstimmung mit Barthes’ “little book” sehen. Er bringt das “punctum” mit Marcel Prousts Sinnesempfindungen in Verbindung, die eine intensive Erinnerung unwillkürlich auslösen, obwohl oder weil Barthes diese Verwandtschaft verneint, der beim Ansehen einer Fotografie nicht durch seine Erinnerungen, sondern durch die Tatsache gefesselt werden will, dass das, was er sieht, wirklich existiert hat. Thomas Demands Fotografien sieht Fried von den Intentionen des Künstlers “gesättigt”. Als notwendige Voraussetzung dafür gilt ihm, dass die Kunstwerke nicht die von Demand hergestellten Raummodelle, sondern die sie abbildenden Fotografien sind. Fixierung der Modelle und Lichtverhältnisse auf das zweidimensionale Fotopapier scheint Fried zu genügen, dass nichts mehr dem Zufall überlassen ist. Warum Modelle in einer Ausstellung nicht genauso vom Kontext einer Realwelt gelöst sein können (zum Beispiel durch den Maßstab, den Sockel im Museum et cetera) und nur wegen ihrer Dreidimensionalität der Realwelt näher stehen (was Skulpturen als Kunst Probleme bereiten würde), ist nicht unbedingt einsehbar.
Sprachphilosophischer Konventionalismus im Zeichen des Symbols
Aus sprachphilosophischer Ecke kommt in den 1970er-Jahren in Amerika eine kritische Kunsttheorie, die eher der Auffassung entspringt, dass es Kunst prinzipiell unmöglich ist, das Reale in Erscheinung treten zu lassen. So schreibt Arthur C. Danto in After the End of Art:
“Die Moderne ging zu Ende, als das von Greenberg erkannte Dilemma zwischen Kunstwerken und bloßen realen Objekten sich nicht mehr in visuellen Begriffen artikulieren ließ und es unabdingbar wurde, eine materialistische Ästhetik zugunsten einer Ästhetik der Bedeutung aufzugeben. Und dies geschah, so wie ich es sehe, mit dem Erscheinen des Pop.”[19]
Danto gesteht zwar der Moderne eine materialistische Ästhetik zu, nach der sich etwa ein monochromes Bild als Gegenstand “Bild” so konkretisiert, dass es nichts mehr als sich selbst bedeutet, und die so im Readymade ihre Vollendung findet. Doch ohne sich mit dem mit ihm verbundenen Freilegen der Definitionsmacht von Kunstbetrieb und Institutionen auseinanderzusetzen, sieht er damit die Grenze zwischen Kunst und Realität überschritten beziehungsweise aufgelöst. Darauf, wie die Realität Grenzen zieht, lässt sich Danto nicht ein, doch gerade das sollen ja die Werke unter anderem sichtbar machen, die er einer materialistischen Ästhetik zuschlägt.
Anders verfährt Nelson Goodman in Languages of Art mit der Ähnlichkeit. Wenn er ihr die Funktion abspricht, mit der sich Zeichen auf ihren Referenten beziehen können, wird gleich einer ganzen Zeichenklasse Peirces das Existenzrecht entzogen:
“Tatsache ist, daß ein Bild, um einen Gegenstand repräsentieren zu können, ein Symbol für ihn sein, für ihn stehen, auf ihn Bezug nehmen muß; und daß kein Grad von Ähnlichkeit hinreicht, um die erforderliche Beziehung der Bezugnahme herzustellen. […] ‚Um ein getreues Bild herzustellen, muß man dem Kopieren des Gegenstandes, so wie er ist, möglichst nahekommen.‘ Diese einfältige Anweisung verwirrt mich; denn der Gegenstand vor mir ist ein Mann, ein Schwarm von Atomen, ein Zellkomplex, ein Fiedler, ein Freund, ein Verrückter und vieles mehr. […] Sind dies alles Weisen, in denen der Gegenstand ist, dann stellt keine die Weise dar, in der der Gegenstand ist. Ich kann sie nicht alle zugleich kopieren; und je besser es mir gelingen würde, desto weniger wäre das Ergebnis ein realistisches Bild.”[20]
Reflexionen über die Bezugsmöglichkeiten von Signifikanten hinsichtlich der Trias “imaginär”, “real”, “symbolisch” müssen sich auf dem historisch und kulturell vorgeprägten Gebiet des Symbolischen abspielen, doch Goodman als Sprachphilosoph geht eine weitere Beschränkung ein: Er lässt von den Peirce’schen Zeichenklassen “Ikon”, “Index” und “Symbol” nur die letzte gelten, wenn er allem zugesteht, durch Konvention anderes bedeuten zu können, wenn er also nicht nur Kunstwerke darauf festschreibt, bedeuten zu müssen, sondern die Bedeutung darauf, durch Definition (Norm) oder Gewohnheit zu bedeuten. Auffallend ist auch, dass mit der Fixierung auf sprachliche Bedeutung eine Art kategorischer Essenzialismus einhergeht, bei Goodmans Argumentation spricht ein Wissen um das Wesen des Wahrgenommenen (Schwarm von Atomen, Zellkomplex …) mit; so nimmt von Anfang an die Diskussion über Abbild und Abgebildetes eine andere Richtung, als wenn von phänomenologischen Überlegungen über das Kontinuum von Oberflächen et cetera ausgegangen wird.
Schon Erwin Panofsky hatte die Linearperspektive als symbolisches System angesehen.
“Denn die Struktur eines unendlichen, stetigen und homogenen Raumes, kurz rein mathematischen Raumes, ist derjenigen des psychophysiologischen geradezu entgegengesetzt.”[21]
Goodman macht sich über die Auffassung lustig, die perspektivische Darstellung mit perspektivischer Wahrnehmung gleichsetzt und die Treue der Abbildung mit Lichtstrahlenbündeln begründet, die von Bild und abgebildetem Gegenstand ausgehen und sich völlig gleichen. Von der sprachlichen Konnotation des Wahrgenommenen kommt er auf die Denotation des Repräsentierten, die für ihn eben auch sprachlich, das heißt symbolisch-konventionell beziehungsweise definitorisch fixiert ist. Im Grad der Illusion beziehungsweise in der Wahrscheinlichkeit, dass man die Repräsentation mit dem Repräsentierten verwechsle, sieht Goodman keine Skalierungsmöglichkeit für den Realismusanteil des Dargestellten. Diese Betrachtungsweise hätte zwar den Vorteil, dass auch Gegenstände der Fiktion (wie Einhörner) erfasst würden, doch würden damit eher Trickreichtum und Verbreitungsgrad der jeweiligen Symbolsprache getestet.
“Genau hier liegt, denke ich, der Prüfstein für Realismus: nicht in der Quantität der Information, sondern in der Leichtigkeit, mit der sie fließt. Und dies hängt davon ab, wie stereotyp der Modus der Repräsentation ist, wie gebräuchlich die Etiketten und ihre Verwendungen geworden sind. Realismus ist relativ; er wird durch das Repräsentationssystem festgelegt, das für eine gegebene Kultur oder Person zu einer gegebenen Zeit die Norm ist.”[22]
Es zeigt sich der grundlegende Unterschied von Goodmans Ansatz zu dem eines Foucault: Kein prinzipieller Bruch der Moderne mit den auf Kategorien beruhenden Repräsentationssystemen wird angenommen, sondern nur ein kontinuierlicher und kulturabhängiger Wechsel der Stile, das heißt auch der auf Interessen und Gewohnheiten beruhenden Kategorien, die die Referenten als solche hervortreten lassen. Die Rede von Konkretisierung, sei es durch nicht repräsentierende Abstraktion oder durch Präsentation des Gegenstands selbst wie beim Readymade, muss nach dieser Auffassung als unsinnig gelten. Was dieser Konkretisierung bei Goodman vielleicht am nächsten kommt, ist sein Begriff der “Exemplifikation”, für den als Beispiele das in der Farbe Rot geschriebene Wort “rot” oder die Stoffmuster eines Schneiders stehen. Auf bestimmte (aber nicht alle) Eigenschaften wird Bezug genommen, und gleichzeitig werden sie durch das Symbol auch gezeigt. Exemplifikation ist in der Ausdrucksweise Goodmans Besitz und Bezugnahme. Wichtig ist, dass es nicht um ein vollständiges Zeigen, sondern um ein Zeigen bestimmter, begriffsbildender Eigenschaften geht, die durch die Symbole denotiert werden und deren logische Zusammenhänge auch gezeigt werden können, sei es durch Notationssysteme (Partituren, Diagramme), sei es durch Karten wie jenes “Kunstwerk” der Bewohner der Marshall-Inseln, das Goodman als Illustration bringt, bei dem die Muscheln für “Insel” stehen, die Bambusstäbe für “Winde” und “Strömungen”, ganz im Sinne seiner konventionalistischen Devise, dass eben alles alles repräsentieren könne.
Auch Bilder und Skulpturen sind in diesem Sinn Notations- oder Symbolsysteme, nur zeichnen sie sich durch besondere Dichte aus, in der nicht alles repräsentiert oder denotiert ist und die selbst Eigenschaften wie “expressiv” aufweisen kann. So kommen Kritiker wie W. J. T. Mitchell zu Feststellungen wie,
“that semiotics, the very field which claims to be a ‘general science of signs,’ encounters special difficulties when it tries to describe the nature of images and the difference between texts and images”.[23]
In den Definitionen von Vokabular, das heißt zulässigen Symbolreihen, und Umformungsregeln, die zu formalen Sprachen und den Kalkülen der Mathematik führen, findet nicht nur der Konventionalismus seine schärfste und verbindlichste Ausformulierung, sondern hat sich auch ein mathematisch genauer, logisch konziser Begriff der Abbildung, der Zuordnung (Funktionen) etabliert. Im Zusammenhang von Symbol und Ähnlichkeit ist interessant, dass logische Zusammenhänge oder Formen sich nicht auf ein Erscheinungsbild beschränken lassen müssen. Ernest Nagel und James R. Newman bringen in ihrer Einführung zum Gödelschen Beweis das Theorem von Pappus und seine duale Entsprechung, um den Begriff der mathematischen Abbildung zu verdeutlichen, was in unserem Zusammenhang sehr schön zeigt, dass sich Zusammenhänge, die sich (durch symbolische Festlegung) logisch entsprechen, im Erscheinungsbild unterscheiden.
“(a) zeigt das Theorem von Pappus: Wenn A, B, C drei beliebige verschiedene Punkte auf einer Geraden I sind und A’, B’, C’ irgend drei verschiedene Punkte auf einer Geraden II, dann sind die drei Punkte R, S, T, die durch die Geradenpaare AB’ und A’B, BC’ und B’C, CA’ und C’A bestimmt werden, kollinear (d. h. sie liegen auf einer Geraden III).
(b) illustriert das zu obigem ‚duale‘ Theorem: Wenn A, B, C irgend drei verschiedene Gerade durch einen Punkt I und A’, B’, C’ irgend drei verschiedene Gerade durch einen Punkt II sind, dann gehen die drei Geraden R, S, T, die bestimmt sind durch die Schnittpunkte der Geraden AB’ und A’B, BC’ und B’C, CA’ und C’A, durch einen gemeinsamen Punkt III.
Die beiden Figuren haben dieselbe ‚logische Form‘, obwohl sie ganz verschieden in Erscheinung treten.”[24]
Die formalen Zusammenhänge sind für ungeübte Augen nicht so leicht zu durchblicken, aber meine einfache These ist leicht zu durchschauen: Wenn nämlich nach Goodmans konventionalistischer Devise alles für alles stehen kann (hier eben Punkte für Geraden und Gerade für Punkte), so sind nur noch logische Zusammenhänge berücksichtigt und hat das deutlich sichtbare Folgen für Erscheinungsbild und Ähnlichkeit. Nicht nur wegen der Onomatopoesien sind aber der Sprache selbst durch die Utopien der Dichter und die Dialektik der stilinteressierten Rhetoriker Möglichkeiten der Bezugnahme zugesprochen worden, die der spiegelnden Abbildung und strukturellen Ähnlichkeit, einer konkreten Realisierung dessen, von dem die Rede ist, näher liegen, als die Konventionalisten wahrhaben wollen. Eindrucksvoll hat dies Theodor W. Adorno in seiner Negativen Dialektik mit seiner Kritik am Nominalismus formuliert:
“Die permanente Denunziation der Rhetorik durch den Nominalismus, für den der Name bar der letzten Ähnlichkeit ist mit dem, was er sagt, lässt sich indessen nicht ignorieren, nicht das rhetorische Moment ungebrochen dagegen aufbieten. Dialektik, dem Wortsinn nach Sprache als Organon des Denkens, wäre der Versuch, das rhetorische Moment kritisch zu erretten: Sache und Ausdruck bis zur Indifferenz einander zu nähern. […] Das inspirierte die Phänomenologie, als sie, wie immer naiv, der Wahrheit in der Analyse der Worte sich versichern wollte. In der rhetorischen Qualität beseelt Kultur, die Gesellschaft, Tradition den Gedanken; das blank Antirhetorische ist verbündet mit der Barbarei, in welcher das bürgerliche Denken endet.”[25]
Das fehlende Kunstobjekt im simulierten Museum als Hinweis auf ein Buch
Das Museum sieht Maurice Blanchot einerseits als den Ort, aus dem die gesellschaftlichen Funktionen (in Religion und Politik) der einzelnen Kunstwerke und damit das Leben vertrieben worden sind, andererseits auch als den Ort, der eben die imaginäre Rolle spielen kann, die Kunst als Fiktion markiert. Mit dem Fortschritt der Kenntnisse und damit auch der Produktionsmittel sieht er – wie vor ihm Paul Valéry und Walter Benjamin – einen neuen Kunstbegriff heraufdämmern, weil Kunst durch die Reproduktion allgemein verfügbar werde:
“Um es in aller Schnelle in Erinnerung zu rufen, das imaginäre MUSEUM repräsentiert als erstes folgendes Faktum: daß wir alle Künste aller Kulturen kennen, die sich der Kunst gewidmet haben. Daß wir sie praktisch und auf bequeme Weise kennen, nicht aus einem idealen Wissen, das nur einigen gehören würde, sondern auf eine reale, lebendige und universelle Weise (die Reproduktionen). […] Durch die Reproduktion verlieren die Kunstgegenstände ihr Skalenmaß, die Miniatur wird zum Tafelbild, das Tafelbild, von sich selbst getrennt, fragmentiert, wird zu einem anderen Bild. Fiktive Künste? Doch die Kunst ist, wie es scheint, diese Fiktion.”[26]
Wird Reproduktion unter diesen Aspekten gesehen, sind auch die hyperrealistischen Methoden darin inbegriffen. Es handelt sich um eine ganz andere Versprachlichung der Kunst, nämlich nicht um bedeutende Kunstwerke als Sprache, sondern um ein intellektuelles Sprachwerk als Kunst, die sich verneint, wenn Marcel Broodthaers in seinem Kunstprojekt Museum als Kunstobjekt zu René Magritte auf das Buch Michel Foucaults Ceci n’est pas une pipe hinweist, mit dem Buch als Teil der objektivierbaren Realität einerseits sein Konzept: “Dies ist kein Kunstwerk”, beziehungsweise dessen Wurzel vorführend, andererseits seine Künstlerkarriere fortführend, die er 1964 mit der Ausstellung seiner eigenen in Gips gegossenen, unlesbar gemachten Gedichtbände Pense-Bête begonnen hatte. Die Schrift als Teil der Sprache, als konventionelles Bezugssystem schien verloren zu haben.
“This new form of objectification occurred when he embedded the remaining copies of the edition in a plaster base, thus adding to the process of semantic destruction by preventing the book from being opened and read at all. The extent to which the semantic and lexical dimension of poetry is annihilated paradoxically increases the plasticity and presence of the artifact.”[27]
Der Hinweis auf Foucaults Buch als Museumsstück zu Magritte gibt dem Buch als Objekt seine semantische Dimension, seine Lesbarkeit zurück, fast als ob Broodthaers in Bezug auf diesen Maler seinen künstlerischen Initialakt zugleich zurücknehmen wollte. Er versetzt durch seinen Hinweis auf Foucaults Buch dieses in den Raum der Objekte und fordert gleichzeitig auf, es zu lesen. In Foucaults Buch selbst geht es aber genau um die Differenz von Objekt, Form und Benennung, anhand einer Zeichnung Magrittes, die sein berühmtes Bild um einen Rahmen und eine zweite, im Bildraum schwebende Pfeife erweitert; es geht also um die verschränkten Verhältnisse von Realität, Abbild und Sprache.
“Wesentlich ist, daß das sprachliche Zeichen und die visuelle Darstellung niemals mit einem Schlag gegeben sind. Immer werden sie durch eine Ordnung hierarchisiert, die entweder von der Form zum Diskurs oder vom Diskurs zur Form geht. [Erstes Prinzip …] Das zweite Prinzip, das die Malerei lange Zeit beherrscht hat, behauptet die Äquivalenz zwischen der Tatsache der Ähnlichkeit und der Affirmation eines Repräsentationsbandes. Sobald eine figürliche Darstellung einer Sache (oder einer anderen Figur) gleicht, schleicht sich in das Spiel der Malerei eine selbstverständliche, banale, tausendfach wiederholte, jedoch fast immer stillschweigende Aussage ein […]: ‚Das, was man hier sieht, ist das da.‘ Auch hier tut es nicht viel zur Sache, in welcher Richtung die Repräsentationsbeziehung verläuft: ob die Malerei auf das Sichtbare verweist, das sie umgibt, oder ob sie sich allein ein Unsichtbares schafft, das ihr gleicht. Wesentlich ist, daß Ähnlichkeit und Affirmation nicht zu trennen sind.”[28]
Sind die Prinzipien, die kategorischen Hierarchien gebrochen, kommen die Symbolsysteme und damit auch die Bezugnahmen miteinander ins Spiel, werden ambivalent, denn es ist nicht mehr klar, was von wem repräsentiert wird. In der Zeichnung wird der Versuch, über die Zeichnung hinauszugehen und in einer Verwechslung Bezugnahme und Identifikation gleichzusetzen, mit der Verneinung thematisiert. Die Möglichkeiten der Denotationen werden von Foucault durchdekliniert, indem er sie innerhalb der Zeichnung aus Schrift und Bild zirkulieren lässt. Mit den Serien der Pop-Art sieht Foucault seine These von den die unterordnende Bildsyntax auflösenden Bestrebungen bestätigt. Nicht nur die Serien, auch die aus der Syntax des Storyboards herausgelöste, des narrativen Zusammenhangs beraubte Ikonografie der Comics scheint diese These zu verifizieren. Die Reproduktionen der Hyperrealisten setzen den Schnitt früher an, das Spiel beginnt bei den Übertragungen zwischen Vorlage und Gemälde, der Status der Symbolsysteme bleibt unbestimmt. Trotz fotografischer und anderer reproduzierbarer Vorlagen revidieren sie gleichsam – anders als die fotografierenden Künstler – die technische Reproduzierbarkeit, als ob sich dadurch etwas von der Aura zurückgewinnen ließe, deren Verlust Walter Benjamin konstatiert, als handle es sich um einen bewussten Akt gegen die “simultane Kollektivrezeption”, für die den Gegenstand zu bieten Benjamin der Malerei die Möglichkeit abspricht. Bild wie Zeichen erscheinen wie gereinigt, das heißt isoliert, von ihren Funktionen gelöst, während serielle Wiederholung im fast kontemplativen Akt der malerischen Reproduktion abgebrochen wird. Die Vorlage selbst, zwischen Fundstück und fotografischer Indexalität changierend, lässt offen, ob von diesem strukturalen Transformationsraum zwischen Vorlage und hyperrealistischer Abbildung aus noch auf etwas außerhalb, auf ein vorstrukturiertes Reales Bezug genommen werden kann. Ein hoffnungsvollerer Jargon würde dieses, sich selbst damit mitbeschreibend, an den unbesetzten Leerstellen der Darstellungen durchscheinen sehen wollen, obwohl gerade diese Stellen es sind, die für die Bildung eines Stils zuständig sein sollen.
|||
* Hyper Real: Die Passion des Realen in Malerei und Fotografie – Katalog Wien Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien ( MuMOK) – 22. Oktober 2010 bis 13. Februar 2011 ; Deutsch | English , Texte von Monika Faber , Edelbert Köb , Benedikt Ledebur , Susanne Neuburger , Interview von Brigitte Franzen mit Jean-Christoph Ammann – Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2010 , ca. 350 Seiten, 274 Farb-Abb., € 38.-
|||
- [1] Jacques Lacan, Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das Seminar Buch XI (Berlin: Quadriga Verlag, 1987): 118. ↩
- [2] Erwin Panofsky, “Die Perspektive als ‚symbolische Form‘” (1924/1925), in: ders., Deutschsprachige Aufsätze I, II (Berlin: Akademie Verlag, 1998): 666; sowie Jean-François Lyotard, Essays zu einer affirmativen Ästhetik (Berlin: Merve Verlag, 1982): 79. ↩
- [3] Paul Feyerabend, Wissenschaft als Kunst (Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1984): 17 ff. ↩
- [4] Ebd.:23. ↩
- [5] Jonathan Crary, “Die Modernisierung des Sehens” (1988), in: Bernd Stiegler (Hg.), Texte zur Theorie der Fotografie (Stuttgart: Reclam, 2010): 206–224. ↩
- [6] Ebd.: 210 f. ↩
- [7] Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge (Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1991): 34. ↩
- [8] Jean Baudrillard, Agonie des Realen (Berlin: Merve Verlag, 1978): 7 f. Wie aktuell die Karte als Paradigma immer noch ist, siehe auch Band 202, Mai/Juni 2010, des “Fiktion der Kunst der Fiktion” gewidmeten Kunstforums, S. 132: “Das Ganze scheint realer als seine fiktiven Teile: Kartografische Arbeiten von Wim Delvoye, Michael Müller und Susanne Weirich.” ↩
- [9] Jean-Claude Lebensztejn, Malcolm Morley: Itineraries (London: Reaktion Books, 2001): 47. ↩
- [10] In: Harald Szeemann et al. (Hg.), documenta 5, Katalog (Kassel: documenta GmbH, 1972): Registerblatt 15. ↩
- [11] Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths (Cambridge/MA: MIT Press, 1986): 196 f. ↩
- [12] Lacan (wie Anm. 1): 98. ↩
- [13] Hal Foster, “The Real Thing”, in: Cindy Sherman, Katalog (Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen, 1996): 80 f. ↩
- [14] Lacan (wie Anm. 1): 115. ↩
- [15] Ebd.: 114. ↩
- [16] Hal Foster, The Return of the Real (Cambridge/MA: MIT Press, 1996): 152. ↩
- [17] Michael Fried, Why Photography Matters as Art as Never Before (New Haven/CT: Yale University Press, 2008): 7. ↩
- [18] Fried greift eine These des französischen Kunstkritikers Jean-François Chevrier auf, der damit den Anfang der Kunstfotografie markiert sieht. ↩
- [19] Arthur C. Danto, Das Fortleben der Kunst (München: Wilhelm Fink Verlag, 2000): 111. ↩
- [20] Nelson Goodman, Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie (Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1997): 17 ff. ↩
- [21] Panofsky (wie Anm. 2): 666. ↩
- [22] Goodman (wie Anm. 20): 45. ↩
- [23] W. J. T. Mitchell, Iconology – Image, Text, Ideology (Chicago/IL: The University of Chicago Press, 1986): 53. ↩
- [24] Ernest Nagel, James R. Newman, Der Gödelsche Beweis (München: R. Oldenbourg Verlag, 2001): 67. ↩
- [25] Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1992): 65 f. ↩
- [26] Maurice Blanchot, Museumskrankheit. Das Museum, die Kunst und die Zeit (Köln: Verlag Wilfried Dickhoff, 2007): 12 f ↩
- [27] Benjamin H. D. Buchloh, “Open Letters, Industrial Poems”, in: October, 42 (1987): 80 ↩
- [28] Michel Foucault Dies ist keine Pfeife (München: Carl Hanser Verlag 1997): 25 f ↩