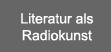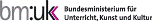||| EICHMANN REVISITED | DIETER WELLERSDORF ERZÄHLT VOM KRIEG | KARIN DUVE VERSUCHT BESSER ZU ESSEN
EICHMANN REVISITED
![]() czz – Vor 50 Jahren – am 11. April 1961 – begann der aufsehenerregende Prozess gegen Adolf Eichmann, dessen detaillierte logistische Planung die Judentransporte in die Konzentrationslager ermöglicht hatte. Das in Jerusalem angestrengte Verfahren klagte Eichmann u. a. des «Verbrechens gegen das jüdische Volk» und der «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» an, mithin der Beteiligung an der Ermordung von rund sechs Millionen Juden.
czz – Vor 50 Jahren – am 11. April 1961 – begann der aufsehenerregende Prozess gegen Adolf Eichmann, dessen detaillierte logistische Planung die Judentransporte in die Konzentrationslager ermöglicht hatte. Das in Jerusalem angestrengte Verfahren klagte Eichmann u. a. des «Verbrechens gegen das jüdische Volk» und der «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» an, mithin der Beteiligung an der Ermordung von rund sechs Millionen Juden.
Zu den juristischen und ethischen Fragen eines solchen nie zuvor gekannten Prozesses äussern sich der bedeutende Denker Karl Jaspers und die ebenso kluge wie umstrittene Philosophin Hannah Arendt im Gespräch mit namhaften Publizisten. Knapp nach Beginn des Prozesses äussert sich Jaspers gegenüber dem Publizisten François Bondy, dahingegen findet das Interview von Joachim Fest mit Hannah Arendt im Jahr 1964 (also nach dem Prozess) statt.
Während Jaspers den Anklagepunkt des «Verbrechens gegen die Menschlichkeit» zum «Verbrechen gegen die Menschheit» erweitert, bezweifelt er die Zuständigkeit einer Einzelnation – hier habe «die Menschheit» zu richten. Im Kontrast zu der verhaltenen Diktion des Freundes tritt Hannah Arendt in hochenergetischem Duktus auf. Sie nutzt die Gelegenheit, um einige Streitpunkte anhand ihres – erst 1964 in deutscher Übersetzung vorliegenden – Buches «Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen» zu verdeutlichen:
Die Banalität dieses Verbrechens meint nicht Alltäglichkeit in dem Sinn, dass in jedem ein Eichmann sässe, sie bezeichnet vielmehr eine spezielle Dummheit [. . .], die vom Schicksal der anderen unberührt bleibt.
Zum echten Hördokument wird dieser dichte Dialog durch die vitale Lebendigkeit, mit welcher Arendt ihre Argumente bekräftigt. Mit Aplomb schlägt sie auf den Tisch, lässt die Kaffeetassen tanzen, Zigaretten werden angezündet. In dieser Intensität ist dergleichen selten zu hören.
- Hannah Arendt | Karl Jaspers: Eichmann – von der Banalität des Bösen, Originalaufnahmen. 1 CD (75 Min.), SWR| Quartino 2010
|||
DIETER WELLERSDORF ERZÄHLT VOM KRIEG
![]() czz – Wie kühl und konzis vom Kriege zu sprechen sei, stellt Dieter Wellershoff in freier Rede unter Beweis. Der heute 86-jährige Schriftsteller konfrontiert sich mit Einzelheiten des Kriegsgeschehens, wie sie der damals junge Mann während der letzten beiden Kriegsjahre erlebte.
czz – Wie kühl und konzis vom Kriege zu sprechen sei, stellt Dieter Wellershoff in freier Rede unter Beweis. Der heute 86-jährige Schriftsteller konfrontiert sich mit Einzelheiten des Kriegsgeschehens, wie sie der damals junge Mann während der letzten beiden Kriegsjahre erlebte.
Zunächst in Berlin stationiert, wurde der damals kaum 18 Jahre alte Soldat an die Ostfront verlegt, um dort den Stellungskrieg in all seiner Misere mitzuerleben. Die leibliche und seelische Verkommenheit in den dreckigen Gräben, oft nur wenige Meter vom «Iwan» entfernt, widerspricht aufs Grausamste jener Idealisierung des Krieges, wie sie der Knabe im Sinne männlicher Bewährung in den Versen Schillers und Hölderlins kennengelernt hatte. «Mein Horizont», sagt Wellershoff heute, «war auf das Nächste beschränkt.» In vielen detaillierten Episoden illustriert er, in welchem Masse der einfache Soldat auf den Körper und das pure Überleben zurückgeworfen war.
Die präzise Erinnerung und der betont nüchterne Blick schulden sich einer «Durcharbeitung» der Kriegserlebnisse, die Dieter Wellershoff in seinem Buch «Der Ernstfall» 1995 dokumentierte. Die wiederholte Selbstaufforderung «Schau dir das an, das ist der Krieg» belegt die vergebliche Suche nach einer übergeordneten Ratio. Der Verlust aller Werte und das Chaos, in welches das Kriegsende eine Gesellschaft von «zufällig» Überlebenden entliess, haben sich Wellershoff und seine Generation als «Stunde null» tief eingeprägt. Weitgehend chronologisch, mit einigen Vor- und erklärenden Rückgriffen, ist mit Dieter Wellershoff ein hoch agiler Berichterstatter am Wort, dessen unsentimentaler Erzählung man mit Faszination und Grauen lauscht.
- «Schau dir das an, das ist der Krieg.» Dieter Wellershoff erzählt sein Leben als Soldat, 3 CD (215 Min.), Supposé 2010
hr2 – Hörbuchbestenliste vom Dezember 2010|||
KARIN DUVE VERSUCHT BESSER ZU ESSEN
NZZ , 1. 4. 2011 czz – Eingeschweisstes Schweinernes oder Flügel von glücklichen Hühnern? Vom Überdruss am Überfluss unter Bedingungen industrialisierter Tierproduktion handeln rezente Überlegungen von Autoren jüngeren Alters, wie angemessen zu essen sei. Nach David Foster Wallaces «Consider the Lobster» und Jonathan Safran Foers Überlegungen, ob «Eating Animals» ökologisch und ökonomisch vertretbar sei, meldet sich Karen Duve mit dem Protokoll eines Selbstversuchs zu Wort.
czz – Eingeschweisstes Schweinernes oder Flügel von glücklichen Hühnern? Vom Überdruss am Überfluss unter Bedingungen industrialisierter Tierproduktion handeln rezente Überlegungen von Autoren jüngeren Alters, wie angemessen zu essen sei. Nach David Foster Wallaces «Consider the Lobster» und Jonathan Safran Foers Überlegungen, ob «Eating Animals» ökologisch und ökonomisch vertretbar sei, meldet sich Karen Duve mit dem Protokoll eines Selbstversuchs zu Wort.Wie ihre Kollegen nähert sich Duve dem Thema weitgehend frei von Alarmismus. Sie verrechnet das Soll zum «Anständig Essen» mit dem Haben von kulturellen Traditionen, individuellen Vorlieben und menschlichen Schwächen. Wo die Grenze zwischen Ideologie und Information schwierig zu ziehen ist, soll das Selbstexperiment Klarheit schaffen: Je zwei Monate auferlegt sich die Autorin verschiedene Spezialdiäten, angefangen bei biologischen Produkten über vegetarisch, vegan bis hin zu einer Ernährung, welche – im Sinne, keine Pflanze zu schädigen – ausschliesslich aus Früchten besteht (frutarisch).
Wie man isst, um zu überprüfen, wer man sei – das stellt den Kopf vor eine Reihe von Dilemmata, bleibt allerdings oft eine spontane Magenfrage. Duve argumentiert dezidiert als praktische Probandin, ohne Anspruch, die Fachfrau abzugeben, und beobachtet sich mit dem ihr eigenen trockenen Humor. Sprachlich klar und kraftvoll, stellt sie sich den Anforderungen der jeweiligen Diät, um nach elf Monaten zu resümieren, auch nicht wesentlich gescheiter zu sein. Die Mikrodramen des täglichen Brots tönen sympathisch pragmatisch und bergen ebenso witzige wie erhellende Momente.
- |||