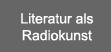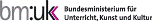W. G. SEBALD , INS AUDITIVE TRANSPONIERT
 czz -Mit dem wenige Monate vor seinem Unfalltod 2001 erschienenen Roman «Austerlitz» hat W. G. Sebald ein Vermächtnis hinterlassen, in welchem autobiografische Momente in eine fiktive Biografie fliessen, der zugleich die Poetologie des Autors eingeschrieben ist.
czz -Mit dem wenige Monate vor seinem Unfalltod 2001 erschienenen Roman «Austerlitz» hat W. G. Sebald ein Vermächtnis hinterlassen, in welchem autobiografische Momente in eine fiktive Biografie fliessen, der zugleich die Poetologie des Autors eingeschrieben ist.
Anhand von zufälligen, sich über dreissig Jahre hin erstreckenden Begegnungen des Erzählers mit dem Kunsthistoriker Jacques Austerlitz tastet sich Letzterer tiefer und tiefer in die Erinnerung hinab, um sich dem Rätsel seiner Herkunft zu stellen. Im von den Deutschen annektierten Prag war es Austerlitz’ Mutter gerade noch gelungen, den Knaben in einem Kindertransport nach England unterzubringen, bevor sie selbst nach Theresienstadt und in die Vernichtung abgeschoben wurde. Die Rolle des Erzählers geht fast vollständig im Rapport der Gespräche mit Austerlitz auf und stellt damit eine Reihe von Erinnerungen dar, in welche ihrerseits Austerlitz’ Erinnerungen eingefaltet sind.
Ein vom Mitteldeutschen Rundfunk produziertes Hörspiel rafft den an die 400 Seiten langen Text mit kluger Hand zu achtzig Minuten Laufzeit, ohne dass der Eindruck entstünde, es fehle Wesentliches. Neben den charakterstarken Sprechern (Ulrich Matthes als Erzähler, Ernst Jacobi als Austerlitz) setzt Stefan Kanis’ präzise Regie deutliche Akzente, welche eher als akustische Interventionen wahrnehmbar sind denn als blosse Illustrationen:
Einerseits wird der Bericht des Erzählers in einem anderen Klangraum präsentiert als Austerlitz’ direkte Zitate, anderseits spiegeln wiederkehrende Signale wie Bahnhofslärm, Türenschlagen und Eisenbahnrattern Sebalds leitmotivische Erzählweise. Selbst der Sebaldschen Methode, Fotografien als Erinnerungsmedien heranzuziehen, wird – ins Klangliche übersetzt – durch Einblenden jener diskreten Sounds Rechnung getragen, welche eine Tonaufnahme und -wiedergabe begleiten. Sinnfälliger kann man Sebalds Poetik kaum ins Auditive transponieren.
- W. G. Sebald: Austerlitz, Hörspiel. Bearbeitung und Regie: Stefan Kanis. 1 CD (83 Min.) – MDR | Der Hörverlag 2012 ( page )
- Platz 2 @ Hörbuchbestenliste hr2 Mai 2012
|||
WOLFGANG HERRNDORFS NARRATIVER WAHNWITZ
 czz – Der 1965 in Hamburg geborene Wolfgang Herrndorf war zunächst mit Texten hervorgetreten, welche die Genres von Berlin-Roman und Pop-Story erprobten. Unübersehbar war diesen Stücken aber auch die Skepsis des Autors hinsichtlich der gängigen Hauptstadtprosa eingeschrieben. Es ist, als habe Herrndorf aus dieser Abklärung jenen neuen Schwung bezogen, welcher den Adoleszenz- und Schelmenroman «Tschick» mit all seiner Fabulierlust, seinem Sprachwitz und seiner trockenen Situationskomik prägt.
czz – Der 1965 in Hamburg geborene Wolfgang Herrndorf war zunächst mit Texten hervorgetreten, welche die Genres von Berlin-Roman und Pop-Story erprobten. Unübersehbar war diesen Stücken aber auch die Skepsis des Autors hinsichtlich der gängigen Hauptstadtprosa eingeschrieben. Es ist, als habe Herrndorf aus dieser Abklärung jenen neuen Schwung bezogen, welcher den Adoleszenz- und Schelmenroman «Tschick» mit all seiner Fabulierlust, seinem Sprachwitz und seiner trockenen Situationskomik prägt.
Letztlich hat sich der jüngste Roman «Sand» völlig von den Imperativen deutscher Zeitgeistprosa gelöst: Der einzige bundesrepublikanische Bezug – nämlich die Geiselnahme von israelischen Athleten während der Olympischen Spiele in München 1972 – dient allenfalls der historischen Situierung der turbulenten Handlungsstränge. Geografisch sind die chaotisch-absurden Ereignisse irgendwo im Maghreb angesiedelt, wo Agenten und Aussteiger, Kriminelle und Kommunarden die postkoloniale Agonie schrill aufmischen.
Der titelgebende «Sand» deutet nicht nur auf den Spielort der Wüste hin, sondern fasst auch treffend metaphorisch das Hauptcharakteristikum dieses liebevoll mit zahlreichen literarischen Bezügen und Phantasmagorien aller Art gespickten Werks: Wollte man sie zusammenfassen, so rieselten die Haupt-, Teil- und Neben-Plots wie Sand durch die Finger. – Die mit Stefan Kaminski glänzend besetzte auditive Fassung konturiert Herrndorfs anarchische Lust am Fabulieren. Sein notorisch unzuverlässiger Erzähler erinnert ebenso wie manche der bizarren Szenen an die Prosa Thomas Pynchons, womit sich der narrative Wahnwitz als stilistische Methode offenbart.
- Stefan Kaminski liest Wolfgang Herrndorf: Sand. 11 CD (807 Min.) – Argon 2012 ( page )
|||
ANDREA MARIA SCHENKEL : WEITER IM TEXT
 czz – Hatte Andrea Maria Schenkel mit ihrem Krimidebüt «Tannöd» (2006) und dessen Nachfolgeroman «Kalteis» (2007) namhafte Preise abgeräumt und nebenher enorme Verkaufserfolge erzielt, wurde «Bunker» (2009) weniger enthusiastisch aufgenommen.
czz – Hatte Andrea Maria Schenkel mit ihrem Krimidebüt «Tannöd» (2006) und dessen Nachfolgeroman «Kalteis» (2007) namhafte Preise abgeräumt und nebenher enorme Verkaufserfolge erzielt, wurde «Bunker» (2009) weniger enthusiastisch aufgenommen.
Mit dem kürzlich erschienenen «Finsterau» tritt zwar erstmalig ein dreisilbiger Titel auf den Plan, jedoch kehrt die Autorin in Form und Methode zu ihrem Erfolgsrezept zurück: Wie in den beiden ersten Romanen liegt dem Erzählten ein historischer Kriminalfall im Bauernmilieu und unter Kleinbürgern zugrunde. Wo es keinen allwissenden Erzähler gibt, verweben sich die «Zeugenaussagen» zu einem Patchwork der verschiedensten Perspektiven, welche – gegen Ende hin enggeführt – auf den Verbrecher verweisen.
So geht der Plan für «Finsterau», wo die junge Afra – ledig, schwanger – ins ärmliche Elternhaus zurückkehrt, wo sie mit ihrem «Bankert» die Schmach der Familie darstellt. Als dann eines Tages im Jahr 1947 Afra und ihr Knabe tot in der Küche aufgefunden werden, sitzt Vater Zauner apathisch da, lässt sich widerstandslos abführen und ein Geständnis abpressen. Erst eine Revision des Verfahrens achtzehn Jahre später bringt den tatsächlichen Mörder an den Tag, wobei die Tatsache, dass die Bluttat eigentlich auf einem Zufall beruhte, kriminologisch unbefriedigend bleibt.
So, wie der Roman den modischen «Exotismus des Regionalen» bedient, so nachlässig geht Schenkel mit der Sprache ihrer Protagonisten um: Auffallend ist die Einebnung jener distinkten Sprachregister, welche den Figuren in früheren Büchern einerseits mundartliche «Eigensprache» zuerkannt hatten, nebst einem holprigen Hochdeutsch bei «offiziellen» Zeugenaussagen. Auch verbale Anachronismen fielen bei einem professionellen Sprecher womöglich kaum auf, wirken allerdings in der etwas schwerfälligen Lesart der Autorin störend.
- Andrea Maria Schenkel liest: Finsterau, 3 CD (178 Min.) – Hoffmann und Campe 2012 ( page )
|||