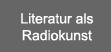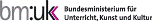Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text
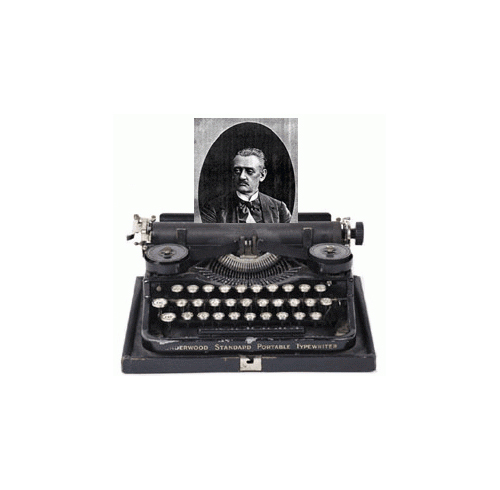
Ludwig Ferdinand Schmid alias Dranmor
Salon Littéraire | Hartmut Abendschein :
Dranmor | 01¹
Über “Dranmor”
Es zischt und schmatzt und löst sich auf. Erst in Phasen und seltenen Farben, dann verzieht sich ein Teil nun schwefelnder Lache fluchend wieder nach oben durch den Wandbruch, dorthin, wo er wohl herkam. Für den Kopf des dampfenden Wesens ist es zu spät. Er zerfällt unter lautem Getöse zu Staub und fliesst aufgescheucht durch den Ausguss ab. Zurück bleiben ein paar einzelne Seiten. Nach Verzug des Rauches sind bald Wörter und ganze Sätze darauf erkennbar. Sätze einer Handschrift. Man reibt sich die Augen. Da ist eine Abschrift aus dem Vorwort zur dritten Auflage der Gesammelten Dichtungen.
Die historische Person Ludwig Ferdinand Schmid alias Dranmor ( 1823-1888 ) ist ein längst vergessener Schweizer / Berner Dichter und Diplomat. Seine Person und sein Werk dienen in diesem Fragment-Roman als Bearbeitungsoberfläche des Ich-Erzählers. In der Sekundärliteratur wird Dranmor als “Mann des Übergangs” oder auch als “seltsamer Mann” beschrieben, getrieben von einer großen Lust auf Literatur und fernen Zielen. Geboren in Bern, lebte er einige Zeit in Österreich in k.u.k.-Diensten, um dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nach Brasilien zu reisen, dort Österreich zu vertreten und sich engagiert um die Kolonialisierung bestimmter Landstriche Brasiliens zu bemühen. Seine Bemühungen scheiterten. Er reiste wieder nach Bern zurück, wo er unter mysteriösen Umständen starb.
Im Zentrum der Erzählung, die sich in der Gegenwart situiert, steht ein Ich-Erzähler, der Dranmor auf der Spur ist bzw. diesen “ausgraben” will. Die Wahrnehmungen des Erzählers, der sich immer mehr in Vergangenheiten verstrickt und diese klittert, seine Aufzeichnungen, Exzerpierungen, Reflexionen und sein kontinuierlicher Zerfall, der auch mit Dranmors Vita parallel geführt wird, machen diesen Text auch zum Erzählexperiment. Zentrale Motive des Textes sind: das Schreiben und Zur-Sprache-Finden des Erzählers, die Bedeutung von Literatur an sich und die Identifikation mit Vorgängern sowie am Rande: Heimat / Fremde / Exilierung.
|||
Büros
Und im Kulturbüro. Was macht man in einem Kulturbüro? Was macht es mit uns? Roman kann mir darüber keine klare Auskunft geben. Immer wieder fallen die Wörter Kommunikation und Unterstützung. Er wechselt das Thema. Er schreibe aber gelegentlich auch für ein Magazin. Ein Werbeblättchen, für das er ab und zu einen kleinen Beitrag verfasse, hört man heraus. Natürlich in der Freizeit, wie er sagt. Dann folgt ein ausgiebiges Schwärmen von seinem Büro. Zwischen den Wörtern liegen Kellergewölbe. Ein Gewölbe aus hellblauem, weichpoliertem Stein. Ein Kellergewölk im Souterrain eines Altstadthauses. Er vermittele also Kontakte und verleihe auch Instrumente und technisches Gerät. Interessante Leute träfe er da immer wieder, und er erhoffe sich, er könne diese Kontakte auch einmal für sich selber nutzen. Und es bleibe jede Menge Zeit, für seine kleinen Schreibprojektchen.
In seinen E-Mails wird er nicht konkreter. Auf Rückfragen reagiert er irritiert. Einsilbig, fast ausweichend; feilt lustlose Weiterleitungen in ironische Wendungen, Bemerkungen, die am Ende häufig wieder in seinem Büro enden, in dem er wieder halbwegs ungestört sei, in dem er tun und lassen könne, was er wolle, in dem er sich einfach wohl fühle – was will man denn mehr?
Man sitze auch in einem Büro, will man antworten. Dort rolle man gleichförmig nach vorne, nach hinten, bald zu den Seiten, bis man seinen Rhythmus findet und langsam mit dem Becken einen Kreis skizziert: als wolle man mit dem Schreibtischstuhl die PVC-Unterlage zirkeln und einen perfekten Kreis beschreiben. Die Kiwi und die Banane haben das Wochenende nicht überlebt. Die Banane ist braun und füllt den Raum mit intensiver Fäule. Die Kiwi bekommt schon nach leichten Berührungen Druckstellen – Haare fallen ihr aus. Der Drucker summt im Stillstand ein leises Lied dazu und begleitet meinen Blick zu den Buchreihen, die wieder angewachsen sind. Jedes einzelne wartet geduldig – ist es etwa aufgeregt? – in einer für ihn geschaffenen Reihe. Ein fast britisches Schlangestehen, wie an den Kassen die jungen Clubgänger in einer Freitagnacht, die amüsierwütigen Bücher vor dem Einlass. Man mime den Bookbouncer und entscheide über ihren weiteren Weg. Der Bouncer, der ihnen vielleicht ein Schlagwort verpassen wird, oder nicht – nach eingehender Untersuchung und Begutachtung, dann dürfen sie passieren. Die anderen wandern in eine andere Schlange. Wie viele werden es heute sein?
Die Risse an der Decke bilden eine angenehme Symmetrie, ein gleichschenkliges Dreieck mit einer Deckenecke. Verputz, der sich erst seinen Namen verdient, wenn er fällt. Ein alter Radiator lässt den Kopf hängen, auf dem Regal hinter mir. Zu recht. Es geht ihm gut unter dem abblätternden Bildnis Wilhelm Augusts von Holstein-Gottorf, wie man auf der rückwärtigen Leinwand plötzlich entdeckt. Er verbeugt sich würdevoll vor dem Fürsten, oder war es ein Herzog? Dessen rechte Hand ruht gelassen auf einem bleichen Globus, als streichele er zärtlich Afrika oder einen anderen südlichen Kontinent. Die Linke schaut aus einem Rüschenärmel hervor und hält einen geöffneten Brief mit rotem Siegel. Es scheint ihn nicht weiter zu interessieren, und so lächelt er mich milde von oben herab an. Der Globus steht auf einem goldgefassten Tisch, darunter stranguliert sich ein Erpel mit einem Seil. Auf ihm ruht ein Helm mit Federn, vielleicht Fasan, ein Ausschnitt einer Schweizer Karte – wahrscheinlich Mitte 18. Jahrhundert. Etwas Säbelrasseln ist zu vernehmen. Der Säbel und daneben ein Orden mit den Initialen I.H.S. Sind sehr auffällig. Warum hängt mir der noch jugendliche Wilhelm August im Rücken? Was sucht er in diesem Zimmer? Was suche ich?
Dem Radiator ist das egal. Er weiss, was sich gehört und stellt keine weiteren Fragen. Den nächsten Sommer wird er stromlos durchschweigen. Der Drucker summt dazu, summt das alte Lied seniler Ventilatoren. Mimikri. In meinem Jugendzimmer unterm Dach gab es einen grossen Deckenventilator. Ohne die Umwälzungen der Luft in den Sommern vieler Jahre wäre es dort nicht auszuhalten gewesen. Auf welchem Schrottplatz rostet er nun? Hat man ihn anständig begraben? Oder ist er nun eine Dose? Mein Blick fällt auf Maria. Aglaonema Maria lautet ihr vollständiger Name. Eine Zimmerpflanze, die ich zum Antritt der Stelle von meiner Abteilung geschenkt bekam. “Lichtbedarf gering. Giessen / Düngen: regelmässig”. Sie wird etwas unscharf, wenn man sie nur lange genug anstarrt. Von Zeit zu Zeit streichle ich etwas Staub von ihren wächsernen Blättern. 430795 15/19 – ein von mir noch nicht entschlüsselter Code auf ihrem Datenblatt am Rand des Topfes. Ich bilde die Quersumme, dann schenke ich uns etwas Wasser ein. Dünger ist noch genug vorhanden. Eine Verschlusskappe Algoflash reicht ihr in der Regel. Sie nimmt es gierig auf, verlangt dann etwas Wasser aus meinem Glas, und spült.
Ist der Drucker am Ende verstummt? Oder kann ich ihn nicht mehr von der faulen Stille des Raums unterscheiden? Hinter der Türe, auf dem Gang, schlurfen Schritte. Das Hören, also, funktioniert. Das linke Auge scheint aber etwas zu blinzeln. Mein Flackerauge, nenne ich es. Vielleicht sollte man doch mehr Früchte essen, ja, sollte sich dazu zwingen. Sie müssen sich dazu zwingen, wies man mich an, Vitamine zu essen, soviel ich könne. Mich trifft sein milder Blick. Vielleicht will er auch gar nichts von mir. Sucht etwas ganz anderes. Ich nehme noch einen Schluck, spende den Rest Maria. Der Schrank mit den Dubletten soll immer geschlossen sein. Ah, ja, richtig – und der Schlüssel fehlt. Die Schritte verhallen. Diesen Stapel verzehren wir nicht heute. Nein, diesen Stapel morgen, frühestens morgen. Wenn Maria nur nicht so viel saufen würde – kein Mensch kümmert sich um sie übers Wochenende. Ich muss wieder Wasser holen. Für sie. Für uns. Und jetzt. Der Gang scheint frei. Die zehn Meter zur Toilette sind ein Kinderspiel. Es besteht kein Risiko, also, wenn man es geschickt anstellt. Der Antwortbrief an Roman muss warten. Heute Mittag schreibe ich ihn vielleicht. Heute Mittag wäre ein guter Zeitpunkt für ein ganz zwangloses Treffen nach der Arbeit. Vielleicht zeigt er mir sogar sein Büro. Ein echtes Kulturbüro. Die Luft ist rein. Ich drücke die Klinke vorsichtig hinunter und schiebe langsam den Kopf in den Gang. Alles ist friedlich. Ich mache das auch für dich, Maria, und für mich. Ich bin gleich wieder da.
|||
Permafrost
Von Kälte in Kälte. Als lösten sich kleine Schmerzen und breiteten sich aus und öffneten mit leichter Hand die Tür in die Nacht, und bereiteten sich auf sie vor und verfingen sich dort in einem asymmetrischen Netz alten Putzes der Wand. Zuhause wird der Kühlschrank auch ein Magazin sein. Der Leberkäse ein Buch. Der Salat, der darüber und darunter angeordnet wurde, ein kalter Einband. Cover. Gefrierschutz mit Gabelzeichnungen. Nun in optimalen 7 Grad und ein paar Minuten. Das Wenige, das davon gelesen wurde, wurde wieder erbrochen. Diese unverdauliche Kost, heute Abend, auch aufgewärmt, auch zu gerechten Portionen angerichtet, sperrt sie sich vor der Einnahme. In den Regalen lag, liegt immer noch anderes, schweigt nun, daneben in bester Gesellschaft: alte Vollkornbrotscheiben wie Papyri, Käsereste, gesammelte Überlieferungen dreier Wochen in einem Kodex. Ein Werk aus blauem Plastik. Ein reifes Werk. Stattdessen die Suche nach Schlaf. Ich stelle das Badewasser ab, sobald ich sehe, es ist genug. Denke an die Kosten. Ich werde mir etwas überlegen müssen. Der Mangel einer ordentlichen Heizung, eines Heizungssystems. Das kann nicht immer mit Heissbädern ausgeglichen werden. Es würde sich nicht rechnen, auf Dauer. Und erst unterm Dach, ein Raum, der nun unbewohnbar ist, eigentlich Frostparzelle ist. Und doch der einzige Raum ist, in dem gearbeitet werden kann. Vielleicht geht es auch in der Küche. Man wird sämtliche Situationen testen müssen.
Nun erstaunt der Blick für punktgenaue Wasserstände, der Wannenfüllmenge, die, nach Aufnahme des Körpers und seiner vollständigen Deckung mit Wasser, ihren Pegel knapp unterhalb der Überlaufvorrichtung, des Auslaufs einrichtet.
Viel Bewegung darf dort nicht stattfinden. Unnötige Verluste sind zu vermeiden, vor allem die Flutung des Badezimmerbodens. Die Gefahr eines Unfalls ist zu gross. Umständlich verläuft das Manöver der Hände, das Buch vor Befeuchtung und Bespritzung zu bewahren, wenn man es lesen will, in der vollen Wanne. Und bizarr das Gefühl der Kälte und Hitze zugleich, die phänomenologische Verwirrung, weil der Körper bis auf Hände und Arme in heissem Wasser liegt. Hände, Arme und Stirn kühlen aus. Und Teile der Schulter. Was also kann da noch aussen sein? Und was innen? Eine weitere Seite hat Wasser gezogen. Durstiges Papier! An einer satten Stelle:
1858. Eine Nachtwache // Durch die Wellen flog der Schoner, auf und nieder / ging der Kiel, / Frische Brise in den Segeln, Kanonen, Jungens! – Sendet keinen Gruß an Land; / Schweigend refft die Segel, schweigend werft den Anker in den Sand! /
Die Zeit vergeht im Wasser langsamer. Man überprüft das mit den Zehen eines Fusses, ob sich nicht schon die Haut veränderte. Runzeln.
Hat Dranmor hier den Fokus verloren? Auch bei den Himmelstöchtern ist das Sternthema ein ewiger Schreibimpuls. Und zugleich unbefriedigende Folie, denke ich. Und, ein endloses Stück Stoff: die Sterne, die man sehen und aus irgendwelchen Gründen beschreiben will. Man muss sie sich selbst erschaffen. Alles andere ist religiöser Wahn.
Der pantheistische Dranmor nannte ihn ein Kommentator, und darauf zwei oder sogar mehr andere. Alle haben voneinander abgeschrieben. Warum hat man das nicht überprüft? Und seine Verdichtung als Gottesdienst ohne Gott bezeichnet.
Dann folgt man einem anderen Satz.
Sterne, teilt ihr mit dem Erdball gleiche Zukunft, / gleiches Sein, / Lebenswärme, Fortschritt, Wissen, Liebeslust und Todespein? /
Dann streicht man ihn wieder. Er gehört ja doch einem anderen. Er gehört diesem Spätling des Jahrhunderts.
Der Wasserhahn ist nicht dicht und erlaubt einem Rinnsal sein winziges Sein, über Wasserleitungen, Rohre und Beckenränder zu fliessen und den Verlust des Übergeschwappten oder Abgelaufenen auszugleichen. Kleine Schauminseln bilden sich, sacken in sich zusammen, werden Oberfläche und vergehen. Hätte er die Welt auf den Kopf gestellt, die Wasseroberflächen wären Himmelszelt und die beiden Zeltstoffe reine Analogie. Ich kann die Hebungen und Senkungen meines Bauches und Unterleibs durch die sich klärende Flüssigkeit erkennen. Die unbemerkt abgesunkene, linke Hand ist, wie sich nun herausstellt, eine grossflächige Schrumpel. Ich lasse das Wasser ab.
Aus Ludwig Ferdinand Schmid alias Dranmor : Requiem - München 1869
|||
¹ - Hartmut Abendscheins Prosa ist eben unter dem Titel “Dranmor” im Athena- Verlag erschienen . Peggy Neidls Rezension ist im poetenladen nachzulesen .
|||
Hartmut Abendschein ( Bio – Bibliographie )
Bisher auf in|ad|ae|qu|at :
|||