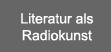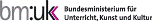Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text
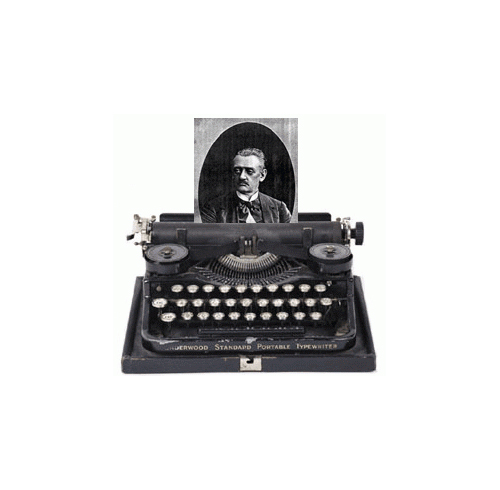
Ludwig Ferdinand Schmid alias Dranmor
Salon Littéraire | Hartmut Abendschein :
Dranmor | 02¹
Über “Dranmor”
Es zischt und schmatzt und löst sich auf. Erst in Phasen und seltenen Farben, dann verzieht sich ein Teil nun schwefelnder Lache fluchend wieder nach oben durch den Wandbruch, dorthin, wo er wohl herkam. Für den Kopf des dampfenden Wesens ist es zu spät. Er zerfällt unter lautem Getöse zu Staub und fliesst aufgescheucht durch den Ausguss ab. Zurück bleiben ein paar einzelne Seiten. Nach Verzug des Rauches sind bald Wörter und ganze Sätze darauf erkennbar. Sätze einer Handschrift. Man reibt sich die Augen. Da ist eine Abschrift aus dem Vorwort zur dritten Auflage der Gesammelten Dichtungen.
Die historische Person Ludwig Ferdinand Schmid alias Dranmor ( 1823-1888 ) ist ein längst vergessener Schweizer / Berner Dichter und Diplomat. Seine Person und sein Werk dienen in diesem Fragment-Roman als Bearbeitungsoberfläche des Ich-Erzählers. In der Sekundärliteratur wird Dranmor als “Mann des Übergangs” oder auch als “seltsamer Mann” beschrieben, getrieben von einer großen Lust auf Literatur und fernen Zielen. Geboren in Bern, lebte er einige Zeit in Österreich in k.u.k.-Diensten, um dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nach Brasilien zu reisen, dort Österreich zu vertreten und sich engagiert um die Kolonialisierung bestimmter Landstriche Brasiliens zu bemühen. Seine Bemühungen scheiterten. Er reiste wieder nach Bern zurück, wo er unter mysteriösen Umständen starb.
Im Zentrum der Erzählung, die sich in der Gegenwart situiert, steht ein Ich-Erzähler, der Dranmor auf der Spur ist bzw. diesen “ausgraben” will. Die Wahrnehmungen des Erzählers, der sich immer mehr in Vergangenheiten verstrickt und diese klittert, seine Aufzeichnungen, Exzerpierungen, Reflexionen und sein kontinuierlicher Zerfall, der auch mit Dranmors Vita parallel geführt wird, machen diesen Text auch zum Erzählexperiment. Zentrale Motive des Textes sind: das Schreiben und Zur-Sprache-Finden des Erzählers, die Bedeutung von Literatur an sich und die Identifikation mit Vorgängern sowie am Rande: Heimat / Fremde / Exilierung.
|||
Ich-Funktion ( Kapitel VII )
Der Vogelkäfig findet seinen leidlichen Platz auf dem blinden Fernseher. Der Appenzeller ist ein gewöhnungsbedürftiger Freund, kann aber intim werden. Un melange de 42 plantes et épices de choix lui donnent la saveur incomparable qui là rendu célèbre. Die Tage vergehen schneller mit ihm, wie jeder weiss. Und die Alpen rufen weniger bitter an den Tagen, die vergehen.
Ein Dialogfenster sucht Zuwendung: verweist auf Eintragungen des Organisationsprogramms, das sich manchmal mit einem Pling meldet.
Dann poppt ein kleiner, grauer Rahmen auf und drei bunte Knöpfe an der Oberkante, rechts.
Heute stellt es einen Einsendeschluss fest. Man habe ihn ja gar nicht verpasst, möchte man korrigieren.
Man hat ihn bewusst verstreichen lassen. Wichtigere Dinge waren zu erledigen, auf die man jetzt nicht näher eingehen könne. Über dem Fernseher liegt ein Papierstapel und einer unter dem Käfig, erstarrt zu einer Lage wunderlicher Notizen, verkleckerter Blätter und bleicher Ausdrucke des altersschwachen Nadeldruckers. Nichts Haltbares also, und aus der Menge des gesammelten und exzerpierten Materials hat sich – obenauf – eine weitere, dünne Schicht gebildet. Ein Substrat allerdings, das nicht irgendwo abgeschrieben wurde. Nur das will man sein eigen nennen. Es sind drei Blätter Handschriftliches in zäher Prosa, bestenfalls Prototypen eines entstehenden Fragments und damit idealer Untersatz der jüngst geöffneten Flasche.
Seit man den Kiosk mit dem blinden und dem taubstummen Verkäufer gefunden hat, die die Einkäufe nicht vorlaut kommentieren, gibt es auch keine Probleme mit den Appenzellern mehr, die nun immer zu dritt sind. Kleine, gutgelaunte Fläschchen in Begleitung rotwangiger Pfeifenraucher, grüngelbe Verpackung in volkstümlicher Montur. Die gelbe Kniebundhose findet man herzig, die Hutblumen exotisch und auch eine rote Rose hat sich da versteckt. Ich zerknülle die drei Seiten und werfe sie in eine Ecke, überlege mir, ob der Stapel nicht gleich hinterher zu befördern sei. Man könnte aber noch die Rückseiten benutzen. Das Papier wird knapp. Also Vorsicht.
Die Dichtkunst ist eine lange Liebe – In der vierten durchgesehenen und vermehrten Auflage ist dieses Jean-Paul-Zitat unter dem Titel hinzugefügt worden.
Aber unklar, was dieser mit jenem zu tun hatte, und auch, warum man sich so in den einen verstiegen hatte, und nicht in den anderen. Rätselhaft, wendet ein weiterhin gutgelaunter Appenzeller ein, und dass es im Übrigen gleich sei, auf wessen Oberfläche man sich ausbreitete. Dann zieht er an seiner Pfeife und fixiert mich wieder, nachdem er eine würzige Wolke aus einem Mundwinkel entlässt. Ich will von ihm wissen, wie er das meine? Nun, man könne sich an allem abarbeiten, wenn man nur wolle. An allem, auch und gerade an Dingen, die man nicht schätzte oder gar verabscheute. Gerade auch du! Ich? Ja, du!
Soso, man duzt mich. Und ermahnt mich. Und spricht von Dingen, die man wohl in irgendwelchen Seminaren aufgeschnappt hatte. Ich will mich nicht von einer sprechenden Schnapspackung belehren lassen. Ich entnehme die letzte Flasche und zerreisse den Appenzeller mitsamt Packung in kleine Schnipsel. Zuerst erwischt es die holzschnittartige Berglandschaft, dann, daneben das Bauernhaus, auf einem anderen Etikett. Ich kann mich dem nur anschliessen, gibt er mir zu verstehen. So funktioniere man nun einmal.
Die Kumpeleien des Sonntagsbauern sind nur Deutungen eines Flaschenetiketts. Mir wird das zu viel und ich nenne es zur Strafe fortan Kerlchen und ich beginne ihn am Bauch zu kitzeln. Es kichert und gluckst, doziert aber weiter, nachdem es sich erholt hat. Es sei doch einerlei, womit man sich beschäftige, wenn man sich mit etwas beschäftigen wolle, solange man sich nur nicht zu sehr mit sich selbst beschäftige, meint es altklug. Kontraproduktiv sei das, fügt es hinzu. Dann entsteigt es dem Rahmen, schwingt sich in die Ecke und streicht das zerknüllte Papier glatt. Hm. Aber man spüre da ein gewisses Potential, und man solle doch nicht alles gleich hinschmeissen. Er würde mich schon dabei unterstützen. Flink springt er wieder aus der Ecke und zwängt sich zurück in seinen nun etwas ausgebeulten Rahmen. Den Vogelkäfig habe ich offengelassen.
Das war eine sehr weise Entscheidung, man würde sich sehen, verabschiedet er sich und verstummt. Ich trinke das Fläschchen in einem Zug leer und werfe es in die einzig freie Ecke. Dort zerschellt es an der Wand, hinterlässt einen Fleck, der sich gemächlich nach unten ausläuft.
Das Alpenbitterchen hat recht: Der Käfig steht weit offen. Ich gehe zum Fenster, öffne dieses, auch und vor allem, um verirrten Vögeln eine Chance auf ein neues Heim zu geben. Überhaupt hat er in allem recht. Vielleicht ist es tatsächlich egal, was man tut, solange man sich nur nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt. So ists auch mit Dranmor, kommt es aus der Ecke. Wo es doch sonst niemand tue, seines Wissens. Und warum auch nicht mit ihm, Dranmor, oder seinetwegen: Ferdinand Schmid. Der Mottoschmid, kalauert er. Der Schmid, der alle seine Gedichte mit Mottos versah. Warum also nicht mit Mottos?
Oder irgendetwas anderem. Das Kerlchen lacht, dann beginnt es gleichmässig zu atmen, bis nur noch ein Schnarchen zu vernehmen ist.
Seit drei Stunden ist kein Vogel gesehen worden. Nicht am Fenster und nicht in den angrenzenden Gärten. Als hätten sie etwas gemerkt. Der Käfig steht immer noch offen. Sperrangelweit. Im Altglas röchelt es. Es zieht.
Man hält sich nicht artgerecht. Ist es ein Wunder, dass kein Vogel kommt? Das Papageienbuch hat nur vier Seiten. Drei Seiten Vorwort, eine Seite Impressum.
Vier Herbstliche Blätter. Bern sei nicht Rio de Janeiro, schallt es wieder aus der Ecke. Vielleicht noch einen kleinen Amaryllis? Ja, gerne, aber bitte mit Soda! Haha, reingelegt, Amaryllis sei gar nichts Trinkbares, sondern eine unerreichbare Frau. Eine süsse, Holde Geliebte! So lange schon / unter den Veilchen schläfst du allein /, säuselt es weiter. Ich schliesse das Fenster, damit wir ungestört sind. Dann wird es Nacht.
Febre amarella. Es tropft noch ein wenig aus dem Hinterkopf. Wird man wohl ausgerutscht sein, auf all den Körnern. Der Käfig liegt auf dem Boden.
Ich lehne ihn schräg gegen die Wand. Der Boden ist ausreichend gestreut und gekörnt. Sie knirschen und platzen, wenn man auf sie tritt, auf dem Weg ins Bad.
|||
Luftlinien oder In Frieden I ( Kapitel VII )
Milliarden kommen und verschwinden wieder / Im grossen All nach kurzer Lebensreise; / Giganten, Zwerge, Kinder oder Greise, / Wir sind nur einer Kette morsche Glieder. / So der Anfang von Romans Brief.
Ich erkenne ihn als Passage aus Dranmors Reisestudie. Warum schreibt er auf einmal Briefe? Und erfindet noch dazu Mottos? Will man mit Dranmormottos necken? Er fährt fort, dass er die Stadt verlassen werde.
Nicht für immer, nein, aber dass er zurück ziehe. Genauer, dass er es sich schon eingerichtet habe. Und dass er vorerst nicht erreichbar sei, er sich aber wieder melde, wenn sich alles eingespielt habe. Dann wird die Schrift nachlässig und endet in einer Unterzeichnung, einer unförmigen Linie. Der Umschlag wurde wohl wiederverwendet. Die Briefmarke stammt aus einem Automaten und wurde maschinell gestempelt. Am Ende weitere Wünsche und ein Maschinengruss.
Ich habe keine Zeit zu verlieren und muss mich auf das Naheliegendste konzentrieren. Vetter hatte vom Ostermundiger Friedhof gesprochen. Von der rührenden Trauerfeier Dranmors, den Grabgesängen und Reden. Das sind nur wenige Kilometer Luftlinie, überschlage ich und zeichne dabei die Strecke mit dem Daumennagel auf dem Kartenausdruck nach, kratze diese Linie in die Luft und versuche dabei das Gleichgewicht zu halten. Der Daumennagel fährt über die Karte, hinterlässt aber keinen bleibenden Eindruck. Keine Vertiefung. Ich finde auch einen Leuchtstift.
Ich stelle den Kragen hoch. Die Luftlinie wird an einer Kreuzung unklar. Der Aprilnebel verwebt den Blick und gibt erst spät zu erkennen, dass der Obere Galgenfeld verbaut ist. Man muss also improvisieren. Erst unschlüssig, ob die Bitziusstrasse oder Ostermundiger Hauptstrasse einzuschlagen ist, entscheide ich mich zögerlich für den Schriftsteller. Weitere Verwirrung entsteht durch die Strassennamen. Ein Gehobener Horizont verläuft sich zur unheilen Eile. Die Stadtverwaltung hatte den bildhaften Sprachwahn ihres Hausmalers in die Topographie gegossen. Man begegnet dem Wurm am Weg und überquert den Teppich der Erinnerung. Wirkliche Eile ist angebracht. Ich erreiche den Eingang des Friedhofs kurz vor seiner Schliessung.
Man schliesse gerade, es würde sich nicht mehr lohnen, gibt mir ein Wächter unfreundlich zu verstehen.
Ich spute mich, entgegne ich bestimmt, und alles ginge noch schneller, wenn er mir denn sagen könne, wo er denn liege.
Er kenne einen Ferdinand Schmid nicht, antwortet er mir, aber die historischen Prominentengräber lägen in dieser Richtung. Aber 19. Jahrhundert? Das sei wahrscheinlich längst aufgelassen und auskultiert.
Wenn man sich beeile, könne man sich kurz umschauen, um wenigstens einen Eindruck zu gewinnen, aber er persönlich sehe da eigentlich keine Chance. Es dunkle auch schon ein – man würde kaum mehr die Inschriften erkennen können, höre ich ihn noch, und bei den Alten sowieso nicht. Ich lasse ihn links liegen.
Dort liegen sie wie in einer kleinen Stadt. Wie auf dem Reissbrett entworfen, stehen die Wege im rechten Winkel zueinander, die Zwischenräume wurden mit knorpeligen Bäumen verziert, weiter hinten schliesst sich das Feld mit den Namenlosen an. Bald wachsen opulente Sträusse und historisierte Steinvasen und Engel aus den Böden. Ein spiralförmig begehbarer Hügel bricht aus der Ebene und endet mit der Spitze einer Trauerweide. Die Kindergräber sind mit buntem Nippes, traurigen Windrädern und Bären gekennzeichnet.
Ich erreiche das Feld der Aufgelassenen, Auskultierten und Bemoosten. Eine Tafel informiert: Erhaltenswerte Grabmäler. Hier werden künstlerisch bedeutungsvolle Grabmäler aus den Friedhöfen der Stadt ausgestellt. Sie sollen als Dokumente ihrer Zeit der Nachwelt erhalten bleiben. Bern, im Juli 1983. Die Friedhofsverwaltung.
Ich kann die Situation sofort fassen und hole mein Feuerzeug hervor. Es kann nur dieser Stein sein. Tatsächlich ist kaum etwas darauf zu erkennen. Aber unter der dichten Moosschicht, die ich langsam mit blossen Fingern und Nägeln entferne, finden sich Vertiefungen.
|||


Ludwig Ferdinand Schmid alias Dranmor : Requiem – München 1869
|||
¹ – Hartmut Abendscheins Prosa ist eben unter dem Titel “Dranmor” im Athena- Verlag erschienen . Peggy Neidels Rezension ist im poetenladen nachzulesen .
|||
Hartmut Abendschein ( Bio – Bibliographie )
Bisher auf in|ad|ae|qu|at :
|||