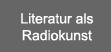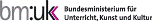| J-Sounds 日本 |
Salon Littéraire | Leopold Federmair :
Tokyo Fragmente 5

Eis oder Reis?
Im Rucksack eine kleine Handbibliothek, schließlich haben die Bücher Einfluß auf den Rhythmus der städtischen Fortbewegung; da gilt es, gut auszuwählen und gegebenenfalls Alternativen zur Hand zu haben. Bald wird sich herausstellen, daß mir an diesem Wochenende nur zwei der Bücher zupaß kommen, die Kleine Geschichte Japans, die ich so vor mich hin lese, von den dunklen Anfängen bis zum Ende, also bis jetzt, oder fast jetzt, bis 2009. “Den Übergang zu einem Zweiparteiensystem schien die japanische Demokratie nach langer Zeit endlich vollbracht zu haben.” Schien. Vor zwei Wochen waren wieder mal Wahlen. Das Land scheint zum politischen Trägheitssystem zurückgekehrt zu sein. Shoichi, einer meiner Gesprächspartner im Show-ten, er arbeitet im Archiv der Asahi-Zeitung, wird mir bedauernd sagen, in Japan gebe es eben keine richtige Linke.
Aber die kleine Geschichte Japans treibe ich nur so vor mir her, lässig, wie man eine leere Dose vor sich herkickt, oder wie einen Schneeball, den man gedankenlos rollt, bis er groß und schwer geworden ist und man ihn liegen läßt, damit er, wenn wir nicht mehr da sind, kleinschmelzen kann. Was sich in mein Gemüt schlängelt, sind die Gedichte und Essays von Olga Martynova. Die passen wirklich, klein und klug, viel kleiner als die Geschichte Japans, und doch. Sie reizen mich auch, regen an, zum Zwiegespräch, das ein Spiegelgespräch bleibt, schon klar.
Da sitz ich im Excelsior und rede mit mir. Keiner lacht, niemand ist befremdet. Die reden alle mit sich, mit den Freunden am Display. Hier im Buch steht kursiv (wessen Wortspende?) und in Anspielung offenbar auf den Mann ohne Eigenschaften das seltsame Wort von der “österreichischungarischen Hydroponik”: Was soll das denn sein? Wasserkultur, Wasserarbeit, sowas haben wir doch überhaupt nicht? Höchstens Wasserkraft, am Großglockner, und die Wasserspiele in Hellbrunn an der Grenze zu Bayern. Aber vielleicht ist da im Buch schon die Rede vom Phantom, das letztlich die eigene Existenz ist. Ich existiere, um festzustellen, daß ich nicht existiere. Hinter uns die Leere, befreit von kuk Reich, drittem Reich und so weiter, alles futsch, wie die Sowjetunion futsch ist und der sowjetische Mensch übriggeblieben, als Nicht-Existential. Der gespenstert jetzt durch Europa, nach Frankfurt am Main und darüber hinaus, aus der Leere die vergessenen Blüten treibend, Geranien, Klee und andere Zimmerpflanzen.
Ach, aber der habsburgische Mensch hat sich nicht lange gehalten, er ist ausgestorben… Olga spricht mit Phantomen, mit Dichtern der Vergangenheit. Was kümmert mich KaKa? Auf den Plakaten steht Kika. Was schert mich Hitler? Wenn ich durch Linz spaziere, das sich seit jeher gegen die Landstraße und den Hauptplatz preßt, denke ich nie an den Nazi. Olga denkt daran, sie übernimmt das für uns.

Unzureichende Mittel
Solche schönen Schneeballgedanken, fern der Heimat, formen sich dank Olga in meinem Köpfchen. Der Montagsschneefall kündigt sich an, schon jetzt, am Freitag 2013. Die Gedanken – genauer: Gedankenbilder – fördern die wandernde Besinnung und die Sammlung der Realbilder. KaKa wird dem japanischen Gestöber untergezogen wie der Schnee dem Kuchenteig. Vorsichtig, aber doch entschieden, mit heimlicher Kraft. Japan hat nie etwas verloren, keine Ost- und keine Westgebiete, da schon gar nicht, wenn in Richtung Westen sehr lange geradeaus wandert, stößt man auf Los Angeles oder so. Japan war immer bei sich, auf sich selbst gestellt, in seinen eigenen Grenzen. Das bißchen Imperialismus im 20. Jahrhundert, nicht der Rede wert. Jede Menge Ideologie, wenig Taten. Groß reden, klein scheißen, wie man im österreichischen Westen sagt (der sich Habsburg nie ganz unterworfen hat). Kein Japaner hat je das koreanische Hinterland vermißt. Keiner vermißt die Göttlichkeit seines Kaisers. Wenn Schluß ist, ist Schluß. Es lebe die Folklore, es leben die Mitbringsel… Schluß mit den Ideologien und zugehörigen Mythen! Der Kaiser ist geblieben, mitten in der Hauptstadt, im Zentrum, das kein Normalsterblicher betritt. Ich auch nicht. Ein Blick vor zehn Jahren auf die Befestigungsmauern, durch das Blattwerk der schattigen Bäume im Hibiya-Park, wo ich gern verweilte, hat mir genügt.
*
Doch noch was. Ein Postskriptum, liebe Olga. “Ich glaube, wenn du in Wien eine Weile still stehst und, über das Getümmelgemurmel hinweg, lauschst, wirst du das mit slawischen zarten Flüchen gemischte feine Getrappel der osmanischen Reiterei hören und das sanfte Geraschel des Goldenen Horns.” Ich werd’s versuchen, eine Weile stillstehen. Glaube aber, daß ich das Tuten der Fähren im Marmara-Meer hören werde, und das Lachen vom rundköpfigen Bäcker in der Brunnengasse, bei dem meine Tochter und ich frühstücken, wenn unsere Körper die Zeitverschiebung zwischen Japan und Mitteleuropa noch nicht akzeptiert haben und wir im Morgengrauen aufstehen und die Bäckerei Lale Han als einzige um diese Zeit geöffnet hat. Oder ich höre die türkische Pop-Musik, die begleitet von Mittelmeerbildern aus dem dort an der Decke hängenden Fernseher flutet. Die Geschichte aber, die will ich vielleicht gar nicht rumoren hören. Wie ich in Hiroshima nicht ständig den Atomknall hören will.
*
Aber wir wollen die Geschichte wach halten. Himmelwärts, hinauf in den ersten Stock, der ein Zwischenstock ist. Mezzanin, wie man in Wien sagt. Von oben sieht man herab auf die Schädel und Schultern der vor dem Ladentisch Wartenden, das Hin- und Herblicken derer, die einen Bekannten suchen oder einen angenehmen Platz suchen; herab auf die Unschlüssigen vor der Getränkekarte am Eingang, die Schritte der Vorübergehenden auf dem Gehsteig, die wartenden Taxis auf dem Bahnhofsvorplatz, die sich öffnende gelbe, von einem schwarzweiß karierten Streifen durchzogene Fahrzeugtür, die alte Frau, die ihren Kimono rafft und ihren Körper vorsichtig auf die Sitzbank schiebt (auch der Kimono ist gelb, doch in allerlei Schattierungen bis hin zum Ocker und Hellbraun). Das Excelsior ist morgens das erste Café am Platz, das öffnet. Das andere Café, mit dunkler Holztäfelung unter den Fenstern im zweiten Stock, hat um halb neun noch geschlossen. Es liegt neben der Bahntrasse, fast in Reichweite zu den Zügen; eine steile, schmale Treppe führt hoch in den zweiten Stock. Diese Treppen, die manchmal in luftigen Galerien enden, noch öfter aber vor einer Kette mit dem Schild “Gefahr!”, haben mir anfangs in Japan eher Angst gemacht. Inzwischen ziehen sie mich an, gerade weil sie ins Ungewisse führen: Wer weiß, was dich oben erwartet, vielleicht eine Wunderwelt…
Ja, ich bin Meguro untreu geworden. Der Bahnhof dort drüben, unten-drüben, nennt sich Gotanda, der Stadtbezirk Shinagawa, er grenzt im Westen an Meguro, und zum dortigen JR-Bahnhof kann ich, wenn ich will, zu Fuß gehen, die Geleise entlang.

Sehnsucht nach Meguro? Den Ekimae-Turm kann man in >>> Tokyo Fragmente 1 von einer anderen Seite sehen.
Excelsior, himmelwärts, woher dieser Name? Ein Kollege hat mich für morgen in ein anderes Café der Kette bestellt, er nennt es “Excel”, wie das Computerprogramm: vermutlich von “excellent”: selbsternannte Erhabenheit, auf der Leiter der eigenen Kleinheit erklommen. Excelsior, Gerhard hätte ein Gedicht geschrieben über das Café und den Namen, wie er es oft tat an seinen Arbeitsplätzen, zuletzt im Starbucks in der Mariahilferstraße, zwischen Sternen und Talern. Seit Wochen trage ich seine Verse und sein Bild, seine Anwesenheit mit mir herum. Gestern abend im Show-ten habe ihm zu Ehren ein paar Gläschen Jameson’s getrunken. Er wollte, daß ich ihn übersetze, und ich bin sein anderes Ich geworden, an einem anderen Tisch sitzend, aber in der Nachbarschaft, ein paar Tische weiter, zwischen solchen und solchen Köpfen unsere ausgesetzten – exzellenten? – Plätze behauptend. Die poetischen Vorposten. Il posto / di un poeta / è proprio quello / di guardare i ballerini… Der Ort eines Dichters besteht darin, die Tänzer zu betrachten.
Eine alte, müde, zarte Frau läßt sich auf den Sessel in der hinteren Ecke des Mezzanins sinken. Eine Frau wie Kati Outinen in Le Havre, bitter und zugleich so gutmütig? Vorsichtig wende ich den Kopf nach ihr und erschrecke. Sie ist nicht alt, höchstens dreißig, trägt eine Juliette Greco-Frisur. Nach einer Weile kommt ein Mann mit zwei Tassen auf einem Tablett und setzt sich ihr gegenüber. Nicht weniger erschöpft, verlebt, verweht als sie. Siebzig verweht. Dreißig verweht. Vorsichtig erschrecken… Vom Anfang verweht.
Eine andere Frau sitzt aufrecht und brav wie ein Kind auf dem Stuhl und schaut in das Buch, das sie geöffnet im korrekten Leseabstand vor ihr Gesicht hält, den rechten Ellbogen an die Rippen gepreßt, den linken Unterarm auf das Tischchen gelegt, eine karierte der Decken, die neben dem Geschirrückgaberegal in einem Korb bereitliegen, auf den Oberschenkeln.
Und ein Mann, später, an einem anderen Tag, oder heute, oder doch morgen, ein Glatzkopf am Lebensabend… Nein, der Mann hier ist unverweht, fast noch ein Kind, wenn auch in Pension, guter Dinge wie ein Kind, trägt aber auch ein schönes Sakko mit einem (von mir jedenfalls) nie gesehenen Muster, legt es sorgsam über die Lehne des Stuhls, der ihm gegenüber frei bleiben wird, faltet dann langsam die Zeitung auseinander, glättet sie, liest, versenkt sich in die Welt der Zeichen, liest und liest, taucht wieder auf, runzelt die Stirn, macht die Augen schmal, scheint sich zu besinnen: “Kaasan…”, flüstert er, dann noch einmal etwas lauter: “Kaasan!” (Mama…? Mama!) Er steht auf und wiegt den Kopf, als müßte er sich besinnen, in welche Richtung er gehen soll. Einen Augenblick später kommt ein Mann zurück, der kurz zuvor den Raum verlassen hatte. Der Glatzkopf deutet mit einer leichten Armbewegung auf einen Stuhl, an der Lehne hängt ein Regenschirm. Der andere greift blitzschnell danach, umklammert den Schirm, macht auch schon kehrt. Der Glatzkopf zuckt fast unmerklich, wie zur Entschuldigung, die Schultern.

Gotanda, Hintertür
Manche Geschichten entstehen nur, weil ich die Sprache nicht ausreichend beherrsche; also durch Irrtümer. Zum Beispiel gelingt es mir auch nach elf japanischen Jahren nicht, lange und kurze Vokale zu unterscheiden, oder das nach dem O fast unhörbare, für europäische Ohren fast unhörbare U mitzuhören. “Kasa”, hatte der Mann gesagt, nicht “kaasan”. “Kasa” heißt Regenschirm, das weiß sogar ich, und ich denke schon lange nicht mehr an casa, an das italienische oder spanische Haus, wenn ich das Wort höre. Immerhin ist es auch möglich, daß der Mann wirklich “kaasan” gesagt und gemeint hat. An der Möglichkeit halte ich fest wie der andere an seinem Schirm.
Inzwischen bin ich von meinem Mittelplatz zum freigewordenen Tischchen am Rand der Zwischendecke gerückt, von wo aus man den besten Überblick (und Hinabblick) hat. Meine Tasse bleibt in der Mitte, der Rucksack scheint Anspruch auf einen dritten Tisch zu erheben, so gehört die ganze Reihe mir. Im Himmel breitgemacht. Gerhard würde die Augenbrauen hochziehen. Lächelnd wie stets.
*

Fußgeher in Gotanda
Schuhe, Strümpfe, Hosen, Röcke, Kleider. Sohlen, Füße, Beine, Schritte. Aufklatschende, patschende, prasselnde Füße. Den Boden streichelnde Füße: vor jedem Schritt wird vorgekehrt. Ein unsichtbarer Besen, die geistige Antizipation, reinigt die vorausliegenden Quadratzentimeter. Wegknickende Beine, immer wieder, jeden Augenblick die Gefahr, daß der ganze Körper auf eine (ebenfalls unsichtbare) Müllhalle kippt; die Schultern kämpfen, um das Gleichgewicht wiederzugewinnen. Kickende, die Luft und mit der Luft die Welt (wie ich die Buchseiten, die Sätze) vor sich herkickende Füße. Klobige Stiefel, stumpf, abgestumpft. Selbstbewußte Schritte: zuerst wird der Boden vom Absatz berührt, dann von der (genagelten?) Sohle: ein doppeltes Klappern, das ich hier oben, hinterm Glas, nicht höre, sondern antizipiere, perzipiere, antizipiere. Tastende Schritte, den Boden absuchende Schritte, immer nur für einen Sekundenbruchteil, diese Suche, aber unweigerlich. Beim Tango vereinigt sich beides, das Tasten und die Sicherheit, beides zugleich, denn es gibt nur einen Fleck und einen Moment, wo die Bodenberührung stattfinden kann, doch die Entscheidung findet mit Liebe und Sanftmut statt, so als könnte sich der Tänzer auch Täuschen (aber Täuschung ist ausgeschlossen): angewandte Philosophie des Als-ob.
Herr Märzeder, der mit den grauen Löckchen über den Ohren, wählte eine Kugel, rückte sie zwei-, dreimal in seiner Handmuschel zurecht, etwa so, wie man eine Schale vor dem Schluck Tee zurechtrückt, eigentlich nur aus ästhetischen Gründen, um ihre Schönheit zu würdigen, machte dann den Seitenschritt zum Mittelstreifen, sorgfältig den Standort wählend, zog tief einatmend, die Brust hebend, das andere Bein nach, schloß die Beine, ging leicht in die Knie und zupfte links und rechts an der Hose, um den Stoff zwei oder drei Zentimeter nach oben zu ziehen, während sein rechter Arm mit der Kugel nach hinten ausschwang und das Auge Maß nahm. Aber hier und jetzt: wiederum Herr Märzeder, viele Jahre gealtert, mit müden Füßen, die nicht wollen oder nicht können, zwischen zwei Stöcken, die Halt zu geben scheinen, obwohl sie nur am Asphalt kratzen, der alte Mann trotzdem weiterschlurfend. Einknickende Knie, gepreßte Waden, die Last auf den Schultern zu schwer. Glänzende Schritte! Fröhliche Schritte! In den Boden stampfende, zornige Füße, die die schweren Schritte nachschleppen, antreiben, voranziehen. Schritte, die die Welt öffnen, oder aufreißen, wie die Wolkendecke aufreißt, heute noch, später. Verlorene Schritte, kopflos: sicher ein Telephonierer; und wirklich, der Kopf kommt zum Vorschein, die Hand verdeckt das Ohr. Kleine Schritte, zurückgehalten vom Stoff: Kimono.
Schritte, zurückgehalten von Schuhen, denen die Füße nicht vertrauen – lieber nicht auftreten, in der Schwebe bleiben. Aus allen Wolken fallende Schritte, sie suchen die Welt heim. Paarschritte im Gleichklang; jetzt leicht verschoben, mit feiner Differenz. Immer wieder pausierende, die Bewegung unterbrechende Schritte. Unterschenkel, die unter energischen, spitzen Knien locker baumeln: schlenkernder Gang. Ein Jogger, obwohl es regnet, der Regen in Schnee übergeht. Läufer hüpfen, immer sind sie einen Sekundenbruchteil in der Luft, irgendwann wird einer von ihnen nicht mehr herunterkommen (was nicht heißt, daß er entfleucht). Aufgebogene Schuhe wie diese konvexen Halbzylinder, in denen Skater auf und ab pendeln: so pendeln auch die Schuhe dahin, ohne Füße, Beine. Schritte, die weit werden, als wollten sie alles überspannen, bis sie ausscheren; jeder Schritt ein Spagat, und man sieht nicht, wie sich der Körper wieder aufrichtet, aber es ist so, plötzlich alles wieder im Lot. Und der hier, wie geschoben, die Beine bleiben zurück, geschoben von einer unsichtbaren Hand, die sich an den Hintern legt. Wie der alte Bauer auf dem Heimweg von der Sonntagsmesse, der stehenblieb, nicht mehr weiterkonnte, auf der Stelle trippelte, wackelte, aber es ging nicht, er ging nicht, und so bat er den Vorüberkommenden: “Schiebst du mir an?” Dann ging es wieder, automatisch, gesteuert vom Stern, bis zur nächsten Unterbrechung: “Schiebst du mir an?” Aber auch Leute, die ewig an Ort und Stelle bleiben wollen . Und solche, die weiterkommen wollen, eine menschheitliche Dichotomie? Stöckelschuhe, die den Knieknick erzwingen: sexy? Der schlaksige Gang der sehnigen Models: sexy?
Die Leute unterm Regenschirm, sie heben die Unterschenkel wie auf einer hohen Wiese, um nicht nass zu werden. Möglichst gar nicht aufkommen, möglichst nicht ankommen, das wäre schön. Tokyo: kein Mensch wiegt sich beim Gehen, alle bewegen sich auf einem unsichtbaren Strich; kein Links-Rechts der Schultern, kein Auf und Ab; auch der Scheitel folgt einem unsichtbaren, straff gespannten Faden. Schritte, die kurz vor der Bodenberührung suspendiert werden und dann natürlich – natürlich? – doch weitergehen. Einundzwanzigstes Jahrhundert: Keine Hinkebeine, keine Einfüßigen, keine Beinlosen. Der Krieg ist vorbei, schon lange. Es hat nie einen Krieg gegeben. Oder bleiben die Versehrten zu Hause? Letzte Bewegung: Himmelwärts!

Streifen für Blinde und Sehschwache. Führt durch die ganze Stadt.
*
Die Hügel von Tokyo, ich will sie mit den Fußsohlen liebkosen wie Frauenbrüste, nein: wie die wohlbekannten Brüste meiner Frau. Jetzt und jetzt, meine Füße gehen schon aus der Zeit. Die Gasse hinan, zwischen gestaffelten Häusern.
*
Am Freitagabend, auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt, fast alle mit gesenktem Blick, sitzend oder stehend oder gehend, vom borgesianischen Aleph gebannt, denn nichts anderes ist das iphone: eine Wunderkugel, ein Fernseher und Fernsprecher, den man vor sich herträgt wie der Esel seine Karotte: logisch, daß er das ewig Ferne, ewig Nahe nie erreicht. In den paar Monaten, die ich nicht hier war, hat sich die Verbreitung des Alephs in der Hauptstadt mindestens verdoppelt. Die Gestik hat sich verändert: vom hektischen Herumdrücken zum rhythmischen Wischen. Elegante Fingerbewegungen, fast wie die eines Dirigenten (ohne Dirigierstab). Was nicht mehr gesehen wird, ist die Landschaft, sind die Gesichter, ist die reale Umgebung.
Ein Alter mit rundem Gesicht, schmunzelndem Mund, wulstigen Lippen, ein mädchenhafter Opa sozusagen, die Mundwinkel hängen, anders als bei so vielen in die Jahre Gekommenen, nicht herab – dieser Alte setzt sich auf die Waggonbank und öffnet sogleich ein Büchlein mit Schutzumschlag über dem Schutzumschlag. Mein Blick von oben fällt auf zurückgekämmtes, grauweißes, nur wenig ausgedünntes Haar, unter dem die Kopfhaut durchschimmert. Dieses Männchen ist der einzige Leser unter all den Wischern und Starrern des Alephs.
Ist Lesen besser? Nicht unbedingt. Non pas a priori. Die Lektüre zieht dich genauso von der Wirklichkeit ab. Nicht umsonst hat man sie früher den Frauen zugeordnet, die nichts Vernünftiges zu tun hatten (das Vernünftige wurde vom Dienstpersonal erledigt). Lesen ist etwas für mädchenhafte Opas. Wer liest, hat keine Augen und Ohren für das, was ihn umgibt. Das Buch ist der Protoyp des Alephs, später abgelöst von Fernseher, vom Handy, vom ?phone. Nicht abgelöst, nein. Die Epochen koexistieren, wie der schmunzelnde Alte leibhaftig beweist.
Am Samstag deutlich weniger Handys in den Straßen und Zügen. Vielleicht ist es ein Freitagabendbrauch, die Leute kommen nach Hause, kündigen die Heimkunft ihrer Familie an, sind erleichtert, erschöpft. Was paßt besser zu dieser Stimmung als ein Aleph? Es ist die Traulichkeit des 21. Jahrhunderts.

Samstags in der U-Bahn. Oder freitags?
*
Aber die Leute kommen auch zu Hause nicht mehr von den Minidisplays los. Und in den Bars, den Kinos, überall. Wie Kleinkinder, die zwar nebeneinander spielen können, aber nicht miteinander. Die Erwachsenen können nicht mehr miteinander. Aber das Nebeneinander beruhigt sie, darauf können sie nicht verzichten. Gestern im Show-ten saß neben mir eine Frau auf dem Barhocker. Mit Shoichi, dem Asahi-Mann, habe ich über sie hinweg gesprochen, oder an ihr vorbei, hinweg und vorbei. Die Frau war die ganze Zeit mit ihrem Dingsda beschäftigt. Android. Menschenartig. Noch nicht (nicht mehr?) ganz Mensch. Nach eineinhalb Stunden frage ich Shoichi, ob er und sie zusammen gekommen sind. Sie sind zusammen gekommen, man spürt es trotz allem. Ich will ihn nicht fragen, wer denn die Frau ist. Er verrät es mir gleich: Sie sind verheiratet. “Entschuldige, ich habe ganz vergessen, sie vorzustellen. Sie ist ein wenig dick, siehst du”, fügt er kichernd hinzu, während er auf ihre Hüfte zeigt. Die Frau schaut vom Bildschirmchen auf, läßt Daumen und Zeigefinger ruhen, macht böse Miene zum Spiel, lächelt. Diese Ehe ist längst im Stadium der Ironie angekommen. “Selber dick”, sagt sie und hat recht. Shoichi sollte sich lieber nicht beklagen. Er sollte ins Fitneßcenter gehen und weniger trinken. “Das wäre doch ein schönes Programm zur Verbesserung eurer Ehe”, sage ich später, im Stadium der Ironie. “Ja”, sagt Shoichi, und ich bin mir nicht sicher, ob er den Vorschlag nicht gleich morgen verwirklichen wird. Die Frau, ihren Namen hat er nicht genannt, hat sich wieder dem Bildschirmchen zugewandt. Gun-chan hat eine wunderschöne neue Kopfbedeckung, vielfarbig, ein bißchen im Rasta-Stil, das paßt zu ihm. Die Haube sei peruanischen Ursprungs, klärt er mich auf: Geschenk einer Stammkundin. Er erzählt, daß ich letztes Mal mit Yoshiyuki getanzt hätte, Tango natürlich; ich hätte ihm die Schritte gezeigt und es habe gut geklappt, obwohl hier gar nicht genug Platz sei zum Tanzen. Das hatte ich vollkommen vergessen, wahrscheinlich war ich schon betrunken gewesen, aber jetzt erinnere ich mich genau. Die Jungs in Buenos Aires früher, vor achtzig, siebzig Jahren, haben es genauso gemacht, zu Übungszwecken miteinander getanzt.
Der Mann zu meiner Rechten horcht auf. Tango, ja? Die übliche Erklärung: argentinisch, nicht das, was man aus Film & Fernsehen kennt. Gleichzeitig geht die Tür auf, ein Trio kommt herein, die Vorderfrau wendet sich schnurstracks an Shimakura, meinen rechten Nachbarn: “Sind Sie nicht der…?” Der Name sagt mir nichts, jemand aus dem Fernsehen, ja. “Passiert mir oft”, sagt Shimakura-san später, “anscheinend sehe ich dem Typen ähnlich.” Shimakura arbeitet für eine Textilfirma, entwirft Kleider, mag Tweed, aber zu rustikal darf es nicht aussehen. Trägt selbst eine Wollhaube auf dem Kopf und ist 41 Jahre alt, verheiratet, eine kleine Tochter. Hat eine sanfte, unaufdringliche Stimme.
“Es ist schon gut, wenn der Vater Lebenserfahrung hat”, bemerke ich (und denke natürlich an meine eigene Tochter). Mag sein, ich tröste uns über unser fortgeschrittenes Alter. “Ja”, sagt er, “die meisten jungen Väter sind einfach zu blöd zum Vatersein.” Später packt er den Katalog seiner Firma aus und schlägt eine Seite auf: Den Mantel hier habe ich entworfen. Der Stolz paart sich gut mit seiner Bescheidenheit. “Ja”, sage ich, “sehr schön”, und Shimakuras Sitznachbar beugt sich zu uns herüber: “Vow, sugoi, honmani sugoi!”
Zu einem solchen Begeisterungsausbruch bin ich leider nicht fähig. Der Mann auf dem Barhocker neben dem Eingang ist jünger als Shimakura, um die Dreißig, trägt eine Stehfrisur, die an Punk erinnert, ein Softpunk, dieser Junge, beim Sprechen lächelt er, seine Augen lächeln, das ganze Gesicht: einladend. Bestimmt entspricht die Frisur seinem Wesen, denke ich: Softpunk, in Japan beliebter Musikstil, man ist fasziniert vom Harten und macht es umgehend weich, glättet das Rauhe, indem man es nachahmt.

Himmelsbohnen zwischen Oden-Kessel und Wagashi
“Keiko-san war gestern hier”, informiert mich Gun-chan, der gern Gesprächslücken ausfüllt, “so um…” – er schaut zu Yoshiyuki hinüber, der fortsetzt: “um drei, vier Uhr früh. Wahrscheinlich kommt sie heute auch.”
Anscheinend bin ich für die Show-ten-Leute der Mann, der ständig auf der Suche nach Keiko ist. Warum nicht? Allerdings trifft das auf alle Männer zu, unser Geschlecht ist auf der ewigen Suche nach der schönen Unbekannten. (Obwohl, was mich betrifft, so habe ich sie nach vielen Jahren gefunden, und sie heißt nicht Keiko.)
“Sie trinkt viel in letzter Zeit.”, sagt Shoichi. “Schwankend kommt sie durch die Tür.” Er hebt die Arme und zeigt: wie ein Flugzeug.
“Trinkt sie mehr als früher?” Irgendwie mache ich mir doch Sorgen um sie. Trinkt sie aus Unglück? Worin besteht ihr Unglück? Oder ist es eine Lebensform, für die sie sich entschieden hat? Der Gedanke kommt mir, sie könnte sich den desaströsen Helden von Ningen shikakku, dem Roman Osamu Dazais, zum Vorbild gewählt haben. Das hieße: konsequente, nachhaltige Selbstzerstörung. Und davor soll ich sie retten? Von diesem Weg soll ich sie abbringen? Nein! Diesmal gehe ich früh nach Hause, Mitternacht ist vorbei, das Morgengrauen noch fern. Ich lasse die nächtliche Universität zurück, dort wird munter weitererzählt, erklärt, disputiert und getrunken werden, gegen Ende nur noch verschwommen, mit dem letztem Schwung. Lasse auch die Musik zurück, Country, dahin sind sie jetzt gekommen, angefangen hat es mit “We are the Monkeys!”, dann die Beatles und gleich darauf die Rutles, eine Beatles-Parodie-Band, so hatte mich Shoichi aufgeklärt und begeistert hinzugefügt: “Sie traten in der Monty-Python-Show auf!” (aber Monty Python hat mich schon in der Showa-Zeit kalt gelassen), zwischendurch natürlich Yuming, dann auch Ry?ko Moriyama (Tochter des Jazzmusikers Moriyama, klärte mich eine andere Stimme auf), schließlich Ry Cooder (schön!) und sogar Hawaii-Musik… Vergessen hab ich Les parapluies de Cherbourg.

Zucker
*
to be continued
Leopold Federmair @ in|ad|ae|qu|at zu Japan , dessen Kunst und Kultur :
- J-Sounds 日本 ( programmatisch )
- Eine Reise nach Matsuyama | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Der Schatten über Yukikos Auge ( Junichiro Tanizaki : Sasameyuki ) | J-Sounds 日本 | espace d’essays |
- Die Traumbrücke | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Ōgai Mori, Arzt, Soldat und Schriftsteller | J-Sounds 日本 | espace d’essays |
- Tokyo Fragmente 1 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 2 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 3 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 4 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
|||