| echt welt texte |
| Reprise|

Pergamonaltar , Nordfries : Gigantomachie – Die drei Moiren erschlagen mit Bronzekeulen Agrios und Thoas
Der Rhythmus des Widerstandes. Mehr Sprachoper als Hörspiel – Peter Weiss’ epochales Opus in gelungener CD-Edition
Christiane Zintzen
Peter Weiss’ epochales Romanepos “Die Ästhetik des Widerstandes” zählt zu den prominentesten Werken in der Weltbibliothek der ungelesenen Bücher. Schon der akademisch anmutende Titel provozierte einen Respektabstand zu dieser (1975 – 1981 in drei Bänden publizierten) Grosskomposition aus erzählenden, dokumentarischen und analytischen Texttemperamenten. Eine akustische Fassung – mehr Sprechoper denn Hörspiel – stellt Weiss’ vielschichtiges Werk als intensiv instrumentierte Reflexion faschistischer und kommunistischer, akuter und struktureller Gewalt erneut zur Debatte.
|||
KEIN SPIEL
In einer Koproduktion des Bayerischen und des Westdeutschen Rundfunks hat Karl Bruckmeier den 900-Seiter beherzt bei dessen eminenten Stärken gepackt und die Satzsuiten und Bildsequenzen in gehörige Schwingung versetzt. Was Anfang Jahres erstmals in Fortsetzungen über den Äther ging und nun auf 12 CDs – durch den “Hörverlag” exzellent ediert – zu erwerben ist, lässt sich schwerlich als Hör-”Spiel” im klassischen Sinne bezeichnen. Schon deshalb nicht, weil hier nicht “gespielt” wird: Kein Rollen werden verkörpert, keine psychologischen Profile modelliert und schon gar keine “als ob”-Shows gegeben. Darin folgt der Regisseur sehr genau dem Autor, der “wahre” Namen als Chiffren für verschiedene Ethiken antifaschistischer Humanität einsetzte. Die Paladine des Dritten Reiches bleiben anonym und trotzdem kenntlich, dahingegen wird auf der staatspolitischen Linken durch die Benennung Lenins, Bucharins und Stalins die Wendung zum autoritären Totalitarismus markiert. Auch der Ich-Erzähler (Weiss’ Alter Ego) bleibt namenlos: ein Bewusstsein, in dessen Sammellinse sich die Ereignisse, Gespräche und Reflexionen fokussieren. Vom spanischen Bürgerkrieg über die Kriegsdauer im schwedischen Exil bis hin zum Bericht des Schicksals der noch am Vorabend des Zusammenbruches pervers hingerichteten Berliner Freunde entrollt sich eine Entwicklung.
|||
SPRECHOPER
Regisseur Karl Bruckmeier, der in den vergangenen Jahren sein hör-dramaturgisches Handwerkszeug an der Schürzung der “Textflächen” Elfriede Jelineks schärfte, setzt mit einer sprechmusikalischen Auf-Fassung der “Ästhetik des Widerstandes” die madrigalhafte Ineinanderfügung der Stimmen von “Bambiland” (2005) fort. Durch den Kunstgriff, den rückblickenden Erzähler als Gewordenen mit der abgeklärt-sonoren Stimme Peter Frickes zu besetzen, die passionierten Passagen des erinnerten Werdens dahingegen mit der agil-appellierenden Tonart des jungen Robert Stadlober, erhellt sich das monolithisch Monumentale des Wälzers. Satz für Satz, Sequenz nach Sequenz geht die rhythmische Rede der exzellenten Sprecher: Hier in Wechsel und Ergänzung, dort in Kanon, Reprise und Überlagerung offenbart sich eine veritable Sprechoper, deren klangliche Zugaben sich auf drei karge Akzente beschränken. Da ist die Stille. Da sind die synkopisch gesetzten Akkorde des (Rock-) Komponisten David Grubbs. Da sind die sekundenkurz aufblitzenden Zitate aus Feldaufnahmen: Aufflattern eines Vogels, Reiben von Stein, Klangklima an der NS-Hinrichtungsstätte Plötzensee. Als illustrierende und irritierende Ton-Explosionen punktieren sie den Prosa-Strom, welcher die Mühlräder der Bilder von Krieg und Gewalt dreht.
|||
BUCH DER BILDER
Von der legendären, den Roman dramatisch auftaktenden Ansicht des Gemetzels zwischen Göttern und Giganten auf den Reliefs am “Berliner” Pergamonaltar bis hin zu dem von Pablo Picasso (in bildnerischer Replik auf die Bombardierung der Stadt Guernica) prononcierten Aufschrei der Kreatur: Die “Ästhetik des Wiederstandes” ist ein Buch der Bilder, aus Bildern, über Bilder. Selten reicht Sprache so nahe und quasi von “innen heraus” an die Expressivität des Visuellen heran wie in diesem Epos, dessen Autor sich existenziell der Malerei und experimentell dem Film gewidmet hatte. Géricaults “Floss der Medusa”, Delacroix’ “Dantebarke”, Goyas “Erschiessung der Aufständischen”: “Was”, fragt das erzählende Ich nach dem spanischen Desaster, “was sollten wir anfangen mit diesen Zeichen der Einmaligkeit, was half uns das vollkommen komponierte Massaker, wenn alles um uns ungelöst blieb”. Der Krieg hatte die Grenzen des Vorstellbaren gesprengt. Wo nicht einmal Surrealismus und Abstraktion den Konkurs der humanistischen Idee noch zu fassen vermochten, kehren die zerschmetterten Gefechts-Szenen aus der antiken “Gigantomachie” des Pergamonaltars leitmotivisch zurück. An Stelle des Herakles klafft Leere. Geblieben sind einzelne Gesten des Kampfes, verletzte Leiber: ein durch der Zeiten Gewalten zerrüttetes Schaustück der Gewalt.
|||
DIE ERMITTLUNG
Da das Hörstück die Augen von der Lektüre befreit, schweift die Bildphantasie intensiver. Weiss’ erzählerischer Bilderbogen profitiert von diesem Sinnen-Wandel, der Visuelles in rhythmische Schübe übersetzt. Zugrunde liegt, zugrunde bleibt indes beidem die Sprache. Die Auffassung der “Ästhetik des Widerstandes” als Sprechoper verweist auf das Theaterstück “Die Ermittlung”, welches Weiss’ dezidiert als “Oratorium” angelegt hatte. Strikt aus dem dokumentarischen Material der öffentlichen Anhörungen und Verhandlungen beim Frankfurter “Auschwitz-Prozess” collagiert, kam das Werk knapp nach dessen Finale im Oktober 1965 auf 15 Bühnen heraus, zugleich in je ost- und westdeutsches Hör-Versionen.
In der akustisch dramatisierten Fassung des Hessischen Rundfunks verflechten sich Zeit- und Radiogeschichte: Es ist daher zwiefach von Interesse, dass diese über vierzig Jahre junggebliebene Inszenierung von Weiss’ – formal und in seinen Zitaten radikalem – “Konzentrat” der wahren Verhandlung nun endlich auf CD vorliegt. In elf, thematisch gebündelten “Gesängen” (“Gesang von der Rampe”, “Gesang vom Zyklon B”, “Gesang von den Feueröfen”) kontrastiert Weiss die Opferberichte von Tortur und Mord mit den stereotypen Befehlsnotstands-Phrasen der Täter. Instrumentiert von grossen Stimmen wie Fritz Strasser und der Brecht-Tochter Hanna Hiob schuf Peter Schulze-Rohr nach Stand der Kunst seiner Zeit ein packendes Gerichtssaaldrama. Wie wir heute wissen, erlag der Regisseur dabei der Verführung eines auf Spannung zielenden Genres. Jetzt, da mit der vom Fritz Bauer-Institut vorgelegten umfassenden DVD-Dokumentation des >>>”Auschwitz-Prozesses” auch insgesamt >>> 100 Stunden Originalaufnahmen zugänglich sind (NZZ, 3. 8. 2005), erkennen wir, wie wenig im theatralischen Sinne “dramatisch” der Prozess sich in Echtzeit voranquälte: Die Sprache als Wahrheit versagte kläglich auf Seiten der Zeugen, die um Ausdruck des Unvorstellbaren rangen, total aber in den Ableugnungen und Ausflüchten der Angeklagten.
-
Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstandes, 12 CD (630 Min.), BR / WDR / Der Hörverlag 2007
-
Peter Weiss: Die Ermittlung, Hörspiel (ARD 1965), 3 CD (179 Min.), Der Hörverlag 2007
ED : NZZ Phono-Spectrum , 1. 6. 2007
|||




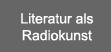

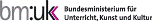

\\ oooh , wie lang muss eine bahnfahrt sein , damit ich diese 12cds hören kann , oder genauer gefragt : wohin muss mich diese fahrt führen ? steige ich vorher aus , halte ich durch ?bin ja eigentlich kein freund dieser vorgelesenen bücher , sehe aber auch , dass ich selbst in kleineren werken nur homöopathisch voran lese . empfehle für die kurzweil : paul gauguin – noa noa ; ist nicht minder revolutionsfördernd wie der peter w. – zumindest für die individuelle & aus der entspringen ja bekanntlich die grossen ideen . einen schönen wiener sommer ****
in diesem fall zahlt sich das hören echt aus, zumal das buch einigermassen seine längen hat und man dem impuls , es aus der hand zu legen viel leichter nachgibt , als ein hörbuch einige weilchen allein vor sich hin reden zu lassen . merci für sommerzeit- gemässen den Gauguin- hinweis : schliesslich machen auch wir hier sommerlich mal dicht . bestes in die Nidegger !