Salon Littéraire | Leopold Federmair: Tokyo Fragmente 7
| salon littéraire |
Ach, Kaurismäki, dieser wahre Bildkünstler! Im Gegensatz zu Odayaka, dessen Schauplatz irgendwo in Saitama sein dürfte, nicht weit von der Stadt Tokyo, ist Le Havre ein farbenfroher Film; im Gegensatz nicht nur zum japanischen Film, sondern auch zu meiner Erinnerung an die Stadt, in der ich mich freilich nur wenige Stunden aufgehalten habe, vor gut 25 Jahren. Alles in Kaurismäkis Le Havre ist alt, heruntergekommen, abblätternd, zerfransend, und zugleich hält alles an sich, die Menschen halten an den Dingen fest und an sich selbst, an dem, was sie darstellen, an ein paar einfachen Grundregeln, ja: an überlieferten und selbstgewählten Regeln. Wie die Dinge so die Leute, diese Verlebten, aber nicht Verhärmten; diese Bitteren, aber nicht Verbitterten. Die Schönheit der Bilder, der alten Häuschen, der rostigen Container, abgetretenen Kais, schaukelnden Boote. Jukebox und Flipper, alles noch da. Neulich – vor zwei Jahren – in Ménilmontant, da habe ich genauso ein Café gesehen, genau solche Leute, alte, zerfurchte, zerzauste Langhaarige in Lederjacken, und ich habe nicht gezögert, eine Münze in den Schlitz zu werfen. Modernisierungs… nein, nicht -verlierer, sondern -verweigerer. So kann man durchs Leben kommen, bis zum Ende, das nicht einmal bitter sein muß. Ganz realistisch, Aki! (Finnischer Name, nicht japanisch.) Noch nicht Ende. Wie durch ein Wunder – das Wunder der Liebe – wird Arletty wieder gesund. Wie durch ein Wunder, aber es ist kein Wunder, sondern schlichte Menschlichkeit, wird der afrikanische Junge, der eigentlich nach London will, aus den Klauen der Ausländerpolizei gerettet, sogar der Kriminalinspektor hilft dem Jungen, er ist nicht, jedenfalls nicht immer, auf der Seite des Staates, sondern der Menschen, die sich und ihre Nächsten vor dem Staat, der vorgibt, sie zu schützen, schützen.

Andenkenverkäuferin in Asakusa
Man sieht in diesem Film, was Nachbarschaft ist, Nachbarschaft, die Gemeinschaft wird und sich durch die Jahrzehnte hält – spontane gegenseitige Hilfe, die keine Ideologie oder Religion braucht, nur die Erkenntnis, daß das Leben für alle Beteiligten einfacher ist, wenn man einander stützt. Junge Leute kommen in diesem Film nicht vor, nur Alte, abgesehen von dem zehn- oder zwölfjährigen Afrikaner. Diese Gesellschaft ist überaltert, sagt der Film, oder genauer: sie ist alt, und das kann eine Chance sein, wenn die Erfahrungen etwas fruchten. Wo sind die jungen Erwachsenen? Die mittlere Generation? Versteckt? In der Vorstadt, den Wohnblocks? Sind sie nie – auf die Welt gekommen?
Zu Hause, in unseren Wohnblocks, die auch ihre Schönheit haben, Kaurismäki könnte das zeigen, verfolge ich immer aufs neue, wie die Nachbarschaftshilfen zustande kommen, die lockeren Netze. Gottseidank wird manchmal jemand krank, fehlt manchmal etwas, geht etwas zu Ende, da kann dann jemand einspringen. Es zeigt sich, wie viele Kräfte, Reserven, Güter in den Wohnungen stecken, in unvermuteten Winkeln, wie viel Zuneigung in den Menschen. Das eigentlich Forum, Ort des Austauschs, ist dort der Spielplatz zwischen Block 3 und 4, wo ich oft an einem Baum oder Zaun lehne, den Blick abwechselnd auf die Kleinen und, sagen wir, auf die zwischen den Hügeln untergehende Sonne, die sich heraufschlängelnde, schmale Straße gerichtet. Diesen Austausch bewerkstelligen vor allem die Frauen, sie sind die Solidarischen, die Hilfsbereiten; Männer tauchen kaum auf, sie stecken in der Arbeit, dort werden sie, wie uns Odayaka zeigt, gegeneinander gestellt (das Miteinander bei der Abendunterhaltung nur Zwang und Schein). Natürlich gibt es hin und wieder auch einzelne, die auf irgendwelchen Regeln bestehen, allgemeinen Regeln, nicht im Forum zwischen Block 3 und 4 entstandenen, es gibt ängstlich ans System angepaßte Menschen, wie man sie auch in Odayaka sieht. Aber zugleich die Hoffnung und Erfahrung sich frei, notfalls gegen Widerstände, herausbildender Nachbarschaft. In Le Havre ist das selbstverständlich (aber es gibt auch einen Denunzianten, einen Spielverderber), eine alte Errungenschaft, von den Leuten selbst, dem Schuhputzer und der Ehefrau und der Bäckerin und der Cafébesitzerin und dem Krämer usw. selbst errungen. Geht man nach diesen zwei Filmen, so scheint die echte Nachbarschaft weniger selbstverständlich zu sein als in Frankreich. Aber man muß auch sagen, daß Le Havre bewußt und von Anfang an die gegen den allseits drohenden Verfall fortbestehende Harmonie inszeniert. Es ist, mitsamt den Fragmenten lokaler Wirklichkeit, ein utopischer, ganz leicht ironischer Film. Die Ironie weht darin wie ein frisches Lüftchen an einem warmen Sommertag.
Und so sprechen die Schauspieler, mit großem Ernst und leiser Ironie. Standhaft halten sie ihre Sermone. Mit ihren Sätzen schmücken sie den Alltag aus. Es ist darin etwas vom Pathos, das ich auf französischen Theaterbühnen oft gehört habe, zum Beispiel im Seidenen Schuh , den der alte Antoine Vitez im Chaillot-Theater inszenierte. Und auch die Rohmer-Filme spüre ich irgendwo im Hintergrund, Hinterkopf, und vielleicht ein bißchen Godard, ohne die Blödeleien Godards. Nicht Pathos der Distanz, sondern Distanz zum Pathos, und diese Distanz wird gezeigt, gespielt. Annäherungen ans wirkliche Pathos, das für uns immer das griechische sein wird (unsere Vorstellung vom Griechischen). Zurückhaltung in der Liebe, im Schmerz. Das geht natürlich nur mit der größten Bewußtheit, ergo Künstlichkeit.
Jetzt lobst du auf einmal das Künstliche, während du sonst immer auf der Suche nach dem Natürlichen bist.
Stimmt, ich geh einmal in diese, einmal in jene Richtung. Beides brauchen wir, vielleicht können wir’s ja versöhnen. Oder abwechselnd, nebeneinander, du weißt schon…

Zwei Filme
Eine ganze Weile habe ich das Wort “Würde” vermieden. Was ist das, Würde? Daß einer zu dem steht, was er ist. Aber dazu muß er erst einmal etwas werden, er muß etwas aus sich gemacht haben. Die Leute in Le Havre sind keine Nullen, ils ne sont pas nuls , sie stellen etwas dar, allen voran, den Brustkorb geweitet, Marcel Marx. Das heißt, die Figur stellt etwas dar, während sie vom Schauspieler André Wilms dargestellt wird. Wilms spielt, wie sich Marx – fast hätte ich gesagt: aufspielt… Im herkömmlichen Sinn kann man das Wort hier nicht gebrauchen, aber in einem anderen? Marcel spielt seine Fähigkeiten aus, Umsicht und Lebensgewandtheit, doch er nimmt sich als Person zurück, um den Zusammenstößen mit der Macht zu entgehen. Denn die Macht ist es, die die menschlichen Biotope bedroht. Marcel lebt zurückgezogen, er steht seinen Mann, geht aus sich heraus.
Nostalgie? In Maßen. Eher schon, in kritischen Augenblicken, ein nüchternes Wiederholen dessen, was vor Jahren geschehen ist, und der Spuren, die geblieben sind. Wie es immer noch wirkt… Gedächtnis statt Nostalgie. Manchmal darf man über sich selbst gerührt sein.
Die Macht hat ein Gesicht, sagte ich. Die Macht hat viele Gesichter, mitunter auch unser eigenes. Und die Mächtigen – die Funktionäre der Macht – kommen mitunter in die Lage, daß sie gegen die Macht, die sie vertreten, handeln müssen (oder wollen). Aber Léaud, Jean-Pierre Leaud? Namenlos im Film, ein Schatten, in einer Nahaufnahme sieht man seinen Nacken, ein anderes Mal durchquert er das Bild im Mittelgrund. Vor dem Film habe ich mich gefragt, ob ich ihn erkennen werde; lange nicht gesehen, Jean-Pierre, der Mann ist inzwischen gealtert. Eh bien, je l’ai tout de suite reconnu, und ich war zufrieden, daß ich ihn gleich erkannt hatte, diese kleine Tatsache hat zu meinem Filmglück beigetragen. In Le Havre spielt er einen Denunzianten; den ewigen Denunzianten, besser gesagt; den Freund der Ordnung, dessen Eifer vielleicht nur von seiner Einsamkeit herrührt. Mehrmals – oder doch nur einmal? – sieht man die Hand Léauds zum Telephonhörer greifen. Dieser Hörer ist klobig und schwarz, zehnmal so schwer wie ein Handy. Alles ist alt in Le Havre, auch die Dinge. Und doch sind wir mitten im 21. Jahrhundert. Le Havre ist ein Zukunftsfilm.

Koch in Asakusa: “Hier schmeckt’s!”
Jean-Pierre Léaud ist für mich ein wandelndes Zeichen, das durch sein Auftauchen eine Kultur und eine Epoche evoziert. Nostalgie? Nein, Gedächtnis. Wer könnte so spielen wie er? Niemand. Und doch verkörpert er das Frankreich der sechziger, siebziger Jahre. Showa-Time. In allen Filmen spielt er immer nur Nebenrollen, er taucht auf und verschwindet, nervös, schusselig, eine Zigarette zwischen den Fingern. Begierig, irgend etwas zu tun. Tut dann nichts Rechtes, oder das Falsche. Das gilt für die Filme, die ich gesehen habe. Mag sein, daß er auch Hauptrollen gespielt hat, daß er einen Charakter sorgfältig zu entwickeln imstande ist, daß er die Figur dies und jenes durchleben, durchleiden läßt. Soweit ich die Filme in Erinnerung habe, zieht er stets periphere Kreise, kommt nur am Rand ins Bild. Ach ja, Kaurismäki soll ihn wiederentdeckt haben, 1990, aus dem Schatten geholt, als die Showa-Epoche gerade zu Ende war. I Hired a Contract Killer, spielt er da nicht sogar die Hauptrolle? Natürlich einen Bösewicht, Ungustl, Spielverderber, der alles in Frage stellt – das ist vermutlich der Grund, warum man ihn braucht. Diesen Film habe ich nicht gesehen. Vielleicht können in unserer Epoche nur jene Leute zu künstlerischer, schöpferischer Stärke gelangen, die sich in ihrer Arbeit oder in ihrem Leben mit der Showa-Kultur auseinandersetzen, sie weiterspinnen, parodieren, erneuern? So gesehen leben wir heute im Post-Showa. Im Underground geht die alte Zeit weiter, und was sich oben abspielt, kann dem da unten, dem nächtlichen Treiben, hin und wieder den Whisky reichen.
Das wäre eine Showa-ten-Frage, ein Thema für die nächtliche Universität. Ich nehme mir vor, Yoshiyuki oder einen seiner Stammgäste nach Léaud zu fragen. Fürchte aber, daß er ihn gar nicht kennt. Andererseits, ich habe den Meister schon öfters unterschätzt. Von Cherbourg ist es nicht weit nach Le Havre.
*
Noch eine Gemeinsamkeit der beiden Filme: die bleierne Zeit. Als Befund formuliert: Wir leben in einer beschissenen Zeit. Hier zielt man mit Maschinenpistolen auf afrikanische Kinder und steckt “illegale” Menschen in nicht sehr legale Konzentrationslager; dort treibt man die Modernisierung, die sich längst überlebt hat, Jahr für Jahr weiter, bis ein Atomkraftwerk in die Luft zu fliegen droht. Beschissen hier wie dort. Bleischwer. Und angeblich kann man nichts tun. Man soll tun, was angesagt ist. Angezeigt durch Bildschirme, Megaphone. In Le Havre sieht man kein einziges Fernsehgerät. Auch das ein Zeichen der Hoffnung.
*
Ich schreibe in einem Café namens Granité. Das Wort wird man vergeblich in Wörterbüchern suchen; ich frage mich, wie die Chefin auf diesen Namen gekommen ist. Er erinnert mich lediglich an granita , aber dieses Wort weist nicht nach Paris, sondern nach Catania, wo man im Sommer in den Cafés statt dem Kaffee gefrorene Mandel- oder Kaffeecreme zu sich nimmt. Oder die Chefin hat beim Abschreiben aus dem V ein N gemacht. Fehlerhafte Würde in bleierner Zeit?
Ich schreibe in mein Heft, weil man hier sowieso nicht mit den Leuten reden kann. Drei oder vier Tische in der Gaststube, zwei Stufen tiefer. An der Theke ist links neben mir ein Freundinnenpaar ins Gespräch vertieft, rechts ein Liebes- oder eher Ehepaar in ein Display, das gar nicht so mini ist: eine Technoplatte, auf der sie mit ihren Fingern herumzeichnen, die Köpfe zusammengesteckt. Eigentlich wollte ich in der Crêperie speisen, die ich vor dem Abendfilm hier in der Gegend entdeckt hatte, aber dort waren sie schon am Schließen. Nostalgie, gewiß, die schönen Bilder aus der Normandie hatten mein Verlangen nach dem meibutsu , der regionalen Spezialität, geweckt.

Granité aléphienne disparue
Also habe ich mich von der engen, steilen Treppe leiten lassen, dieser himmelwärts führenden Kellertreppe. Zweiter Stock, nach japanischer Zählweise. Die Überraschung war ein Zusammenstoß mit zwei Leuten, die gleich hinter der Tür standen, offenbar im Begriff, ihre Rechnung zu bezahlen. Ich hätte auch mit der Chefin zusammenstoßen können, denn sie schlüpft durch den Leerraum unter dem comptoir, statt die Platte hochzuklappen, wie es in den Pariser Cafés üblich ist. Die Registrierkassa steht oben drauf, wahrscheinlich, um Platz zu sparen. Die Chefin schlüpft durch, wendig wie eine Gazelle, gebückt, Gläser und Teller in der Hand. Wie eine Gazelle, ja: eine zierliche Frau, gut geschminkt, bestimmt ist sie älter, als sie aussieht. Sie werkt im engen Winkel des Thekenraums, flink, jeder Handgriff genau bemessen, keine Geste zuviel. Ich traue mich nicht, sie anzusprechen, so beschäftigt ist sie. Andere Gäste tun es, rücksichtslos, sumimaseeen ; die Frau lächelt, nickt. Sie merkt, daß auch ich etwas will. Hier muß niemand seine Stimme erheben.
Ein Musterbeispiel für unaufdringlichen Arbeitseifer, die Chefin. Ich habe ein Cassoulet bestellt, und sie hat mich rhetorisch schüchtern gefragt, ob ich dazu eine Baguette will, für 150 Yen. Schmeckt gut, ihr Cassoulet, besser als das, das ich in Paris zu essen pflegte am Dienstagabend, wenn ich erschöpft aus der Provinz in meine Mansardenwohnung kam. Nicht so schwierig, wird man sagen, ein beim Araber neben dem Hauseingang erstandenes Cassoulet aus der Dose zu übertreffen. Okay, es schmeckt einfach gut, auch ohne Vergleich, ein bißchen klein natürlich, aber perfekt, das Fleisch nicht zu weich, nicht zu hart, die weißen Bohnen, derdiedas Baguette, alles perfekt. Und die blau-weiß-roten Eiffeltürmchen auf Schränken und Regalbrettern, das französische Flair… Die Speisenkarte ist ziemlich lang, ausgewogen, allem Anschein nach bereitet die Chefin alle Speisen hier in ihrem Winkel zu, auf winzigen Herden, in kleinen Backrohren. Ich sehe keine Möglichkeit, wie sie sich sonst behelfen könnte, kein Hinterzimmer, keine Helfer… Diese Vielfalt und Perfektion ist nur möglich, wenn sie alles genauestens vorbereitet und die Arbeitsstunden, bevor die Gäste kommen, genauestens eingeteilt. Unscheinbar herrscht die Chefin im Zentrum des Mikrokosmos.
*
In der Nähe eines der Ausgänge des Shibuya-Bahnhofs steht auf einem Sockel die Statue eines Hundes, der dort mit durchgestreckten Vorderbeinen auf seinem Hinterteil sitzt. Dazu gibt es die passende rührselige Geschichte von einem Tier, das – angeblich an derselben Stelle – auf sein Herrchen wartete, weit über dessen Tod hinaus. In der Zeit, als man die Raucher zu stigmatisieren begann, wurden dort Aschenbecher aufgestellt. Offenbar nicht genügend, denn die Statue ist von einem Kippenteppich umgeben. Oder es ist dies einer der wenigen Orte, wo die Raucher, die ja schließlich auch Menschen sind, dem nie ganz zu unterdrückenden Bedürfnis nach Schmutz und Unordnung nachgeben. Sonst findet man in ganz Tokyo keine einzige Kippe auf den Plätzen und Gehsteigen, nicht einmal im Rinnstein. Diese Raucherzonen sind extraterritoriale Gebiete, Sammelplätze der Außerirdischen. Im 20. Jahrhundert war es umgekehrt, die Nichtraucher bildeten eine Minderheit, vielleicht nicht der Gesamtbevölkerung, aber sicher unter den Männern. Neulich habe ich den Film M – eine Stadt sucht einen Mörder wiedergesehen, da wird gepafft und gepafft, unter Polizeibeamten genauso wie unter Verbrechern. In einem Wiener Tatort von 1987 sind sämtliche Cafés und Beiseln grünlich-grau verschleiert, die Polizisten tschicken ständig (außer Christoph Waltz). In einem Film von Wim Wenders aus den siebziger Jahren rauchen die Leute im Flugzeug. Undenkbar, daß heute jemand im Flugzeug raucht!
*

Meeresluft
*
Nähert man sich dem Takeshiba-Pier, beginnt man, Meerluft zu riechen. Ein paar hundert Schritte weiter nach Süden ist die Anlegestelle, von der Schiffe nach Asakusa fahren, den Sumidagawa flußaufwärts. Es sind große Boote für Ausflügler, die hier ablegen; die meisten Reisenden gehören zu Gruppen, die einer Führerin mit hochgerecktem Fähnchen folgen. Kein Linienverkehr, obwohl die Fahrt nach Asakusa kaum länger dauert als mit der U-Bahn. Ich dachte, die kleine Reise könne mir ungewohnte Anblicke der Stadt bieten, aber im Grunde wirkt sie vom Boot aus, bei etwas Distanz, so geleckt wie die meisten Hochhausviertel, wenn man durch ihre Straßen schlendert. Keine anarchischen Kanäle, keine Hinterhöfe, keine Ausgänge oder versteckten Winkel. Alles ordentlich, geputzte Fassaden; eine Weile sieht man an der Kaimauer Reproduktionen von berühmten Holzschnitten: Hokusai, Fuji-san mit Meereswelle und so weiter. Ein System von aufeinander folgenden Schleusen, Stakkato für einen Nebenarm. Und die Brücken über den Fluß, der Reihe nach in den Spektralfarben bemalt. Sieht nett aus. Uniformierte Frauen verkaufen Mitbringsel. Am beliebtesten, heißt es, ist ein Handtuch mit dem Umriß vom Skytree drauf, der letztes eröffnet wurde, das höchste Gebäude Tokyos . Man kauft das Beliebteste, um sich beliebt zu machen.

Mitreisende
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der Schiffahrtgesellschaft fielen vor meinen Augen zwei Handschuhe von einem Fahrrad zu Boden. Ich bückte mich, legte die Handschuhe vorsichtig auf den Sattel. Die Fahrerin war eine junge Frau, ich sah sie nur aus den Augenwinkeln, wollte mich nicht aufdrängen. Sie hob einen zwei- oder dreijährigen Jungen aus dem Sitz und war gerade dabei, ihr Kind auf dem Asphaltboden abzustellen, als sie meine Geste bemerkte und mich mit einem Ausdruck von Staunen und Dankbarkeit ansah. Nicht ins Gesicht, nein, wie auch ich ihr nicht ins Gesicht blickte. Beide trugen wir Mäntel und Schals, wie die meisten Leute an diesem Wintertag, so vermummt ist man nicht wendig, geht nicht aus sich heraus. Aber für eine Sekunde oder zwei hielten wir die Anwesenheit des anderen fest, und es war da eine Verbindung zwischen uns, nur für diesen kurzen Moment. Dann wandte sich die Frau ihren Kindern zu, da war noch ein zweites, größeres, das mit dem eigenen Fahrrad gekommen war. Offensichtlich wohnte die Familie in einem der vielen Hochhäuser in der Nähe, am Ufer der Bucht von Tōkyō. Später sah ich auch den Vater der beiden Kinder, der mir auf Anhieb gefiel mit seinem schmalen, gepflegten Wangenbart, den rechteckigen Brillen und der hip-hop-mäßigen Mütze. Ein Intellektueller, dachte ich, nicht nur er, auch seine Frau; eine Intellektuellenfamilie, oder in der Musikindustrie tätig, Unterhaltungsbranche. Jedenfalls kein salaryman.
Wer weiß… Ich widmete mich dem Fluß und den Brücken. Machte Fotos, zu viele. Wie jemand, dem langweilig ist.

Mitreisende
*
Asakusa, sofort vertraut, obwohl ich an die zehn Jahre nicht hier war. Ein charakteristischer Ort, den die Snobs meiden, weil er zu beliebt, zu “typisch” ist. Snobs mißtrauen allem, was beliebt ist. Diesmal habe ich nur wenige Schritte getan in der Menge, die zwischen zahllosen Verkaufsbuden dem Asakusa-Schrein entgegenstrebt. Bin aus dem Mainstream ausgetreten, weiter in einem der beiden Seitengänge. Und dann durch die überdachten Verkaufsstraßen zurück zum alten Kaufhaus über der U-Bahnstation.
Yasunari Kawabatas erster Roman spielt in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in diesem Viertel, wo der Autor damals lebte. Ganz anders als seine späteren Romane, eher an europäische und amerikanische Großstadtromane erinnernd, Berlin Alexanderplatz oder Manhattan Transfer, ist Die rote Bande von Asakusa eine Panorama-Collage von zahllosen kleinen Szenen, Bildern, Eindrücken. Und so wirkt das Viertel immer noch, ein unübersichtliches Gewirr, zahllose Kneipen, winzige Geschäfte, Vergnügungsetablissements. Hier habe ich uralte, mechanische Pachinkoautomaten gesehen, so rührend wie die alten Flipper und Musikboxen, die ich im Fragment über Le Havre erwähnt habe. Mich erinnert das Viertel an bestimmte Marktgegenden in Mexiko-Stadt, mit den niedrigen, ein- bis zweistöckigen, dünnwändigen, oft auch schiefen Häusern und dem brüchigen Asphalt, der die Erde nicht ganz verdrängt hat, mit der Quirligkeit von Pfaden und Fußgehern, Karrenschiebern und Radfahrern. Ich kenne die südostasiatischen Städte nicht, außer Hong Kong – und wirklich, jetzt, wo ich davon schreibe, stellen sich Bilder aus der Marktgegend von Mong Kok ein, wo ich damals ein paar Tage wohnte. In Japan ist Asakusa das letzte Relikt einer vergangenen Zeit. Prä-Showa.

Skytower, rechts von Asakusa
*
Daß Olga, wenn sie heute in Wien herumspaziert, das Getrappel der osmanischen Reiterei hört, wird mit ihrer Geschichtsmanie zu tun haben: eine Eigenschaft des sowjetischen wie des kakanischen Menschen (wird sie sagen). In der Erzählung, die sie letzten Sommer in Klagenfurt vorgelesen hat, sind die vertikalen Schnitte durch das Fleisch der Geschichte ins Virtuose getrieben. Das war schön, ein kleines literarisches Fest. Fest der Ähnlichkeiten… Augenzwinkernde, leicht ironische Kapriolen. Auch in ihrem Roman ist das so, am Anfang der Kapitel stehen latente und aktualisierte Jahreszahlen vom 5. Jahrhundert vor Christus über 1871 bis zum Jahr 2006, in dem sie schrieb. Das Allermeiste spielt dann doch in der Gegenwart. Aber Geschichte ist Gegenwart, im Fernglas der Lebenden gefangen.

Das Fernglas der Lebenden ( Matrose in Bildmitte )
*
Was höre ich, wenn ich auf dem Platz vor dem Shimbashi-Bahnhof stehe? Vielleicht das Rumpeln des Erdbebens von 1923. Mit Hilfe der Internet-Suchmaschinen lassen sich im Handumdrehen – mit der Zeigefingergeste – jede Menge vertikaler Schnitte setzen. Vom Bahnhof sind nur wenige Mauern übrig geblieben. Das Foto erinnert an die Bilder von Hiroshima, August 1945, das Mauerwerk an das Skelett, das heute als Wahrzeichen im sogenannten Friedenspark steht.
Schnitte durch den Frieden zum Krieg, zu den Katastrophen. “Zufällige Boten der geköpften Zeit…”
*
Hier ein Excelsior-Gedicht aus den alten Zeiten:
Spektrale Gletscher glänzten
umwirbelt von Schnee,
und die Luft war erstarrt.
Vom heiteren Himmel
fiel eine Stimme
wie ein fallender Stern:
Excelsior! Excelsior!
Und das Echo schwoll:
Nevermore!
*
Wann werden die Fotos gut? Wenn mich das Aufnahmefieber packt. Immer nur kurz, es ist ein unvorhersehbares Erschauern. Die Fotos häufen sich dann – nein, häufen sich nicht, was stattfindet, ist eine Verdichtung. Die Bildwelt vor mir nimmt an Dichte zu, die Sehbarkeit ist plötzlich erhöht, die Welt verlangt nach Ablichtung. Dann nehme ich die Fotos nicht, I don’t take them, shiyashin o torimasen, ich mache sie. Beginne, Unwahrscheinliches zu photographieren. Verliere für kurze Momente die Scham, werde unverfroren. Das Ergebnis? Auf den Fotos ist etwas zu sehen, das ich beim Machen nicht gesehen, ja, nicht einmal geahnt hatte. Um diesen Punkt, diesen Fleck, dieses unbewußte Motiv herum entfaltet sich das Bild.
*
Leopold Federmair @ in|ad|ae|qu|at zu Japan , dessen Kunst und Kultur :
- J-Sounds 日本 ( programmatisch )
- Eine Reise nach Matsuyama | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Der Schatten über Yukikos Auge ( Junichiro Tanizaki : Sasameyuki ) | J-Sounds 日本 | espace d’essays |
- Die Traumbrücke | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Ōgai Mori, Arzt, Soldat und Schriftsteller | J-Sounds 日本 | espace d’essays |
- Tokyo Fragmente 1 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 2 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 3 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 4 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
- Tokyo Fragmente 5 | J-Sounds 日本 | salon littéraire |
|||
Hinweise : Leopold Federmairs Die grossen und die kleinen Brüder . Japanische Betrachtungen ist soeben im Wiener Klever- Verlag erschienen . Das Buch wird am Mittwoch , den 13. November ( 19 H ) in der Buchhandlung Frick vorgestellt . – Buchhandlung Frick International , 1010 Wien , Schulerstrasse 1 -3 :
Der österreichische Autor Leopold Federmair lebt seit elf Jahren in Japan. Für die Zeitschrift Lichtungen hat er zusammen mit Nobuo Ikeda eine Sammlung neuer japanischer Literatur herausgegeben, die zeigt, dass es abseits von Superstar Haruki Murakami noch sehr viel zu entdecken gibt. Zusammen mit dem von ihm übersetzten Erzähler Yu Nagashima wird er die Nummer 136 der Lichtungen präsentieren. Außerdem liest Federmair aus seinen unlängst bei Klever erschienen Japanischen Betrachtungen (Essays und Erzählungen) und dem von ihm übersetzten Roman Das Casting von Ryu Murakami, erschienen im Wiener Septime Verlag.
|||




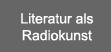

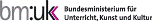

Ich erinnere mich an einen Film, der in den 90ern im WDR-Fernsehen lief. Er war mehr als 20 Jahre alt, dauerte mehr als 13 Stunden und wurde in mehreren Folgen gesendet: >>> OUT 1 – Noli me tangere. Dort spielte Jean-Pierre Léaud eine der Hauptrollen; falls es in diesem zumeist improvisierten Film überhaupt so etwas wie Hauptrollen gab.
Der Blick und auch die Erinnerungen, die Stellungnahmen in diesen Fragmenten sind bewußt subjektiv, wobei ich auch mein Bewußtsein davon ausdrücken wollte, also Zweifel, Zögern, Selbstkorrekturen usw. In der Buchfassung habe ich die Bemerkungen zu Léaud geändert, nachdem der Verleger, ein kluger und freundlicher Mann, mich darauf hingewiesen hatte, daß Léaud in einem der wichtigsten Filme der Nouvelle vague die Hauptrolle spielt: La putain et la maman, von Eustache. Trotzdem, sogar in diesem Film, wo Léaud fast die ganze Zeit auf der Leinwand zu sehen ist, hat man oft das Gefühl, daß er gleichsam nur zufällig in den jeweiligen “cadre” hineingestolpert ist und sich jeden Augenblick wieder davonmachen könnte. Eine Art der Präsenz/Nichtpräsenz, die ich von keinem anderen Filmschauspieler kenne.