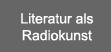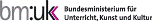Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text
Salon Littéraire | Robert Prosser :
Regenschirme , Trommeln ( Ghana , Juli 2012 )
1.
Mit Einbruch der Nacht verklingt in Palmen das Zirpen, aufgewirbelter Sand färbt die Luft rot, das Scheinwerferlicht vorbeifahrender Taxis gleitet über Fassaden und Gesichter, als würde es langsam zur Jagd schleichen. In den Bars, die am Guinnessschild übern Eingang der Holzbaracken zu erkennen sind, verkörpern Hüftkreisen und Gelächter eine Sehnsucht, die im Tropenklima prächtig wächst; katzenartig zirkuliert Lebenswillen wie eine Krankheit im Blut. Ich knipse das Licht im Zimmer an, aufgeschreckt vom Lärm der gegenüberliegenden Straßenseite, unterm Rotieren des Ventilators mit meiner uneingestandenen Angst vor Moskitos und Malaria.
Im östlichen Berggebiet Ghanas, nahe der Grenze zu Togo, treiben Trommeln einen Spalt in meinen Schlaf. In einem anliegenden Hof feiert eine Methodisten- oder Presbyterianer-Gemeinde eine Messe, ihre sich steigernden Rhythmen zertanzen den christlichen Glauben, bis das ausgerufene, wie triumphierend in die Dunkelheit gehaltene Wort Jesus im Singen, Klatschen davontreibt, infiziert von der Nervosität der Rasseln und Gesänge. Im Tanz treiben bunte Baumwollkleider ekstatische Blüten, als Driften hin zur Trance, deren unwissender Zeuge ich werde, geduckt ins Schreien einer Frau: Put the Demon away from me. Ich öffne die Eisentür und erschrecke wegen des metallischen Klirrens, tappe den Hang hinunter, zu einem Baum, dessen Astwerk tagsüber die Aufregung unzählig gelbgefiederter Vögel birgt; für ein paar Schritte begleitet mich ein dürrer Straßenhund, dem man die dauernden Prügel an den Rippen abzählen kann. Frauengestalten huschen unter verschatteten Blättern und schlafenden Vögeln eilig vorbei, ihre Gewänder ein blitzender Kreisel grün, violett, gelb und rot codierter Geheimnisse des Alltags Westafrikas. Im Tal breitet sich über Dächern ein schwaches Leuchten aus, aber hier sind nur die Stimmen, die Trommeln und Farben, deren Sinn ich nicht verstehe.

Kumasi, Markt
Nächte tarnen das von der Atlantikküste bis in den Norden mit Obstplantagen durchsetzte Land mit Unberührtheit, so, als gäbe es Staub, Plastikmüll und Abgasschwaden nicht. Nächte enthüllen die Hässlichkeit der Großstädte wie Accra oder Kumasi; kaum Straßenbeleuchtung, aber dafür die abbröckelnden Mauern, stinkenden Rinnsale und ein Himmel, der am Gerippe der Sendemasten flattert. Jeder Ort in Ghana bekommt seine unerklärliche Schönheit durch die Menschen und ihre Stimmen verpasst. Man kümmert sich nicht um die öffentlichen Plätze und den Müll, aber sorgt sich um die Beziehungen untereinander. Man flirtet, debattiert, aus den Autoradios dröhnen anstelle von Musik Diskussionen und Predigten, es ist ein ständiges Kennenlernen, Handeln, Erzählen und ein jeder Streit lässt sich beenden, indem man das Gegenüber mit der Bemerkung You are talking too much bloßstellt.

Accra
In Cape Coast ragt auf einem Küstenfelsen weißgewaschen das ehemalige britische Sklavenfort; ein Tunnel weist ins Kellergewölbe zu fünf Kammern, in deren Dunkelheit die Gefangenen zu Hunderten monatelang ausharren mussten. Auf Steinmauern kratzten sie unscheinbare Zeichnungen; der vermeintliche Lehmboden des Kerkers wird als eine über Jahrhunderte angesammelte und festgetretene Mischung aus Blut, Kotze, Pisse und Scheiße enthüllt. Durch die Deckenwand führt eine Luke zum kirchlichen Vorplatz, die Pastoren des anglikanischen Glaubens gafften von dort auf den ineinander verkeilten, schwitzenden, kämpfenden Menschenhaufen hinunter und fühlten sich in ihrem Weltbild von wegen Himmel und Hölle bestätigt. In den Mauern des Forts verbleichen die Grabtafeln der Peiniger, Malaria oder Gelbfieber rafften an der Atlantikküste Gouverneure, Ehefrauen, Soldaten und Mätressen dahin, die namenlosen Sklaven gelangten, so sie den Kerker überlebten, durch ein niedriges Tor, welches die Aufschrift Gate of no Return trug, auf Beiboote und weiter zu Schiffen, die dort ankerten, wo gegenwärtig die Flotte von Iglo auf der Suche nach ergiebigen Fischgründen eine andere Form der Unterdrückung pflegt. Die Fischer von Cape Coast sitzen zwischen aufgebahrten, mit bunten Fähnchen geschmückten Booten, die Dienstags nicht ins Wasser gelassen werden, weil dieser Tag der Meeresgöttin geweiht zur Ruhe verpflichtet.

Cape Coast
An einer Kreuzung in der nördlichen Großstadt Tamale wirkt eine Hauptstraße, an welcher aus Marokko, Burkina Faso oder Mali kommende Trucks vom Saharasand gereinigt werden, als Trennlinie. Auf einer Seite die beleuchtete, große Tankstelle, ein steriler Fremdkörper, ein wenig vom Boom verratend, der Teile der Gesellschaft ergriffen hat, seit vor der Küste Öl entdeckt worden ist, und gegenüber der Königspalast, ein zu Strohhütten zusammengefügter, aus rotem Lehm gebrannter Compound. Ein im Weggeflecht des Marktes angetroffener Prinz lädt zu einer Führung ein, erst stellt er mir die “Talking Drums” vor, dann seine Mutter, eine von vier Königsfrauen. Erstere warten im dunkelgrün ausgemalten Zeremonienraum auf die nächste Ekstase, wenn der Musiker in den Klängen der großen Trommeln die Zukunft hören wird, zweitere sitzt an der rußschwarzen Feuerstelle des Innenhofes und rupft ein totes Huhn. Prinzen begegnet man – wie Pastoren – auffällig vielen; junge Männer, die wie alle anderen auf die große Liebe, die Gotteserfahrung oder eine gutbezahlte Arbeit hoffen. Aufgrund eines komplizierten Verwandtschaftsverhältnisses repräsentieren sie das Erbe von Stammsystemen, die dem Alltag Ghanas zugrunde liegen. Der junge Prinz von Tamale arbeitet in der Fabrik eines indischen Unternehmens, das außerhalb der Stadt vom dortigen Stamm in großem Ausmaß Grund angekauft und Industrieanlagen errichtet hat. Er bereitet sich auf eine Begräbnisritual zu Ehren seines kürzlich verstorbenen Onkels vor, im Zuge dessen ein schwarzes Pferd geschlachtet und verspeist werden wird, und erzählt von seinem Plan, genug Geld zu sparen, um nach Südafrika zu reisen, einem Land, welches ihm Zukunft verspricht.

Tamale, Moschee
In Tamale bemerke ich erstmals die Masse unscheinbarer, alter Bettler. Sie tragen Regenschirme mit sich, verwahren diese sorgsam, dösen die großgewachsenen, zähen Männer und Frauen zu Mittag im Schatten eines Müllcontainers oder der Moschee. Ins Mauerwerk des Gotteshauses wurden in Hüfthöhe die arabischen Schriftzeichen einer Koransure gemeißelt, schwungvoll zieht sich Mohammeds Prophezeiung um das Gebäude, Zeichen, die als manifestierte Träume über einem der Fremden harren. Seinen Jutesack benützt er als Kopfkissen, vor ihm liegt die hölzerne Bettlerschale, ein zierliches Attribut der hageren, in ein weites, weißes Gewand gehüllten Gestalt. Auffällig sind besonders die Augen dieser Unbekannten. Darin liegt ein anderes Lachen geborgen, Nachhall einer weiten, flirrenden Landschaft, als würden diese Augen ein Stück Sahara in die Plantagen Ghanas schmuggeln. “They are Aliens”, sagt der Prinz und wendet sich von ihnen ab, man ist für gewöhnlich zu höflich, als dass man die Fremden verjagen würde, doch bleibt die Abneigung in jedem Aufeinandertreffen spürbar.
Es sind Flüchtlinge aus Mali und Mauretanien, die von einem Ort zum nächsten in Richtung Küste ziehen, die alten Schirme vielleicht aus Vorsicht bei sich haben, denn wer kann aus der Wüste kommend schon wissen, welche Regenfälle der Süden bereit hält. Abends sitzen die Alten im Graben zwischen Hauptstraße und Markt, wie als Vorhut ausgeschickt, den Weg zum Atlantik zu erkunden. Teil von Staub, Verkehr, ohne die Umgebung zu betrachten, wie sich auch die Einheimischen nicht um sie scheren, bis plötzlich einer auftaucht, hinkend, mit fehlenden Zähnen, das Wüstentuch um den Kopf geschlungen, und um Essen bittet. Er bewegt lachend die rechte Hand zum Mund, als Zeuge der Krisen, die mit dem Fall Gaddafis weiter nördlich begonnen haben. Bewaffnete Konflikte zwischen Tuareg, Islamisten und den Armeen afrikanischer und europäischer Staaten bedingen in Ghana unscheinbare Flüchtlingsströme. In Accra zieht ein alter Mann über eine Straßenbaustelle einen noch älteren Greis an einem Strick hinter sich nach, vorbei an einem chinesischen Polier, der unter breitkrempigem Strohhut die Bauarbeiten überwacht. Dem unbeholfen tappenden Mann fehlen die Augen, am Grund ihrer Höhlen liegt wie eine verödete Erinnerung an die zurückgelassene Heimat trockene, staubgraue Haut. Sie gehen in Richtung der Busstation, aus Bamako treffen die Minibusse ein oder fahren ab nach Lagos, zwischen dem Mauerwerk eines gleich Ruinen hochragenden Gebäudes und dem Menschengedränge verschwinden die Flüchtlinge, in Abgasen und Pissgestank, schreienden Kindern und gestapeltem, schwarzgeräuchertem Fisch.
Auf den Märkten begegnet man Europa in Erzählungen und Gerüchten, eine Frau spricht mich auf das harte Asylrecht Österreichs an, das ihren Bruder aus der EU vertrieben habe, ein Prediger, der, mit einer Bibel bewehrt, den Verkäuferinnen Psalmen und die Offenbarung des Johannes ins Ohr flüstert, während sie Schafschädel zerhacken oder aus Maisteig Fufu genannte Bällchen formen, schwärmt von seiner jahrelangen Arbeit als Staplerfahrer am Frankfurter Flughafen. Im Zentrum von Kumasi, Ghanas bevölkerungsreichster Stadt nach Accra und Sitz des Ashanti-Reiches, wuchert der größte offene Markt Westafrikas. Ein Organismus, der übers angestammte Areal der Wellblechhütten, von den Tischen der Metzger und zwischen Innereien- und Fettresten hervor, weiterwächst, die umliegenden Straßen, Häuser und Plätze ergreift, einen packt und durchschüttelt, während des Drängens, Schauens, Sprechens, begleitet vom süßlichen Geruch geschlachteter Rinder.
Ihre abgezogene, in Öl schwimmende, gelbe Haut, griffbereite Macheten, ratternde Nähmaschinen, der feste Bettlergriff an den Unterarm, die muslimischen Geldwechsler: ständig arbeitet man am großen Chaos der Fleischhaufen, Rattenschädel, Schlangenhäute; Küchengeschirr, Obst und Gemüse, lebende, handgroße Schnecken und Krabben, flirrende Hitze über Ölwannen, klappernde Scheren, an Messerklingen klebende, rosafarbene Fischschuppen, Sonnenstich und Regentakt, unregelmäßig auf Dächer schlagend, überquellende Rinnsäle, in den müllübersäten Erdboden gehackt, von Kakerlaken heimgesuchte Schnapsbars, deren Rum und Gin ähnlich schnell in den Kopf steigen, wie Nächte in die Abenddämmerung fallen. Das Chaos (aber was bedeutet “Chaos” anderes als mein eigenes Unverständnis in Anbetracht einer fremden Ordnung) benötigt wenige Farben, Gegenstände und Gerüche, um sich täglich neu zu erfinden. Spätnachmittags öffnen Fast Food Läden mit Namen wie “The Blood of Jesus” oder “Black Taliban”, Märkte werden geschlossen und in Säcken verstaute Waren auf Köpfe gehievt, einzig das Geschrei der Busfahrer bleibt als echoender Versuch, ihre Vehikel einmal noch vollzukriegen.
|||
2.
Eine in Accra angetroffene gebürtige Waliserin lädt mich in das Dorf Mpraeso ein, am Hochplateau Kwaho Tafu gelegen, wo sie gemeinsam mit ihrem ghanaischen Mann eine Hilfsorganisation betreibt. Beinah sämtliche Ausländer, die ich in Ghana treffe, sind im Auftrag einer NGO im Land, arbeiten als Englischlehrer oder heben zwei Monate lang im Hof einer Schule eine Klärgrube aus. Eine Reise nach Ghana offenbart Entwicklungshilfe als eigenwillige Art von Tourismus, deren Institutionen dem Kunden die Illusion verkaufen, dass sich mit einer Schaufel in der Hand Afrika auf westlichen Kurs bringen ließe. Um der Erfahrung einer fremden Kultur kurz entfliehen zu können, treffen sich die Mitarbeiter verschiedenster NGOs am Wochenende in Beachresorts, applaudieren den Folkloredarbietungen der dem Stereotyp des Wilden entsprechend halbnackten, mit Ketten und Bambusröcken behängten Tänzern und kiffen mit Rastafaris, die am Strand selbstgemachten Schmuck verkaufen. Während des Praktikums kann man zusätzlich in den Bau einer Toilette für ein Waisenhaus investieren. Als Belohnung gibt’s die Umarmung der Missbrauchsopfer, Straßenkinder, sowie das müde Lächeln des Direktors; später desinfiziert man sich die Hände, sicherheitshalber, um sich von den unzähligen Berührungen keinen Darmvirus einzufangen. Auf der Schreibtafel des Klassenzimmers, das zugleich als Speisesaal fungiert, steht in Kreide: Be strong / we are not here to play, to dream or to drift / we have a load to lift / shun is the struggle / but at gods will, it’s a gift.

Küste, westlich von Cape Coast, nahe der Grenze zu Cote d’ Ivoire
Einmal begleite ich zwei britische Hebammen, die für einige Wochen in einer hiesigen Klinik arbeiten, in ein Dorf des Ewe-Stammes am östlichen Ufer des Lake Voltas. Die beiden Frauen haben säckeweise Kinderkleidung mitgebracht, die NGO-Leiterin bereitet auf die Armut vor und beschwört uns, in Angesicht des Elends von Strohhütten und offenen Feuerstellen gefasst zu bleiben. Die etwa dreißig Kinder des Dorfes, die uns erwarten, müssen sich in einer Reihe aufstellen, ein Mitarbeiter der Organisation zwingt die schreienden, aufgeregten Kleinen unter Androhung von Stockschlägen zur Ruhe. Die Engländerinnen verteilen abwechselnd Kleidung und fotografieren sich gegenseitig, bis jedes Kind eine Jacke, einen Pullover oder eine Jeans in der Hand hält, sowie als Beweis der Gutherzigkeit genügend Fotos auf der Digicam vorzuweisen sind. Unweit einer polierten Kawasaki, 250ccm, stehen die adrett gekleideten Erwachsenen des Dorfes und beobachten uns.
Die wohlmeinenden Engländerinnen kommen zum Schluss, dass westliche Medien für die Berichterstattung aus Afrika keine Kriegs- oder Flüchtlingsopfer zeigen sollten, sondern die lachenden Kinder und deren Freude über Secondhandwaren. Am Dorfplatz, neben einem aus Tierschädeln, Vogelkrallen und leeren Patronenhülsen gefertigten Altar zu Ehren des Jagdgottes der Ewe, kauert sich die Gruppe schweißnasser Ausländer in den Schatten eines großen Baumes. Die Aufregung der Kinder verebbt, belustigt begutachten Mütter das verschenkte Gewand. Abseits verfolgen Jugendliche das Geschehen, sie tragen TShirts europäischer Fussballclubs wie Chelsea, Barcelona oder Bayern München. Einer von ihnen nähert sich übern sonnenverbrannten Platz und fragt, ob man neben den Jacken und Hosen auch einen Fußball mitgebracht habe.

Jagdfetisch der Ewe, Lake Volta
Zurück in Mpraeso zeigt eine der Hebammen kurze Mitschnitte einer Geburt, mit ihrem Smartphone aufgenommen. Darauf ist zu sehen, wie die ghanaische Krankenschwester eine Schere benützt, um die Vagina der Patientin mit einem Schnitt in den Oberschenkel zu erweitern und das Kind möglichst schnell herauszuholen. Das Video bricht ab, weil, so erzählt die Engländerin, sie die Schmerzensschreie der Frau nicht ausgehalten habe und auf den Gang geflohen sei. Ein Streitpunkt zwischen lokaler und angereister Hebamme, berichtet sie weiter, ist die Reinigung des Babies. Die Haut von Neugeborenen ist von einer weißlichen Schicht überzogen, die ihnen in Ghana sofort abgewaschen wird, zum Unwillen der Engländerin, derzufolge dieser Schutz mehr Zeit zum Einwirken bräuchte. Weiß, wirft die NGO-Leiterin ein, ist in Ghana die Farbe der Dämonen. Kindern in entlegenen Gebieten sitzt die Angst davor noch im Bewusstsein, weinend reagieren sie auf den Anblick bleicher Fremder.
Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation bringt mich zu einer Hütte am gegenüberliegenden Berghang; im Innenhof legt eine Frau den Holzstamm weg, mit dem sie Yamwurzeln zu Brei klopft, und holt den Schlüssel zu einer blauen Holztür. Ein Junge von acht Jahren stolpert über die Schwelle, reibt sich die Augen wegen der Helligkeit und umarmt ohne Wort oder Lächeln meinen Bekannten. Am Kopf des Jungen prangt eine fürchterliche Wunde, ein zur Seite geschobener, vernarbter Hautschwulst, der etwas vom Weiß des Schädelknochens freigibt. Ich erfahre, dass ihm Malaria das Hirn infizierte und er erst vor einer Woche halbtot im Graben entdeckt worden war, nahe des Marktes und der zusammengewürfelten Mischung der Hütten und Villen. Auf seinem Körper sind Narben früherer Verletzungen zu erkennen. Sein Vater ist vor einiger Zeit verschwunden, Abenya, die Mutter, erzählt, mit den epilleptischen Anfällen des Jungen nicht fertig zu werden, die sich von den Medikamenten, die unregelmäßig in der nächstgelegenen Stadt Nkawkaw aufzutreiben sind, nur schwer kontrollieren lassen.

Mpraeso, Markt
Eines Sonntagsfrüh habe ich dank Abenya Gelegenheit, einer Messe des African Faith beizuwohnen, einer Verbindung von evangelischem Glauben und Animismus. Ich hole sie ab, ihre Hände gleiten vom Bauch zu den Hüften und streichen das Baumwollkleid glatt; auf Zimmerwänden ist der Morgen in Schatten zu erkennen, als wäre man ins Innere eines Tieres geraten und sähe dessen unregelmäßigen Puls. Sie nähert sich ihrem Abbild, die Stirn berührt das Glas und zwei Finger streichen über die dunklen Spuren im Gesicht. Es sind eigenwillige Narben, mit einer Klingenspitze eingeritzte Zeichen, zwei davon schreiben ihr horizontal aufgeklafft die Stammeszugehörigkeit in die Wangen, die restlichen drei dienen als schmale Zeugnisse der Fehlgeburten; etwas wie Tränen bleibt unter den Augen, in schwarzen Furchen verwahrtes Totengedenken, als hätten die Toten ihr aus Spiegeln hervor das Gesicht zerkratzt. Es beginnt leicht zu regnen, Abenyas Mutter schlägt im Innenhof mit einer Machete eine Ananas auf, beide nicken sich zum Abschied zu. Die Finger ihrer linken Hand streichen über das abgesplitterte Holz der blau bemalten Tür. Kurz zögert Abenya und geht dann doch entschlossen weiter, weil sie Angst hat vorm Kind dahinter und dem weißen Mal auf dessen Stirn. Auf der Straße bleibt ihre heimliche Frage, ob sich mit dem heutigen Tag etwas ändern wird, unbeantwortet, wie hochgewürfelt in den Vogelflug, und im Morgendunst verschwinden Menschen, die allesamt in eine Richtung gehen.
Am Rand eines Dorfes des Kwahu Plateaus, wo neben Barackensiedlungen schmiedeeisern umzäunte, meist unbewohnte Villen von Geschäftsleuten aus Accra aufragen, findet die Zeremonie in einem großen, einräumigen Rohbau statt. Zwischen Maisfeldern ist die Gemeinde Wind, Regen und dem nahen Wald überlassen. Ein Mann Mitte Dreißig tritt zwischen die plaudernden, barfüßigen Menschen; gehüllt in ein weißes, weites Gewand und ein rotes, um die Hüften und die rechte Schulter geknotetes Tuch, schüttelt er begrüßend Hände, öffnet seinen silbernen Aktenkoffer und holt einen Plastikbehälter voller Sand und eine Flasche, angefüllt mit gelblicher Flüssigkeit, hervor. Man reicht ihm ein tragbares Mikrofon, es pfeift, seine Stimme knistert, fängt sich, behält ein Echo zurück, welches über den Köpfen der Gläubigen hallt. Während des Weges zur Messe erzählte Abenya, wie sie vor acht Jahren in einer Gebärstation auf einem orangen Plastikstuhl saß und ihre Beine mithilfe zweier Stützen gespreizt in der Luft hingen. Damals kam es ihr seltsam vor, dass es von ihrem Blickwinkel aus den Anschein hatte, als würde das Kreuz an der Wand gegenüber genau zwischen ihren Knien schweben. Am Kopfschütteln einer der in rosarote Uniformen gekleideten Schwestern erriet sie, dass in ihrem Fall an Medikamenten gespart wird, nur für die richtig harten Fälle holt man die Schmerzmittel aus dem Schrank, redete Abenya sich abseits der Wehen ein. Die Schwester schob ihr den Rock hoch, stellte eine Schüssel Wasser auf den Tisch. Ihre Augen glitten vom Kreuz zur Decke und gingen verloren, als die Hand der Hebamme die Schere ergriff. Als man ihr die Wunde vernähte, war das Neugeborene bereits gewaschen und ihrem Mann in die Arme gelegt worden.
|||
3.
Sturm schickt Schauer übern Himmel, angestaute Gewalten brechen auf, Trommeln werden geschlagen und im Klatschen, im Singen fallen Menschen in Trance, werden aus der Menge gezerrt, aus ihren Poren, Augen, Nasen flüchten Hexen oder Dämonen und verkriechen sich im Wald. Auf Tänzen wie Liedern reitet der Pastor, sein Gesicht glänzt vom Schweiß, inmitten von Wind und nassem Grün klaubt er aus der gelösten Masse von Leibern und Armen und Beinen die Ekstasen. Die Bartfäden Christi, die schweißigen, blutbefleckten, ragen aus den Wolken und Männer, Frauen, Kinder hängen gleich Marionetten daran, Trommelrhythmen wirken als Droge, die Messe fungiert als öffentlicher Schauprozess; der Wille Gottes findet in der Hand des Geistlichen ein Echo, glaubt man, der wirbelnde, Bäuche und Köpfe berührende, Dämonen verjagende Pastor drückt eine unwiderstehliche Begeisterung aus, die, denke ich mir, dem finalen Strich an einem Gemälde oder dem letzten Notenzeichen einer Komposition entspricht. Sein Gesicht wird während der Zeremonie zum Spiegel für die Gefühle, die er aus den klatschenden Menschen in den Regen scheucht, er lacht oder verzerrt den Mund, fordert verzweifelt, glücklich, losgelassen ein neues Lied, einen neuen Tanz.
Kwaho Tafu / Ghana / July 2012 from Ro Prosser on Vimeo.
Tanzt man mit oder trotz oder gegen die Trommeln, frage ich mich, als der Pastor mit seiner rückgekoppelten, hallenden Stimme die Flasche öffnet und die Sturmluft vom Geruch nach Amber gesättigt ist, als hätte man im hintersten Eck einer Kommode ein Parfüm entdeckt, das von der unvorstellbaren Jugend der Großmutter erzählt, so riecht dieses heilige Palm-Öl in seiner Hand. Abenya steht vor ihm, umgeben von den Zischsounds scheppernder Rasseln und fast berührt sein rechtes Ohr ihre Lippen. Er hört ihr Anliegen und spritzt Abenya zur Antwort Öl ins Gesicht, umkreist sie, als wäre es Spiel oder Jagd, spuckt auf ihren Rücken, den linken Fuß, nimmt aus der kleinen Schüssel rötlichen Sand und bald ist Abenyas schwarze Haut übersät von glänzenden Flecken. Sie spricht, andauernd und unverständlich, ihre Worte werden neue Flüsterquellen, die sich nach den Schritten und Rufen des Pastors richten, und nachdem sie sich über eine Stunde im Kreis gedreht hat, die Arme übern Kopf erhoben, nach dieser bedeutungslosen Zeit, wenn sich unter der Haut das Schreien und Singen als Muskelzittern fortspinnt, legt die Messe in Lied und Musik einen Takt an Verrücktheit zu.
Expulsion of a Witch, Kwahu Plateau, Ghana 2012 (Fragment) from Ro Prosser on Vimeo.
Monoton bewegen sich ihre Lippen, mit Fingerspitzen dreht er sie, lässt sie nicht aus den Augen. Er flüstert und flucht, lockt der Frau das Bewusstsein aus dem Kopf, rein ins Wirbeln der Trommeln, Rasseln und Körper. Ich sehe auf ihrem Gesicht ein paar Tränen oder Tropfen vom Öl, mit geschlossenen Augen kreist Abenya und zittert, einmal noch zischt der Pastor Jesus, zischt es und zwingt es dem Regen als lautes Echo auf, dem sie Folge leistet. Abenya kippt um und liegt, das Gesicht in den Armen vergraben, am Boden. Nur mehr ihre von Öl und Sand verschmierten Füße bewegen sich, ich spüre, dass sich zwischen meinen Lungen die widerspenstig verdichtete Atmosphäre eingenistet hat, euphorisch von Rhythmen geleitet, innerhalb der grauen Mauern, und das, was Abenya gerade über die Zunge hinab rinnt, muss vom Mund des Pastors kommen, ein Wort fast wie Stein, Jesus flüstert er wieder und schreit es zugleich, ein Wort, das weg getragen wird vom anschwellenden Lärm der Tanzenden, Trommelnden, sie nehmen sich Jesus und nageln ihn im treibenden Rhythmus an den Regen. Im Geruch nach Parfüm überkommt Abenya das Verlangen, aufzugeben, wie damals, als der Mann nach Nigeria gefahren und nicht wieder gekommen war; hüte dich vor Truckfahrern, hatte ihre Mutter gesagt, entweder lassen sie dich sitzen oder infizieren dich mit HIV. Im lautschlagenden, harttappenden Tosen der Musik wirkt es, als würden Öl und Sand schwer auf ihr lasten und durch die Haut sickern, im Anblick der zuckenden, gefallenen Frau frage ich mich, wo sie sich gerade befindet, vielleicht in einem winzigen Versteck im Kopf, aus Atemzügen, eins zwei, geschaffen, in der Dunkelheit kauernd gleich einem winzigen, weißen Schimmer.
|||
Hinweise :
-
Der Text ist in der Anthologie “Riots im gläsernen Käfig . Europäischer Frühling . Im Brennpunkt der Revolte” ( Edition Aramo 2012 ) als Dokumentation eines von Robert Prosser initiierten Autorensymposiums erschienen
-
Die Anthologie zum von mir initiierten Symposium “Europäischer Frühling” (20. – 21. März 2012, Unabhängiges Literaturhaus Niederösterreich), mit: Juri Andruchowytsch, Martin Fritz, Michal Hvorecky, Noémi Kiss, Lorenz Langenegger, Tanja Maljartschuk, Barbi Markovic, Sophie Reyer, Christoph Simon, Stefan Schmitzer, Anna Weidenholzer, Magda Woitzuck.
-
Robert Prosser jüngster Roman “Geister und Tattoos” ( Klever Verlag 2013 ) wurde bereits auf in|ad|ae|qu|at mit Fotos von Armenien und Berg- Karabach präsentiert
-
Heute wird das Buch in der Literatursendung von Radio Österreich 1 vorgestellt : Ex Libris , 5. 1. 2014 , 16 H
-
Am 22. 1. 2014 liest Robert Prosser aus “Geister und Tattoos” im Rahmen eines Leseabends mit Robert Prosser , Christoph Dolgan und Andreas Unterweger im Literarischen Quartier Alte Schmiede , 1010 Wien , Mittwoch , 22. 1. 2014 , 19 H
|||
Robert Prosser ( Bio – Bibliographie )
Bisher auf in|ad|ae|qu|at :
- STROM ( Auszug ) & Zwei Videos
- Anja Utler :“jeder Schritt ein Ausbruchsstadium”- Robert Prossers “verinnerlichte Halluzinationen” | espace d’essays |
- ORIGAMI ( text & video )
- Feuerwerk ( Prosa + audio )
- Framework zu der von Robert Prosser initiierten Tagung “Europäischer Frühling. Literatur im Brennpunkt der Revolte” ( ULNOE , März 2012 )
- Geister und Tattoos : Romanauszüge , Fotografien aus Berg-Karabach
|||