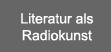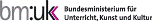In : NZZ , 25. 7. 2002
czz – Das Unzeitgemäss zeitgemäss und das Zeitgemässe unzeitgemäss zu zeigen: Wo der Architekt und Schriftsteller Bogdan Bogdanović seinen Stift ansetzt, öffnen sich die Räume der Gegenwart in Richtung auf Vergangenheit und Zukunft, wird Vermauertes durchsichtig und wird die so gewonnene Transparenz zur Bedingung der Möglichkeit von Transzendenz. 1922 in Belgrad geboren, hat sich Bogdanović früh mit allen und allem Sinnen dem Thema der Stadt zugewandt und deren Schicksal als Analytiker, Praktiker, Lehrer und – zwischen 1982 und 1986 – als Bürgermeister seiner Geburtsstadt verfolgt. Dabei ging es ihm stets um die Idee einer “Urbano-Logie”, die sich als “Urbano-Poetik” ( wenn nicht gar “Urbano-Erotik” ) dezidiert von jenem praktischen Urbanismus abzuheben sucht, welcher, das Denkbare als machbar voraussetzend, die Stadt und ihre Menschen als plan- und verwaltbar anzusehen pflegt.
Von einem “Glück in den Städten” – so der Titel des neuen, meisterlichen Buches – kann also nur bedingt die Rede sein. Umso mehr, als dieser ( nach dem 1997 erschienenen “Verdammten Baumeister” ) zweite Erinnerungsband im Grunde die erlebte Geschichte eines halben Jahrhunderts urbaner Zerstörung darstellt. Die Verwüstungen, welche Krieg und Wiederaufbau, totalitäre Geschichtstilgung und die forcierten Megalopolen der “Dritten Welt” angerichtet haben, einfach aufzuzählen, wäre wohlfeil. Ferne davon, es so recht und so billig zu geben, modelliert Bogdanović, statt zu katalogisieren, erzählt Bogdanović, statt aufzuzählen.
|||
JOHNNY WALKER UND DIE SPRACHE DER STADT
Als erfahrener Leser weiss dieser Autor, was man tun muss, um eine Stadt “sprechend” zu machen. Der Trick, den der junge Assistent in den fünfziger Jahren für sich selbst entwickelt und den er als Professor für Architektur an der Belgrader Universität mit seinen Studenten angewandt hat, nennt sich die “Johnny Walker-Methode“. Ausgehend von der Annahme, “dass man eine Stadt nur als Fussgänger richtig lesen kann”, empfiehlt Bogdanović, nach Kräften deren Pflaster zu treten.
Da dem physischen Sich-Ergehen das gedankliche auf dem Fusse folgt, öffnet sich die Stadt dem Peripatetiker nach poetischer und philosophischer Art. In Augenhöhe, nach Menschenmass, im Schrittempo ereignet sich “das poetische Wunder namens Stadt”. Durch solches Gehen, solches Schauen, solche Entzifferungsversuche am Palimpsest einer Stadt wächst eine erzählbare Geschichte.
Kunstvoll konstruiert der Textarchitekt seine Erzählung als mehrstimmiges Modell. Bilden die auktorial erzählten Erinnerungen aus beinahe sechzig Jahren Stadtbeobachtung und -reflexion das Rückgrat, so fügen sich einerseits Tagebuchzitate, zum andern die fast szenische Wiedergabe von Dialogen mit den Architekturstudenten als organische Gliedmassen an.
Derart zieht sich ein durchgehender Erzählstrang von des “armen B.B.” Tournee durch die europäischen Städte der unmittelbaren Nachkriegszeit bis hin zu den offizösen Visiten des späten Belgrader Bürgermeisters bei den Amtskollegen der “Bruderstaaten”. Darüber hinaus bieten die diaristischen Passagen, deren teils ironischer Selbstkommentar sowie die akademischen Wortgefechte zwischen Lehrer und Schülern dem Autor eine herrliche Bühne für seinen – wie er es selbst einmal genannt hat – Mono-Polylog.
|||
ABSCHREITUNGEN , AUFZEICHNUNGEN
Was aber erzählt uns dieser Lehrdichter und Stadtfeldforscher ? – Als methodischer “Johnny Walker” geht er frei vom Joche etwelcher “Objektivität” und kann uns – hier schreitend, dort tänzelnd – leichten Fusses auch in jene “unsichtbaren Städte” ( Italo Calvino ) führen, welche – als Metaphern, als Symbole, als Erinnerungen – um die realen und sichtbaren herum gelagert sind. Das können einzelne Zeichen sein: So der Obelisk von Washington oder die Cable Car in San Francisco. Das sind aber auch kleine oder grössere Szenen, Augen-Blicke und “Situations-Parabeln”.
In Basel etwa, der “alten Stadt an einem jungen Fluss”, welche Bogdanović Anfang der fünfziger Jahre zum ersten Mal besucht, ereignen sich während einer nächtlichen Stadtwanderung gleich drei Begegnungen mit dem nämlichen Paar: Eine schöne junge Frau, die einen Blinden führt. In Köln wird es ein Schuhputzer sein, welcher die Miene seines Kunden mit Hilfe eines Taschenspiegels kontrolliert und in Amsterdam ein kleines Mädchen, das – unter zustimmender Anteilnahme der Passanten – die am Rande des Kanals aufgestapelten Pakete Stück für Stück in den Wasserlauf wirft.
Wie das Mädchen, wie die Passanten, wie Bogdanović selbst werden auch wir nie erfahren, was in diesen Paketen eigentlich gewesen ist: Eben hier springt eine Türe auf zwischen dem So-Sein und der Möglichkeit, spazieren wir vom harten Boden der sogenannten Realität hinüber in den poetischen Hain der Hermeneutik und – wenn man so will – der Transzendenz. Dass hier nicht zwischen heller, poetisch erbaulicher und dunkler, teils magischer, teils melancholischer, Phantasie geschieden werden darf, versteht sich.
|||
ATLANTIS , TROIA , MANHATTAN
Wo sich Friedrich Weinbrenners klassizistische Sonnen-Planstadt Karlsruhe kurz nach dem Krieg als düstere Enttäuschung aller urbanistischen Ideale erweist, deutet sich früh ein wichtiges Motiv im Denken Bogdanovićs an: Neben den Momenten des Magischen und des Kosmologischen ist es das Bild vom Tod der Stadt, welches Bogdanović bereits zu Zeiten beschäftigt hat, ehe mit Alexander Mitscherlichs Befund über “Die Unwirtlichkeit unserer Städte” ( 1965 ) eine griffige Formel gefunden war. Über Platon und seine Dialoge führt der Weg nach Atlantis, der mythischen, ob ihrer Hybris dem Untergange geweihten Stadt der Städte. Atlantis, Troia, Manhattan: Allesamt Metropolen einer möglichen Archäologie.
“Manhattan aus der Luft”, hält der Autor in seinem Tagebuch fest:
Vor Augen habe ich noch den ( … ) Bericht von Dörpfeld aus dem Jahr 1894, der beschreibt, dass buchstäblich jeder Stein der troianischen Burg umgedreht und numeriert wurde… Ich frage mich, wie eine Archäologie der Zukunft aussehen könnte, die ebenso präzise die physische Masse der New Yorker Burg interpretierte.
Dreissig Jahre vor dem “11. September” erweist das Notat, dass “die Göttin der Geschichte nicht viel Phantasie” an den Tag legt und zum Wiederholungszwang neigt. So grausig wir als Zeitgenossen der realen Aufräumungs-Archäologie am “Ground Zero” das visionäre Ruinenbild Bogdan Bogdanovićs empfinden, so deutlich scheint auch dem Autor eine Art Tabubruch bewusst geworden zu sein: Einen lebendigen, pulsierenden Stadtkosmos als dereinst tot und ausgestorben zu denken, muss der Moderne, der das “Vanitas”-Motiv fremd geworden ist, naturgemäss als Überschreitung und Zerstörungsphantasie dünken.
Das unausweichliche Widerspiel von Aufbau und Zerstörung rückt an diesem Punkt in den Blick: Jede Konstruktion vernichtet Bestehendes und masst sich Raumherrschaft an. In diesem Bewusstsein bezeichnet sich Bogdanović selbst als “verdammten Baumeister” und richtet seine Argumente unablässig gegen die fortgesetzte Vernichtung von Geschichte durch technokratische Megalomanie. Als Platoniker besteht er darauf, dass jedes Er-finden ein Wiederfinden sei und dass auch Schauen, Denken und Bauen nur verschiedene Etappen eines Prozesses der Anagnoresis sind.
“Vom Glück in den Städten” wird auch zukünftig nur dort zu handeln sein, wo man ihnen – den Städten als auch ihren Menschen – Augenmerk schenkt. Bogdan Bogdanović, der am 20. August [ 2002 ] achtzig Jahre alt wird, ist Anwalt solcher Einsicht und Umsicht: Als Humanist, als Baumeister, als Lehrer und als Schriftsteller, weiterhin zeitgemäss unzeitgemäss.
-
Bogdan Bogdanović : Vom Glück in den Städten , Deutsch von Barbara Antkowiak – Zsolnay , Wien 2002
|||