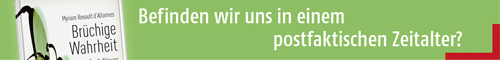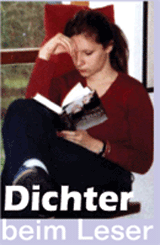30.1.-3.2.2017 – Timbuktu am Telefon
30.1.2017
Seit vielen Tagen sind heute zum ersten Mal keine Eisblumen gewachsen.
Sie fehlen mir. Die Fenster sind so leer. Nur leer.
In meiner Vorfreude auf den Tag mit „allen“ meinen Freunden hab ich mich manchmal dabei erwischt, wie ich mir schon die Nachfreude vorstellte. Nichts mehr tun müssen als dasitzen und zurückdenken, wie schön es war, dass so viele Freunde zu mir kommen.
Wieder mal getäuscht.
So hat Mutti doch Recht gehabt: Vorfreude ist die schönste Freude.
Heute sehe ich das auch so. Als Mutti es sagte, fand ich es gemein. Wenn nix ist, soll’s am schönsten sein?
Eben. Da hat die Wirklichkeit noch nicht zugeschlagen. Das hättest du so oder so oder so machen müssen, jedenfalls nicht so falsch. Größter Fehler: du lässt die Gäste den Stress fühlen, den du dir überflüssigerweise gemacht hast. Meine Tochter sagt es mir. Zu spät. Mal wieder.
Und doch: Es sind wieder so viele Freunde zu mir gekommen, die sagen: du hast so nette Freunde. So kann mein Leben nicht falsch gewesen sein.
Immer wieder bin ich gefragt worden, wie es mir geht.
Natürlich, das fragt man ja so, wenn man den anderen nicht gerade gestern gesehen hat.
„Gut“, sag ich, „danke, gut!“
„Und dein Knie?“
„Mein Knie?“ Ach so, da war was.
„Ja, auch gut.“
Der eine oder andere – vor allem der eine, der ein halbes Jahr jünger ist als ich und gar nicht gesund aussieht – schaut mich ungläubig bis verständnislos an?
„Ja, wirklich, gut.“ sag ich nochmal. Soll ich davon reden, wie ich das mache? Dispenza, Placebo und so? Ich entscheide für: heute nicht, und schlage vor, mich mal im Sommer allein zu besuchen.
Für mich selber aber denke ich, es ist ja nicht nur so, dass mir nichts weh tut. Nein, ich freue mich, dass ich etwas habe, zu dem ich zurückkehren kann, wenn alles wieder vorbei ist, und weitermachen. Immer weitermachen.
Wenn mir der gleiche Fehler, den ich gemacht habe, mit viel zu viel Kuchen ins Haus getragen wird, reagiere ich so zurückweisend, dass es mir gleich Leid tut. Möchte mich entschuldigen, vielleicht erklären, verstehen kann ich es erst heute: Ich will nicht, dass man so viel macht, weil man so wenig ist. Zu viel tun muss, weil man – immer noch – glaubt, dass man nicht genügt. Da rede ich von mir.
Es war der letzte schöne Wintertag.
Keine Wolke am Himmel und glitzernder trockener Schnee.
31.1.2017
So hat auch dieser Schnee keine Bleibe. (wieder geklaut, Freiburg, ungefähr 1982)
Der angesagte Regen ist eingetroffen.
Verschwunden die Wellen,
die perfekten Kurven ihrer Schatten.
es sieht aus, als stünden die Tannen im Nebel.
Seine eisigen Krallen sind müde.
Er ist lange geblieben und hat mir so viele Blumen geschenkt.
Ich bin ihm dankbar dafür und froh, dass ich sie habe bewahren können.
Es schlägt zwölf. In den Pfützen gerade nur einzelne Tropfen.
Ich gehe den Brunnen aufmachen und hole den Frostwächter heraus.
Trete auf die Eisränder und schubste die Brocken vom Holz.
Auf meinem Schulweg habe ich das im März oft gemacht. Um dem Frühling zu helfen.
Machen Kinder das heute auch noch so?
Ich überlege, wen ich fragen könnte.
Vielleicht haben sie es nie erleben können, weil so wenig Winter war in ihrer Zeit.
Jetzt – vor der Dämmerung – hängt ein Regenschleier vor dem Wald.
Es war sehr schwer zu gehen mit dem Hund. Kein Halt für die Schuhe, wo wir wochenlang den Schnee festgetreten haben. Da greifen nicht einmal Stöcke, sie rutschen einfach ab. Ich muss Wiesenstücke suchen, am Waldrand gehen, neben dem Bach, wo das Wasser über das Eis fließt.
1.2.2017
Die Welt wird wieder dunkler. In der Nacht und am Tag auch. Die weißen Flecken schrumpfen und schrumpfen. Nicht aufzuhalten wie unser Schneemann. Gestern verlor er den Kopf, heute die Brust. Er ist nur noch Bauch mit zwei kleinen Kugeln.
Aber ich kann das Fenster neben meinem Bett wieder aufmachen und spüre auch im Schlaf, wie die Luft sich bewegt.
Paul schickt – wie immer – Sätze an seine Freunde, die ihm wichtig sind. Heute habe ich dies gefunden:
Subject: Gedanken von Václav Havel
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht.
Hoffnung ist die Gewissheit, dass eine Sache Sinn macht, egal wie sie ausgeht.
Hier kommt natürlich sofort das auf den Prüfstand, was ich hier gerade mache. Wo gibt es Gewissheit?
Im Weitermachen, wo sonst.
2.2.2017
Ich hätte den Traum noch, wenn ich nicht aufgestanden wäre. Ich hätte ihn so gerne behalten. Er hat mir die Tür vor den Augen zugeschlagen. Jetzt weiß ich nur noch, dass da ein Traum gewesen sein muss, den ich gern behalten hätte.
Telefon. Die lange Nummer, vorne Mali, hinten Idrissa. Mein Tuaregfreund. Ich werde zurückrufen. Er könnte von dem, was ein Gespräch kostet, mit seiner Familie eine Woche lang leben.
Wir sprechen alle paar Monate miteinander, auch um diese Zeit, in der ich fast immer in Timbuktu war.
Als ich Timbuktu zum letzten Mal verließ, sagte er: vergiss uns nicht! Und ich antwortete: nein, ich vergesse euch nicht, versprochen. Seitdem schicke ich ihm in jedem Jahr soviel Geld, wie er verdienen würde, wenn ich da wäre.
Einmal rief er an, als ich gerade überlegte, ob und wann ich nach Timbuktu fliegen sollte, und ich entschied spontan: nächste Woche! Drei Minuten später wieder Telefon: ob ich nächste Woche oder nächstes Jahr gesagt habe? La semaine prochaine! Ich konnte seine Freude glucksen hören und kam in der nächsten Woche.
Aber ich habe ihn auch, als er später ein Handy hatte, nie angerufen, um ihm die genaue Ankunft zu sagen, weil ich darauf vertraute, ihn da wiederzufinden, wo er jeden Morgen ankam, zwischen den Dünen seinem Kamel die Füße zusammenband und sich neben dem Hotel Bouctou bei seinen Freunden in den Sand legte. Wenn ich kam, empfing er mich mit einer Geste, dass ich das auch tun sollte. Comme chez toi – wie zuhause – als ob ich das wollte. Aber das wollte ich: mich auf diese offene Erde setzen und dasein. Sonst nichts.
Er wartete auf Touristen, die mit Kamelen in die Wüste hinaus gehen wollten. Sie kamen aus dem Hotel, auf dessen Dach ich schlief, bis ich nach ein paar Jahren auf das Dach von Mamadou umzog. So haben wir uns kennen gelernt. Sein Chef, der reiche Tuareg, dem alle Kamele gehörten außer einem, hat uns Idrissa, dem armen, anvertraut, er sei der beste Kamelführer. Von da an bin ich jedes Jahr ein paar Tage mit ihm gegangen, habe eine Woche bei ihm gelebt, in dem von Schilfmatten begrenzten Halbrund, über dem der Himmel offen war. Ins Zelt wollte ich nicht, auch wenn sie meinten, da draußen sei es doch zu kalt. Den Tee am Morgen gab es nur im Zelt und die noch warme Milch der Ziege, die Idrissa gemolken hatte.
3.2.2017
Es war so gut, mit Idrissa zu sprechen. Schon sein glucksendes Lachen, wenn er mich erkennt und meinen Namen singt. Ja!
Und wie es gehe, die Gesundheit – ob ich laufen könne? Wie? Ach ja: vor fünf Jahren habe ich mein Sprunggelenk gebrochen, da konnte ich eine Weile nicht gut laufen. Aber jetzt geht es. Das will er immer wieder wissen. Und wie es meiner Tochter gehe…
Ich frage nach seiner Frau – sie hat immer diese Schmerzen im Knie, nimmt Tabletten, aber die helfen nicht viel. Alles, was ich dazu sagen könnte, wäre zynisch. So sage ich nichts. Und die Tochter? Sie ist jetzt 12 Jahre alt. Ich frage nicht mehr, ob sie in eine Schule geht. Das wollte Idrissa schon damals nicht, als wir in Techaq eine Schule errichtet haben. Da habe ich das Lehrergehalt bezahlt, bis das ganze Dorf wegen der Islamisten nach Burkina Faso floh. Idrissa ging nicht mit, sondern weiter hinaus in die Wüste. Inzwischen ist er in die Nähe von Goundam gezogen, das liegt am Fluss und kommt ihm weniger gefährlich als Timbuktu vor. Ich frage auch nach seinem Kamel, ja, das gibt es noch, aber es hat zu wenig zu fressen, Idrissa müsste Futter kaufen, das kostet … Auch den Ziegen fehlt es. Ich höre sie meckern. Es gibt zwei Junge in diesem Jahr, „eins für dich, eins für mich“ sagt er und lacht. Ich lache auch, freue mich. Dann haben sie ein paar Wochen die gute Milch am Morgen. Es wäre meine vierte oder fünfte Ziege. Wie alt werden Ziegen eigentlich? Ich habe die Neugeborenen so gerne im Arm gehalten und gestreichelt. Ein Zicklein fing an zu schnurren, da hat Ignet, Idrissas dritte Frau, aufgehorcht – was war das? Dann schüttelte sie den Kopf und lachte. Nein, sowas, diese Deutsche – Ob das Zicklein noch lebt?
Ich sage, dass ich wieder 100 € schicken werde; jetzt weiß ich, wer es am nötigsten braucht. Da jauchzt Idrissa wieder und sagt merci! Und immer wieder merci!
Wir verabschieden uns, ich sage: bis zum nächsten Mal! Idrissa: A la prochaine, inshallah! Natürlich: A la prochaine, inshallah!
Das war’s.
Ich schüttle den Kopf, staune, dass die Erinnerung noch immer so wirklich ist. Gut.
Inzwischen hat hier die Sonne mit dem Untergehen angefangen. Sundowner. Ich gehe ins Haus und suche eine Flasche Bier. Die nehme ich mit hinaus aufs Feld und trinke sie leer, bis die Sonne verschwunden ist. Sonst brauche ich zwei Abende für eine Flasche.
Ich sehe Idrissa auf einer Düne stehen, wie er die Wiederholtaste drückt.
Auf der Düne, wo er abends in einer Kuhle das Feuer machte, den Reis mit einem Stückchen Fleisch kochte und dann den Tee. Einmal sagte er: Ecoute! -??? – Rien! – Horch! – Nichts! Erst verstand ich nicht, dann aber doch: ich hatte immer wieder von der Stille gesprochen, die ich bei ihnen fand, wenn ich aus dem lauten Timbuktu kam.