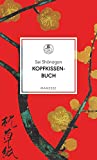Eintauchen in die japanische Kultur
Die erste vollständige deutsche Übersetzung des „Kopfkissenbuchs“ der Hofdame Sei Shōnagon ist ein Lesevergnügen
Von Tobias Schmidt
Nichts mehr als eine Neubewertung von Autorin und Werk möchte die erste vollständige deutsche Übersetzung des berühmten Kopfkissenbuches der Hofdame Sei Shōnagon sein und, so viel sei bereits verraten, sie wird diesem Anspruch voll und ganz gerecht. Mit einem ausführlichen Fußnotenapparat und einem prägnanten Nachwort nebst Glossar und umfangreichem Namensregister erlaubt die im Manesse Verlag erschienene Übersetzung von Michael Stein erstmals einen detaillierten wie durchaus humoristischen Einblick in das Leben am japanischen Kaiserhof am Ende des 10. Jahrhunderts. Diese erstmals 2015 in einer bibliophilen Ausgabe veröffentlichte Übersetzung löst jene von Mamoru Watanabe 1952 ebenfalls im Manesse Verlag erschienene unvollständige Ausgabe ab. Sie liegt nun in einer kompakten und günstigeren Ausgabe vor, die das Kopfkissenbuch hoffentlich einem breiteren Publikum zugänglich machen wird.
Sei Shōnagon kennen wir fast ausschließlich als jene Hofdame, als die sie in ihren Aufzeichnungen auftritt. Zwar ist bekannt, aus welchen familiären Verhältnissen sie stammte, mit wem sie verheiratet war und dass sie zwei Kinder hatte. Das literarische Talent und die dazugehörige Bildung erhielt sie von ihrem Vater, der zwar keine sehr hohe Position am Kaiserhof innehatte, aber als Dichter anerkannt und geschätzt war. Doch was ihr nach dem Ausscheiden aus dem Hofdienst widerfuhr, ist gänzlich unbekannt. Umso mehr beeindruckt es, welch starkes Bild der Leser von der Autorin erhält, das weder geschönt noch schonungslos erscheint, sondern zahlreiche individuelle Facetten zeigt.
So wenig über Sei Shōnagon bekannt ist, so korrupt scheint die Überlieferung ihres Werkes zu sein, das schon früh fremden Eingriffen und Hinzufügungen ausgesetzt war, denn wie sie selbst in ihrer kurzen Nachschrift sagt, wurden ihre Aufzeichnungen für einige Zeit entwendet und kursierten am Hof, wo sie sicherlich kopiert und teilweise auch ergänzt wurden. Den Großteil ihrer Aufzeichnungen verfasste Sei Shōnagon – so ist man sich in der Forschung sicher – innerhalb weniger Monate, die sie nicht am Hof, sondern in einer Art Urlaub bei Verwandten verbrachte. Daher kann vom Kopfkissenbuch auch nicht von einem Tagebuch gesprochen werden, genauso wenig wie von einer Chronik. Es ist im besten Sinne ein Erinnerungsbuch, das aber über das Individuum der Autorin auch hinausreicht und Themen von größerer Tragweite behandelt wie beispielsweise die Abläufe am Hof oder die Isolierung der Regierungskaste vom übrigen Volk. Viel ist ebenfalls zu erfahren über die ästhetische Wahrnehmung am kaiserlichen Hof mit seiner Begeisterung für jegliche Art poetischer Äußerungen, die in Wettbewerben zelebriert und in kunstvoll gestalteten Briefen gefeiert wurde und die in penibel aufeinander abgestimmten Farbkombinationen der Kleider nicht endete. Selbst kleinste Beobachtungen werden in einer poetisch-ästhetischen Betrachtungsweise zu berührenden Ereignissen, wie sie ihren bekanntesten Ausdruck in den auch bei uns beliebten Haiku finden.
Das Kopfkissenbuch der Hofdame Sei Shōnagon umfasst eine Fülle an literarischen Formen. Listen, Gedichte, kurze Erinnerungsstücke und essayistische Betrachtungen machen das Buch zu einem kurzweiligen Leseerlebnis, das viel über das Japan am Ende des 1. Jahrtausends lehrt, was sich freilich ohne den Anmerkungsapparat nicht von selbst erschließt. Doch das Blättern zu den Anmerkungen stört die Lektüre keineswegs, sondern bereichert sie. Bedenkt man, dass dieses Werk bereits 1.000 Jahre alt ist, erstaunt die abwechslungsreiche Darstellungsweise, das literarische Können von Sei Shōnagon und die Unbekümmertheit mancher Texte. Für eine Veröffentlichung waren diese Texte nie gedacht; sie sind dementsprechend kein plattes Herrscherlob, sondern genuiner Ausdruck einer Frau, die in der kaiserlichen Hierarchie keine hohe Position innehaben durfte, die aber gerade wegen ihrer spezifischen Rolle als Hofdame nah genug an Personen und Geschehnissen war, um ihren Erlebnissen mit literarischer Brillanz zu begegnen und diese darzustellen.
Dem Manesse Verlag muss dafür gedankt werden, dass er lange vergriffene Werke, nicht nur der japanischen Literatur, wieder zugänglich macht. So hatte er bereits 2014 Die Geschichte vom Prinzen Genji von Murasaki Shikibu neu aufgelegt, einer der ersten Romane der Weltliteratur. Und Shikibu, das lernen wir aus den Kommentaren des Kopfkissenbuches, war nicht nur eine Zeitgenossin Sei Shōnagons, sondern beide lebten einige Zeit gemeinsam am Hof des Kaisers, ohne sich je zu treffen. Eine Äußerung jener anderen berühmten japanischen Autorin zu den Aufzeichnungen Sei Shōnagons lautet bekanntlich: „Wie wäre es möglich, dass eine Person von derart oberflächlichem Empfinden am Ende etwas Sinnvolles zuwege bringt?“ Dass dies durchaus möglich ist, belegt das vorliegende Buch eindrücklich.
|
||