
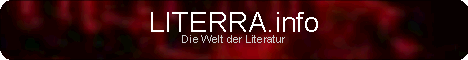
|
|
Startseite > Bücher > Historischer Roman > Verlagsgruppe Droemer Knaur > Tanja Kinkel > VENUSWURF > Leseproben > Venuswurf |
Venuswurf
| VENUSWURF
Tanja Kinkel Fester Einband, 496 Seiten |
Es war laut, das fiel ihr als Erstes auf. Ungeheuer laut. Zu Beginn ihrer Reise hatten die anderen miteinander geschwatzt, bis ihre Stimmen in Dunkelheit, Erschöpfung und Angst versickerten. Die Nacht war immer noch nicht vorbei, aber mittlerweile hörten sie von allen Seiten Geräusche. Von Rädern, die kein Loch und keinen Stein auf der Straße ausließen. Von Fuhrwerk um Fuhrwerk, das hinter ihnen, vor ihnen oder neben ihnen von Rindern, Eseln oder Menschen gezogen wurde. Flüche, Knirschen und Scharren, das sie nicht einordnen konnten. In ihren Dörfern hatte es selbst an Erntetagen nicht so viel Lärm gegeben, und ganz gewiss nicht in der Nacht.
»Heb mich hoch!«, forderte Tertia, nachdem sie sich vergeblich auf die Zehenspitzen gestellt hatte, um durch die Spalten des Verschlags zu spähen, und berührte den Mann, der an ihrer Seite kauerte, mit dem Ellbogen. »Wir müssen in der Stadt sein. Ich will die Stadt sehen!«
Selbst sitzend war er noch größer als sie. »Warum?«, fragte er dumpf. »Hast du es so eilig, verkauft zu werden?«
»Ich werde nicht verkauft«, sagte Tertia scharf. »Ich werde gerettet.«
Er schnaubte verächtlich und beachtete sie nicht weiter. Dafür äußerte sich die einzige andere Person, die aus dem gleichen Dorf wie Tertia stammte. »Du hast Glück, dass deine Eltern dich nicht schon längst losgeworden sind«, sagte Fausta verächtlich.
»Das sind nicht meine Eltern«, erwiderte Tertia in einem hohen Singsang. »Sie haben mich als Kind gefunden, wie Romulus und Remus. In Wirklichkeit bin ich die Tochter eines griechischen Königs, und er wird in der Stadt sein, um mich zu retten.« Ihre Geschichte hatte zu Beginn der Reise einige der anderen zum Lachen gebracht, aber mittlerweile nicht mehr.
»König der Missgeburten, meinst du wohl«, sagte Fausta. Dann versank sie wieder in dem gleichen dumpfen Schweigen, das der Rest der Gefangenen sich teilte.
Es roch nach Schweiß, nach Angst und Pisse, und trotz ihrer Aufregung spürte Tertia, wie ihr Magen sich zusammenkrampfte. Aber sie wusste auch, dass die anderen sie zwingen würden, in ihrem Erbrochenen zu sitzen, nicht einmal aus Bosheit, sondern weil sonst kein Platz in dem
engen Verschlag war. Der Händler hatte dafür gesorgt, dass sein Karren an allen Seiten von hohen Wänden begrenzt wurde, für den Fall, dass jemand an Flucht dachte. Es gab noch nicht einmal die Möglichkeit, den Kopf darüber in die frische Luft zu strecken. Also versuchte sie alles, um sich zu beherrschen. Und dabei auch einen Gedanken zu unterdrücken: dass sie sich ihr neues Leben anders vorgestellt hatte.
Inmitten von Lärm und Gestank zählte sie an den Fingern ihre wichtigsten Zahlen ab: Drei mal fünf, so alt war sie. Drei Kühe, die sich ihr Vater für das Geld kaufen konnte, das er für sie bekommen hatte. So viel Geld, wie sein Bruder in zwei Jahren in der Legion verdiente, hatte er zu Tertias Mutter gesagt. Auf eine dritte Drei brachte sie es nicht, denn sie war nur zwei Fuß und einen Spann hoch. Mit vier Jahren war sie nicht mehr weiter gewachsen. Tertia hatte sich schon
lange damit abgefunden, dass sie nie größer werden würde. Und sie wusste, dass Fausta Recht hatte: Es war ein Glück, dass man sie damals nicht einfach aussetzte. Ein Mädchen, das ein Zwerg war, konnte nur ein unnützer Esser bleiben, den nie jemand heiratete und der noch nicht einmal richtig auf dem Hof zupacken würde. Aber was Fausta nicht wusste, war, dass es keinen Grund gab, Tertia zu bedauern. O nein.
Das Mädchen presste die Finger ihrer linken Hand in den geöffneten Teller ihrer rechten, einmal, zweimal, dreimal, viermal, und hörte schließlich auf. Die Summe, die ihr Vater
erhalten hatte, überstieg den Preis der drei Kühe um ein Vielfaches; solche Zahlen hatte sie nie gelernt, weil in ihrer Familie nie jemand so viel von etwas besessen hatte. Ganz bestimmt brachte es ihre Eltern über den Winter, mindestens das. Und das war ein großes Glück. Es gab mehr und mehr freie Bauern, die ihre Schulden einfach nicht mehr begleichen konnten, vor allem, weil die Güter in der Umgebung mittlerweile fast alle reichen Leuten aus der Stadt gehörten, die Sklaven hatten, um sie zu bewirtschaften. Tertia, die klein genug war, um fast überall ein Versteck zu finden und all die Gespräche zu belauschen, die sie nicht hören sollte, verstand lange nicht, warum ihre Eltern nicht taten, was doch auf der Hand lag.
»Ziehen wir doch in die Stadt!«, platzte sie eines Tages heraus, als sie mit ihrer Mutter die Ziege melkte. Ihre Mutter wusste, dass sie nicht die nächste Ortschaft meinte. In Latium gab es nur eine Stadt, die wirklich zählte. Sie schaute Tertia mit großen Augen an und schwieg.
»Dort gibt es Getreidespenden für die Armen«, fuhr Tertia fort. »Jeder sagt das.«
»Dein Vater wird seinen Hof nie verlassen, sein Dinkelfeld, seine Erbsen und seinen Kohl«, stellte ihre Mutter traurig fest.
Tertia hielt das für dumm. Sie begriff nicht, was an dem Hof, der nichts als Arbeit und Hunger bedeutete, so besonders sein sollte. Vor allem, als der Vater schließlich ihre letzte Kuh und die letzte Ziege verkaufen musste und ihnen damit auch noch die Grundlage für Käse und Quark genommen wurde.
Im Dorf hatte es nur eine Person gegeben, die schon einmal in der Stadt gewesen war, die blinde Caeca. Vier Jahre nach Tertias Geburt war sie mit einem großen Wagenzug in die Gegend gekommen und zurückgelassen worden. Als ein Zeichen der Götter, wie die Frömmeren im Dorf meinten; weil die Herrschaft eine Dienerin nicht mehr ernähren wollte,
die ihr Augenlicht verloren hatte, sagten die Böswilligeren. Caeca selbst behauptete, eine Priesterin zu sein, und versuchte, sich nützlich zu machen, indem sie für jedermann Segenssprüche sprach und die Rituale durchführte. Die Älteren im Dorf hatten zunächst ihre Zweifel; gewiss, sagten sie, wäre eine Priesterin immer versorgt worden, doch konnte man sich bei Caeca wirklich sicher sein, dass sie dieses hohe Amt zu Recht einnahm? Caeca unternahm nie einen Versuch, sich zu rechtfertigen. Das taten bald andere für sie. Tertia vergaß nie, welchen Schutz eine Behauptung bot, die man nicht beweisen musste.
Ganz egal, was der Rest des Dorfes dachte, für Tertia war Caeca von Anfang an eine Heldin. In ihrer Kindheit hatte sie jedes Mal, wenn die anderen Kinder sie jagten, bei Caeca Unterschlupf gefunden, das erste Mal, als die Dorfbewohner noch nicht sicher waren, ob sie die blinde Frau durchfüttern sollten. Danach hatte Tertia ihren Vater bestürmt, und er hatte sich schließlich auf die Seite derer gestellt, die Caeca für ein Geschenk der Götter hielten, was diese Gruppe in die Lage versetzte, die andere zu überstimmen.
Caecas Geschichten von der märchenhaften Stadt waren unendlich besser und schöner als die alltägliche Plackerei. Getreide gab es dort umsonst, ein Geschenk des gütigen Augustus Caesar an die Armen, und nur prunkvolle Häuser aus Stein. In der Stadt gab es sogar andere Zwerge; Caeca schwor, dass sie früher, vor ihrer Erblindung, mit eigenen Augen eine Zwergin erblickt hatte. Die Menschen scherzten und lachten den ganzen Tag miteinander, statt sich gegenseitig anzugrunzen, niemand nannte einen anderen eine Missgeburt, und Wortwitz war mehr gefragt als Muskelkraft. Für Tertia, die bereits Übung darin hatte, sich mit Worten zu verteidigen, und nun zunehmend lernte, Caeca Dinge zu beschreiben, welche die alte Frau nicht sehen konnte, klang das mehr als erstrebenswert. Die Stadt wurde alles, wovon sie träumte, und nach Caecas Tod kam sie einer Besessenheit gleich. Tertia war bereit, alles zu tun, um dem Schweigen zu entkommen, in das sie seit dem Verlust der Freundin zurückgefallen war.
Es hatte eine Weile gedauert, bis es ihr bewusst wurde, aber Caeca hatte ihr mehr geschenkt als Geschichten. Tertia war sich allerdings nicht ganz sicher, ob dieses Geschenk gut oder schlecht für sie war: Caeca hatte eine andere Sprache gesprochen als die Leute im Dorf. Wenn man sich beim Brunnen oder auf den Feldern begegnete, dann war eine
Unterhaltung wie das einsame Zirpen einer Grille, mit nur wenigen, immer gleichen Tönen. In den Stunden aber, die sie mit Caeca verbracht hatte, waren die Worte geflogen wie das vielfältige, vielstimmige Summen eines ganzen Bienenschwarms. Und nun gab es niemanden mehr, der Caecas Sprache verstand, nicht im Dorf. Dort machte man sich sogar
über Tertias Sprechweise lustig, die sie von ihrer einzigen Freundin übernommen hatte, und sie musste sich Mühe geben, um wieder wie alle anderen zu klingen. In der Stadt
dagegen gab es nur solche Menschen wie Caeca, davon war sie überzeugt.
Sollte Fausta ruhig glauben, dass Tertias Eltern sie verkauft hatten, um den Hof behalten zu können, so wie es ihr selbst ergangen war. Tertia wusste es besser. Nach der schlechten Ernte des letzten Jahres, als sogar die Eicheln und Bucheckern nicht mehr genügten, um das Brot zu strecken, und sie stattdessen zu Lupinenkernen und Baumrinde greifen mussten, war die Stadt alles geworden, wovon Tertia sprach. Im Dorf gab es für sie keine Zukunft. Niemand heiratete eine Zwergin, und alleine konnte sie das Feld, das ihrem Vater gehörte, nicht bewirtschaften. Ihre Mutter musste dem Vater erzählt haben, wie Tertia sich nach der Stadt sehnte. Und er hatte einfach den besten Weg gefunden, um seiner Tochter diesen Wunsch zu erfüllen. Ihre Eltern liebten sie. Deswegen hatte der Vater sie verkauft. Nicht aus Missachtung, sondern aus Liebe.
Caeca hatte ihr prophezeit, dass sie in der Stadt ihr Glück fände. Und das malte Tertia sich aus, wieder und wieder, während die Räder des Fuhrwerks über Pflastersteine holperten,
die immer ebenmäßiger wurden. Im Übrigen konnte es wirklich sein, dass sie ein Findelkind war. Noch nie hatte es in der Familie einen Zwerg gegeben. Ein Zwerg zu sein war etwas Verachtenswertes, ein Unglück, das die anderen Dorfbewohner dazu brachte, Tertias Eltern zu bemitleiden oder sich lustig über sie zu machen. Tertia hatte ihre frühe Kindheit damit verbracht, sich ihres Daseins zu schämen. Erst Caecas Geschichten hatten ihr das Gefühl gegeben, etwas wert zu sein. So wie im Dorf war es nicht überall. Weit, weit weg gab es bestimmt ein Königreich, das nur von Zwergen bewohnt wurde, und es musste der Stadt tributpflichtig sein, denn das war die ganze Welt. Ein Gesandter konnte auf dem Weg dorthin … Sie versank in ihrer zweitliebsten Fantasie.
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info




