
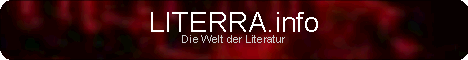
|
|
Startseite > Bücher > Düstere Phantastik > vph - Verlag Peter Hopf (Prints) > Gunter Arentzen > RECONQUISTA > Leseproben > Reconquista |
Reconquista
| RECONQUISTA
Gunter Arentzen vph - Verlag Peter Hopf (Prints) Jaqueline Berger: Band 2 |
<...> Professor Lacoste saß in seinem großen Zelt, vor sich eine Tasse mit Tee sowie ein Sandwich, und schaute durch eine große Lupe auf einen goldenen Ohrring. Gedämpft drangen die Geräusche des peruanischen Regenwaldes zu ihm hinein. Der Lärm, den die Wissenschaftler, Studenten und Ausgräber verursachten, übertönte das Gebrüll der Affen und Raubkatzen, die krächzenden Schreie der Vögel und das Summen zahlloser Insekten.
Lacoste schätzte, dass er gut und gerne zwanzig von seinen nun sechzig Lebensjahren in einem Zelt irgendwo in der Wildnis verbracht hatte. Zu Hause, in seinem behaglichen Haus in Südfrankreich, fühlte er sich unwohl. Die Ordnung, die Sauberkeit und das weiche Bett dort vermittelten ihm außerdem zunehmend das Gefühl, bald nicht mehr Teil eines Grabungsteams zu sein, zum alten Eisen zu gehören.
Ein durchaus berechtigter Gedanke. Er genoss die Spannung vor Ort und das Leben in der Natur, aber er war nicht mehr der junge Filou, der einst mit Pinsel und Schäufelchen zu graben begonnen hatte. Sein Herz und auch seine Lunge bereiteten ihm Probleme. Gewöhnte er sich keine ruhigere Lebensweise an, blieben ihm nur noch wenige Jahre. Andernfalls, so hatte ihm sein Arzt versichert, könne er noch zwanzig oder sogar dreißig Jahre leben.
Professor Lacoste wusste nur nicht, ob er dies auch wollte. Sein Leben gehörte seiner Arbeit, und die erledigte man seiner Meinung nach nicht von zu Hause aus.
In Gedanken versunken griff der Wissenschaftler nach seinem Tee. Dieser Ohrring faszinierte ihn. Er fragte sich, wie er hierher gelangt war. Der feine Goldüberzug sowie der verarbeitete Stein ließen keinen Zweifel zu: Dieses Schmuckstück passte nicht zu den Indios, die einst diese kleine Siedlung inmitten des Waldes bewohnt hatten – lange vor den Spaniern, aber nicht mehr lange danach.
Seine Gedanken wurden unterbrochen, als Loredana Ciampi das Zelt betrat, in der Hand ein Klemmbrett.
»Ah, Loredana«, rief Lacoste in akzentfreiem Italienisch, »komm näher und betrachte dir dieses Schmuckstück. Ich möchte wissen, ob du es datieren kannst.« Der Professor kannte die junge Wissenschaftlerin schon lange. Zwischen ihnen hatte sich ein gewisses Vertrauensverhältnis entwickelt, was sich auch darin zeigte, dass er sie duzte. Sie hingegen wäre nie auf den Gedanken gekommen, ihn bei seinem Vornamen zu nennen.
Die junge Archäologin kam dem Wunsch nach und schaute durch die Lupe. »Spätes zwanzigstes Jahrhundert, Modeschmuck. Er kommt aus Italien und wurde von einem Händler nahe dem Dogenpalast verkauft.«
»Eine derart exakte Bestimmung hätte ich mir nicht zugetraut. Wie kommst du darauf, dass der Ohrring in ... Oh, ich verstehe – er gehört dir, nicht wahr?«
»Ja.« Loredana nahm ihn entgegen. »Es spricht für die Gründlichkeit der Ausgräber, dass sie ihn gefunden haben.« Sie steckte das Schmuckstück in die enge Tasche ihrer Jeans.
»Du bist nicht gekommen, um deinen Ohrring zu suchen«, stellte Lacoste nach einem Blick auf das Klemmbrett fest, welches seine Assistentin noch immer in Händen hielt. »Was kann ich für dich tun?«
»Wir haben von der Barnard-Universität die Liste mit den Studentinnen bekommen, die sie uns schicken.«
Das Gesicht des Professors verfinsterte sich. Missmutig griff er nach seinem Sandwich und biss hinein. »Das hat uns gerade noch gefehlt. Eine Schar aufgeschreckter, unerfahrener Studentinnen, die einen Monat lang über die Ruine herfallen. Ich wünschte, wir könnten sie davon abhalten.«
»Ich weiß ...« Die Italienerin fühlte sich unwohl. Sie konnte sich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als sie eine aufgeschreckte, unerfahrene Studentin gewesen war. »Aber die Barnard finanziert unsere Studien zum Teil. Wir kommen nicht umhin, in den sauren Apfel zu beißen. Wobei dies noch nicht die sauerste Frucht ist, die uns die Universität zu schlucken gibt.«
»Was denn noch?«, fragte Lacoste. Er stopfte das Sandwich in seinen Mund und kaute übellaunig darauf herum. »Wollen Sie, dass wir ihnen unsere Funde aushändigen?«
»Nein.« Loredana nahm auf einem kleinen Faltstuhl Platz. »Sie schicken eine zusätzliche Gastdozentin hierher. Auf Wunsch eines Förderers, wie es heißt.«
Lacoste winkte ab. »Vermutlich eine Theoretikerin, die noch nie an einer Ausgrabung teilgenommen hat. Das ist nicht weiter schlimm.«
»Sie irren sich.« Die Stimme der Italienerin glich einem Flüstern. »Sie schicken Doktor Jaqueline Berger zu uns.«
»Nein!« Lacoste sprang derart heftig auf, dass sein Stuhl kippte. »Nein, das ... Wissen die denn nicht, wer sie ist? Wissen diese ... bornierten Amerikaner nicht, dass sie damit die vielleicht beste Schatzjägerin der Welt zu uns schicken? Wir können gar nicht so viele Wachmänner einstellen, wie vonnöten wären, um die Berger von unseren Funden fernzuhalten.«
»Der Leiter des Fachbereichs versicherte mir, Doktor Berger zu kennen. Seiner Meinung nach besteht kein Grund, ihr zu misstrauen. Offenbar hat sie sich von der Schatzjägerei losgesagt.«
»Merde!« Lacoste richtete seinen Stuhl wieder auf und nahm Platz. »Ich hatte gehofft, ihr niemals wieder über den Weg zu laufen. Sie ... Ich werde ihr nie verzeihen, dass sie mich damals bestohlen hat. Ich hielt den Dolch von Túpac Amaru bereits in meinen Händen. Und plötzlich ...«
»Ja ...« Loredana legte das Klemmbrett mit der Liste auf den Tisch. »Ich weiß, Professor. Nun, sie wird nur einen Monat hier sein und wir alle passen auf, dass sie nichts stiehlt.«
»So gut kann niemand aufpassen. Sie hat den Dolch vor meinen Augen verschwinden lassen. In dem einen Moment führen wir eine interessante Debatte, im nächsten Moment ist der Dolch verschwunden und im übernächsten Moment sie. Mir ist, als sei sie mit dem Teufel selbst im Bunde.« Lacoste reichte seiner Assistentin einen Schlüssel für die Truhe mit den wertvollsten Funden. »Hier. Nimm den Hubschrauber und fliege nach Lima. Bring die guten Stücke in Sicherheit. Miete ein Schließfach an, dort kommt auch sie nicht dran.«
»Wenn Sie meinen ...« Die Wissenschaftlerin zuckte mit den Schultern. »Ich weiß, wie Sie über Doktor Berger denken. Aber um ehrlich zu sein ... Ich freue mich ein wenig auf ihren Besuch hier. Sie ist zweifelsfrei eine interessante Person.«
Lacoste schüttelte anklagend den Kopf. »Interessant – vielleicht. Aber sie ist eine Schatzjägerin. Eine Diebin. Sie brach sogar in das Ägyptische Museum in Kairo ein, um ein Artefakt zu entwenden. Du musst vorsichtig sein, Loredana. Ich weiß, wie sie vorgeht. Besonders du wirst zu einem leichten Opfer werden, wenn sie es darauf anlegt.«
»Besonders ... oh!« Die Italienerin schwieg, denn sie wusste genau, was Lacoste meinte. »Keine Sorge, ich werde mich von ihr nicht einwickeln lassen. Also, ich mache mich dann mal auf den Weg.«
Lacoste schaute ihr nach. Warum ich? Warum kann die Berger nicht eine andere Ausgrabung heimsuchen? Ich sollte Urlaub nehmen.
Er schüttelte den Kopf, während er nach einem weiteren Schmuckstück griff, das ihm ein Ausgräber gebracht hatte. Anders als zuvor erkannte Lacoste sofort, dass es sich hierbei um ein Artefakt jenes Volkes handelte, das einst an dieser Stelle lebte. Das Amulett zeigte einen goldenen Gott in sitzender Haltung. Die Augen bestanden aus kleinen roten Edelsteinen, was dem Wesen einen stechenden Blick verlieh.
Was bist du für einer?, überlegte der Wissenschaftler. Ein Gott, den ich kenne? Oder bist du lediglich eine lokale Größe? Warst du für die Ernte zuständig oder ...?
Lacoste schaute auf, als einer der Arbeiter das Zelt betrat. Er kannte den Mann nur flüchtig. Er gehörte zu jenen, die für das Grobe zuständig waren. Ungelernte Helfer, die man zu Dutzenden in Lima oder anderen Städten anheuern konnte. Sie verlangten nicht viel Geld und konnten auch bei dem hier herrschenden Klima gut arbeiten.
»Ja?«, fragte Lacoste mit abweisender Stimme.
Er mochte es nicht, wenn diese Leute ungefragt zu ihm kamen. Hatte ein Arbeiter eine Frage, konnte er sich an die Archäologen wenden, die direkt mit den Grabungen befasst waren. Lohnfragen klärte ein Schreiber, der auch die Katalogisierung und anderen Papierkram übernahm. Streng genommen gab es für einen Arbeiter keinen Grund, das Zelt des Professors zu betreten. Vor allem nicht ungebeten.
»Dieser Anhänger«, erklärte der Mann in schlechtem Spanisch. »Darf ich sehen?«
»Bitte.« Lacoste hielt ihn so, dass der Arbeiter ihn erkennen konnte. »Kennen Sie das Wesen darauf?«
»Guecufu.« Der Arbeiter faltete die Hände und verneigte sich. »Guecufu. Ein Gott unseres Volkes. Er ist wieder da. Guecufu.«
»Danke für die Identifizierung.« Lacoste bemühte sich, sachlich zu bleiben. »Gehen Sie zu Doktor Lopéz und sagen Sie ihm, was es mit dem Gott auf sich hat.«
»Nein, Sie verstehen nicht.« Die Augen des Eingeborenen leuchteten. »Guecufu ist zu uns zurückgekehrt. Das Ende der weißen Besatzung ist nah. Wir werden das Land wieder in Besitz nehmen.«
»Ach herrjemine.« Lacoste bemühte sich, freundlich zu bleiben. »Sie werden nun das Zelt verlassen und mit Doktor Lopéz sprechen. Ich hingegen versuche, das eben Gesagte zu vergessen, Señor ...?«
»Julio. Aber Sie verstehen nicht. Das neue Zeitalter ist angebrochen und ich werde mein Volk zu neuem Stolz und zu neuer Stärke führen.« Er fixierte mit seinen Augen das Amulett, welches Lacoste noch immer hielt. »Guecufu, ich erflehe deine Hilfe.«
»Ja, und ich erflehe, dass Sie verschwinden. Und zwar ...« Der Professor hielt inne. Seltsame Vibrationen gingen von dem Amulett aus.
Fassungslos starrte der Wissenschaftler das Artefakt an. Er hatte den Eindruck, die roten Augen würden aus sich heraus leuchten.
Aber dies war unmöglich.
»Was ...?«, brachte er noch hervor, ehe das Amulett in seiner Hand einen einzelnen starken Energiestoß aussandte. Lacoste glaubte, seine Hand würde in Flammen stehen. Jeder Muskel in seinem Körper verkrampfte sich. Von einer Sekunde auf die andere stoppte jegliches Leben in dem Mann. Sein Herz stand still, sein Hirn arbeitete nicht mehr. Er kam nicht einmal mehr dazu, einen Schrei auszustoßen oder sich seines Schicksals bewusst zu werden.
Kraftlos sackte sein Arm nach unten. Sein Körper erschlaffte, sein Kopf sackte auf die Brust. Das Amulett fiel zu Boden.
Julio beeilte sich, es aufzuheben. Anschließend verließ er das Zelt wieder und eilte davon. Er wusste, dass er nicht im Lager bleiben durfte. Jemand würde den Tod des Professors bemerken. Zudem taten Wachleute Dienst, die hin und wieder die Taschen der Arbeiter kontrollierten.
Der Indio schlug sich in den Regenwald. Dort kannte er sich aus. Anders als die Weißen, die in das Land kamen, um die Gräber seiner Ahnen zu plündern, fühlte er sich zwischen den hohen Bäumen wohl.
Er musste zurück in die Stadt. Es gab andere, die dachten wie er. Jene, die sich der schon zu lange andauernden Herrschaft der Weißen entledigen wollten. Ehemalige Kämpfer der Túpac Amaru. Sie musste er finden, denn das neue Zeitalter war angebrochen.
<...>
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info




