
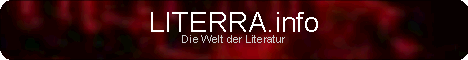
|
|
Startseite > Bücher > Dark Fantasy > Sieben Verlag > Tanya Carpenter > DÄMONENRING > Leseproben > Mein Wille geschehe |
Mein Wille geschehe
| DÄMONENRING
Tanya Carpenter Ruf des Blutes: Band 3 |
Hier auf der Plattform zwischen den Welten stand die Zeit still. Licht und Finsternis kämpften nicht länger um eine Vormachtstellung, sondern hatten beide verloren. Es herrschte der Zustand des Nichtseins. Weder laut noch leise, weder kalt noch heiß, weder dunkel noch hell.
Zwei Wesen trafen aufeinander, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Herrscher und Diener. Ein langer Umhang verhüllte den Körper der einen Gestalt, die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass man nicht erahnen konnte, was sich in ihren Tiefen verbarg. Die Haltung zeugte von Stolz und Selbstbewusstsein. Sie trug keine Waffen, was in diesen Gefilden leicht als Selbstmord galt. Doch ihr drohte keine Gefahr, dessen war sie sich bewusst. Auch wenn niemand wusste, wer sich da verbarg, die Essenz von Dunkelheit und Gefahr hielt selbst die tückischsten Dämonen davon ab, sich zu nähern und den Träger des Umhangs anzugreifen.
Unterwürfig kniete ein Wesen im Staub zu seinen Füßen, das um die Herkunft des Trägers wusste, weil dieser selbst es ihm gesagt hatte. Die Lippen der grotesken Kreatur waren gierig auf den Edelstein gepresst, der vom Blut im Silber des Ringes genährt wurde. Es war widerlich, doch nicht zu ändern. Ohne die Dienste eines Handlangers war der Plan aussichtslos.
„Bring mir die anderen. Und denke daran, es gibt nur einen Weg, wie du sie anlocken kannst. Die beiden anderen Träger. Lege den Köder und warte.“
Hastiges Nicken. Die Kreatur hatte verstanden. Noch einmal streiften ihre Blicke den Stein, dann stob sie davon.
Zeitgleich, noch viel tiefer in der Unterwelt, wo die Finsternis nur von lodernden Feuern unterbrochen wurde, ereignete sich etwas Ähnliches. Doch hier musste der Herrscher sich nicht verbergen und der Diener kniete nicht im Staub. Beide waren stolz und beide trauten einander nicht.
„Ihren Kopf!“, sagte der eine und beugte sich auf seinem Thron vor.
„Und die Ringe?“
Er winkte ab. „Deren Schicksal liegt nicht in meiner Hand. Es mag geschehen, was ihnen bestimmt ist. Sie finden ihren Weg allein. Bring mir nur ihren Kopf. Rechtzeitig, hörst du?“
Das Sirren von Metall durchschnitt die Luft, bläuliche Lippen pressten sich auf den Stahl, der seinem Träger treu ergeben war.
„Euer Befehl – seht ihn bereits als erledigt an.“
Mit einer Verbeugung entfernte sich der Schwertträger, um seine Aufgabe zu erfüllen. Der Herrscher, ein Fürst der Unterwelt, lehnte sich zurück und sah ihm nach. Hoffentlich schaffte der Kopfgeldjäger, Schlimmeres zu verhindern, ohne zuviel Aufsehen in der Welt der Menschen zu verursachen.
War es vorbestimmt, Fügung, dass einer der Ringe ausgerechnet in die Hände der Schicksalskriegerin fallen sollte? Sie hatte keine Ahnung, welche Macht sie in Händen hielt, wenn sie ihn erst auf ihren Finger steckte. Der Ring öffnete die Tore, er war der Schlüssel für den Weg, der zu ihm führte. Und zu ihm musste sie kommen, wenn die Zeit reif war, um ihre Bestimmung zu erfüllen. Ihn graute davor, denn was auch immer geschah, und wenngleich er nicht alles davon guthieß, es ging immerhin um sein Blut.
Aber vielleicht konnte der Söldner das Schicksal ein wenig verbiegen. Wenn er so gut war, wie es hieß.
Aas
London, Juni 2001
Ich wälzte mich unruhig hin und her, fiel immer wieder in kurzen Schlummer, doch wenn ich tiefer in die Sphären des Schlafes glitt, dann waren sie da, diese Bilder. Ein sich drehender Ring mit Runen, rot wie Blut die Zeichen. Tropfen fielen aus dem Rund. Sickerten in einen schwarzen Boden, fielen auf bleiche Wangen. Und über allem leuchteten gelbe Augen, während knochige Hände nach mir und dem Ring griffen.
Wieder einmal schrak ich hoch, kalter Schweiß auf meiner Haut. Mein Blick glitt gehetzt durch die kleine Kammer, aber nirgends waren diese Augen zu sehen. Sie lauerten nicht hier unten auf mich. Neben mir schlief Armand den tiefen Schlaf der Unsterblichen. Wie ich ihn beneidete, weil er nicht das zweite Gesicht hatte. Weil er verschont blieb von diesen Visionen, die fast immer nur Unheil ankündigten. In meinen Augen war es weitaus besser, unbelastet in die Zukunft zu leben und sich den Gefahren erst stellen zu müssen, wenn sie real wurden. Ich hingegen kämpfte mit den rätselhaften Bildern und zermarterte mir schon Wochen vorher das Hirn, was sie wohl bedeuteten und wie ich darauf reagieren sollte. Dabei kam es meist dann doch ganz anders, als ich dachte. Eine Ewigkeit schaute ich auf Armands friedliches Gesicht, fuhr die feinen Linien, die ein menschliches Auge schon nicht mehr wahrnehmen konnte, mit meinem Finger nach. Mein Herz zog sich beinah schmerzhaft zusammen vor Liebe. Wenn ich doch auch diesen Frieden hätte haben können, den er im Schlaf fand. Den er sogar die ganze Nacht hindurch mit sich durchs Leben zu tragen vermochte. Mir war dieser Friede verwehrt, meine Seele fand keine Ruhe, ganz gleich, wie lange ich Vampir war. Wenn es nicht die Zerrissenheit meiner menschlichen Seele war, die mich quälte, dann kamen diese prophetischen Träume.
Erschöpft sank ich schließlich wieder neben meinem Liebsten aufs Lager zurück, schloss die Augen und betete stumm, dass die Kraft der Sonne draußen auf den Straßen mir den ersehnten Schlaf bringen sollte, ohne Träume oder böse Vorahnungen.
Witternd hob er die Nase in den Wind. Die leichte Brise in Londons Straßen, trug den süßen Duft in die dunklen Tiefen seiner Kapuze, mit der er sein Gesicht vor den anderen Passanten verbarg. Wenn sie gewusst hätten, wer da ihren Weg kreuzte. Wenn sie einen Blick auf sein fremdartiges Antlitz hätten werfen können. Welch Schrecken hätte sich in ihren Herzen breit gemacht. Auch seine Hände verbarg er unter dicken ledernen Handschuhen. So war er nur ein gesichtsloser Niemand in den Straßen. Das Wissen um seine Existenz wäre eine unnötige Qual für ihre Seelen. Und er wollte keinen Unfrieden mit den Menschen.
Aber dieser Duft. Er musste ihm nachgehen. Das verlockende Aroma frischen, heißen Blutes, das über feuchtes Kopfsteinpflaster sickert. Warum ließ jemand einen Menschen auf diese Weise ausbluten? In einer dunklen Gasse. Ein Verbrechen, kein Zweifel. Grausig und mitleidlos. Er spitzte seine feinen Ohren, ob er wohl noch ein Stöhnen, irgendeinen Schmerzenslaut hören konnte. Doch die Nacht blieb still in dieser Hinsicht. Nur die üblichen Geräusche der Londoner City. Motorenlärm der Autos und Busse, Musik aus den Clubs, der Streit eines Ehepaares, irgendwo in einer Seitengasse hatte ein Pärchen hemmungslosen Sex. Der Duft von gebratenem Fleisch und gedünstetem Gemüse wehte von einem Nobelrestaurant herüber, doch er konnte den Geruch des Blutes nicht überdecken. Ihm lief das Wasser im Maul zusammen. Er war immer noch ein Lykantrop und liebte Menschenfleisch. Auch wenn er sich seit dem Pakt daran hielt, keine Menschen zu töten. Aber die Instinkte, die Gier blieben. Und warum nicht? Wenn es eine arme vergessene Seele war, tot und dahin? Man würde es den Straßenkötern zuschieben, wenn er ein paar hastige Bissen nahm. Und niemand würde es je erfahren.
Er war der Stelle jetzt ganz nah. Wie eine warme Hand streichelte die Süße des verrinnenden Lebenssaftes seine Nase, drang tief in seine Geruchsrezeptoren vor. Der Körper lag noch keine Stunde hier. So frisch waren noch die Spuren, die den Ort des Verbrechens umgaben. Er nahm die Essenz des Opfers auf, gleich gefolgt von der des Täters und …
Corelus stoppte mitten in der Bewegung, verharrte regungslos. Nur seine Nasenflügel bebten und sogen die merkwürdige Note tief in sich auf. Fremdartig, böse, ehrlos. Ein Knurren bildete sich in seiner Kehle. Mit steifen Bewegungen, der Körper in höchster Anspannung durch die Reize, die seine feinen Sinne überfluteten, näherte er sich dem Torso. Mit seinen ledernen Handschuhen hinterließ er keine Fingerabdrücke, als er die Leiche auf den Rücken drehte.
Entsetzt erkannte er das Gesicht, das beinah jeden Tag in lokalen Fernsehsendern und Zeitungen zu sehen war. Sir Reginald Duke of Woodward, Angehöriger des House of Lords. Und so wie es aussah, war er das Opfer eines Vampirs geworden.
Mit einen Gefühl innerer Einsamkeit schritt ich durch Londons Straßen. Leichter Nieselregen fiel, wie schon seit einigen Tagen. Er passte zu meiner Stimmung. Die schwermütige Aura, die mich umgab, ließ die Menschen instinktiv vor mir zurückweichen. Gleichmütig bahnte ich mir meinen Weg durch die Menge. Inmitten all dieser Menschen fühlte ich mich anonym. Ich bewegte mich unter jenen, zu denen ich gehört hatte, aber jetzt nie mehr gehören würde. Mein Schritte wurden langsamer, eine schwere Wehmut legte sich über mich. Düstere Melancholie, so gehasst und so geliebt, Teil meines Wesens.
Mein letzter Besuch auf der Isle of Dark, bei unserem großen Lord Lucien von Memphis, hatte viel verändert. Ich war menschlich geblieben, nach meiner Wandlung durch Armand. Hatte Mitleid gehabt mit den Menschen, selten getötet und um jeden getrauert, der meinen Hunger nicht nur mit seinem Blut, sondern auch mit seinem Leben stillte. Unschuldiges Blut. Lucien hatte mich mit einer List dazu gebracht, es zu trinken. Bei einem jungen Burschen hatte ich mich noch geweigert, doch als er mir einen Priester gebracht hatte, mit einer erfundenen Geschichte über dessen angebliche Lust an kleinen Messdienern, da hatte ich mich täuschen lassen. Erst im Trinken war es in mein Bewusstsein gesickert, dass der Mann ohne Schuld war, seine einzige Sünde darin bestand, dem Lord verfallen zu sein, wie jeder andere Mensch auch, der seinen Weg kreuzte. Lucien ist einfach unwiderstehlich. Die Macht des Vampirlords strömt aus jeder Pore, seine Schönheit ist unbeschreiblich. Nachtschwarzes Haar, Augen wie das Meer, aber vor allem versteht er sich auf List und Verführung. Er hat mir mit diesem Trick damals genommen, was mir das Wertvollste war. Trotzdem bin ich ihm nicht böse. Ich sehe es jetzt … vampirischer. Die Zeit in der ich an meiner Menschlichkeit festgehalten habe, ist vorüber. Jetzt akzeptiere ich mein Wesen mit allem was dazu gehört. Das Verführen und Umgarnen, das Töten. Nur meine Wahl treffe ich noch immer sorgsam. Versuche, auch weiterhin kein unschuldiges Blut zu trinken, obwohl es mich danach mehr dürstet, als nach allem anderen. Der dunkle Dämon in mir ist stärker geworden, beherrscht mich aber nicht. Dank Luciens Lehren, beherrsche ich ihn.
Franklin wartete heute Nacht in Gorlem Manor mit einem Gast auf mich. Ein Mann vom Security Service, mit dem ich zusammen in einigen mysteriösen Mordfällen ermitteln sollte. Darum war es besser, möglichst schnell zum Mutterhaus zu gehen, aber ich fühlte mich nicht bereit dazu. Tief in meinem Herzen war ich auf der Suche nach einem Opfer, das es wert war, mein Versprechen von Enthaltsamkeit zu brechen und mir mit seinem Blut Frieden bringen würde.
Die bunten Lichter und die Musik eines Rummelplatzes erregten meine Aufmerksamkeit. Trotz des ungemütlichen Wetters war er gut besucht. Engländer sind an dieses Wetter gewöhnt. Ein Kind rannte durch die Menge, stieß mit mir zusammen und fiel hin. Ich blickte hinab auf das kleine Mädchen, das staunend zu mir aufsah. Roch das Blut aus den aufgeschürften Händen, dem aufgeschlagenen Knie, sah die Tränen in den Augen schimmern. Teils aus Schmerz und teils aus Schreck über den Sturz, doch es weinte nicht, weil es wie gebannt war von meinem Blick. Ich merkte, wie ich das Netz um seinen Geist wob und konnte es nicht verhindern. Jugend, Unschuld, so süß und verlockend. Ich brauchte nur die Hand auszustrecken, es in meine Arme zu ziehen, meine Lippen auf die warme Kehle zu legen und … Doch ich rührte mich nicht, stand nur da und sah das Kind an, wusste wie sehnsüchtig und hungrig meine Augen in diesem Moment wirkten, und war dankbar, gerade so viel Kraft aufzubringen, dass ich es nicht zu meinem Opfer machte.
Es war zu jung. Zu grausam, es jetzt schon aus dem Leben zu reißen. Dann kam die Mutter, hob ihr Kleines hoch, schaute mich mit einer Mischung aus Ärger, weil ich nicht reagiert hatte, und unsicherer Verwunderung an. Eilig suchte sie mit dem Kind auf dem Arm das Weite. Mütter spüren instinktiv Gefahr, auch wenn sie sie nicht genau zuordnen können. Einen Augenblick lang sah ich den beiden nach, dann entfernte ich mich langsam vom bunten Treiben und verschwand wieder in den dunklen, stillen Seitengassen der City. Es war kalt für diese Jahreszeit, doch Kälte konnte mir nichts anhaben. Gerade jetzt fühlte ich mich kälter als das Eis des Winters. Hier, wo die Lichter erloschen und es dunkel wurde, senkte ich den Blick, damit meine wilden Augen mich nicht verrieten. Diese unmenschlichen Augen mit dem phosphoreszierenden Weiß und dem Raubtierglitzern in den Tiefen der Iris. Es erschreckte mich noch immer jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaute.
Den Mann hatte ich längst bemerkt, der hinter mir schritt. Er war mir vom Rummelplatz aus gefolgt. Leichtsinnig genug, einer scheinbar wehrlosen jungen Frau nachzuschleichen, ohne zu ahnen, dass sie sein Tod sein würde. Ich spürte meine Fangzähne schon, die sich nach dem heißen Fleisch und dem süßen Blut sehnten. Nicht so süß wie das des Kindes. Eher verdorben und dunkel. Genau das, was ich stets suchte. So sei es denn. Er hatte sein Schicksal selbst gewählt und ich war somit frei von Schuld.
Es ging schnell. Als die dunkle Gasse kam, war er neben mir, packte mich, zog mich in die Schatten. Ich roch seinen Schweiß, den Moschus-Geruch seiner Erregung, sein erigiertes Glied presste sich gegen meinen Hintern. Er drückte die kalte Schneide seines Messers an meinen Hals, ich fühlte wie sie meine Haut ritzte, ein dünner Streifen Blut an meiner Kehle hinabfloss. Blut, das meinen Hunger schlagartig erwachen ließ. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah, als seine Klinge zerbarst, meine kalten Finger wie eine Klauenhand seine Kehle zudrückten, er den Boden unter den Füßen verlor. Er sah die Reißzähne, die dämonischen Augen, doch sein Schrei verhallte ungehört. Sekunden später war er nur noch ein zuckendes Bündel in meiner tödlichen Umarmung. Während ich trank, suchte ich nach all den Abgründen, die seine Seele zu geben hatte. Morde, Vergewaltigungen, verscharrte Leichen, misshandelte Frauen. Diese Bestie in Menschengestalt. Ein Serienverbrecher weniger, um den die Polizei sich Gedanken machen musste. Dein Schicksal, mein Freund. Heute ist der Tag des Gerichts, und du bist schuldig. Als sein Herz stehen blieb, warf ich ihn von mir wie ein Stück Abfall, denn mehr war er nicht. Er war nichts wert, eine Seele so verdorben, dass selbst die Ratten vor dem Kadaver zurückwichen, den ich ihnen zu Füßen legte. Man würde ihn finden, morgen früh, und seine DNS vielen Verbrechen zuordnen können. Ich konnte relativ sicher sein, dass es keine allzu gründlichen Nachforschungen gab. Dennoch trat ich noch einmal zu ihm, durchsuchte seine Taschen, bis ich seine Geldbörse fand. Ich nahm nur das Bargeld, warf das lederne Etui auf ihn, beugte mich ein letztes Mal zu ihm und schlitzte mit meinem Daumennagel seine Kehle auf. Ein normaler Raubüberfall. Und diesmal hatte es keinen Unschuldigen getroffen.
Nun wurde es aber Zeit, Franklin wartete sicher schon auf mich. Ich erreichte Gorlem Manor in wenigen Augenblicken. Zögernd blieb ich draußen stehen, fühlte das Blut dieses Mörders noch heiß in meinen Adern brennen. Zu heiß. Benommen lehnte ich mich an die kühle Steinmauer der Hauswand, wartete darauf, dass mein Herz langsamer schlug und die Gier verlosch. Mein Vater erkannte den Unterschied, wenn ich gerade frisch getrunken hatte. Er akzeptierte inzwischen zwar, dass ich zu den Bluttrinkern gehörte, aber es gefiel ihm so wenig wie am ersten Tag. Ich versuchte daher, Rücksicht auf seine Gefühle zu nehmen. Es gelang mir nicht immer.
Der Sog wurde stärker, der verlockende Strudel, der kommt, wenn das Blut unseres Opfers uns erfüllt, seine Erinnerungen durch die Gedanken tanzen. Es ist das Ziel der Jagd, dieses Gefühl, wieder menschlich zu sein, weil man Menschlichkeit geraubt hat.
Ich ergab mich der Dunkelheit um mich herum, ließ sie Teil von mir werden, spürte, wie sich Frieden auf mich herabsenke, ein Frieden, der mich mit Liebe und Ruhe erfüllte. Ich war Teil von alledem, von Dunkelheit, Tod, und der Herrlichkeit der Nacht. Das Gefühl wurde stärker, wie jedes Mal, wenn das Blut eines Menschen mich mit neuem Leben erfüllt, bis ich mich endlich nicht mehr verloren fühle. Ein kurzer Moment des Glücks, der immer viel zu schnell wieder vergeht. Doch ich koste diese Augenblicke aus wie ein wertvolles Geschenk. Der einzige Frieden, der mir noch blieb, auch wenn er nicht echt ist. Nur eine Illusion, die die Jagd mir schenkt. Das, wofür wir alle leben.
Ich fasste mich schnell wieder. Heute war keine Zeit, sich zu verlieren. Ich hatte ja nicht mal jagen wollen, es war einfach passiert. Eigentlich hatte ich nur eine Weile Ruhe in den nächtlichen Gassen gesucht, ehe mich der Rummel mit den bunten Lichtern und würzigen Düften magisch angezogen hatte. Und dann war er da gewesen. Wie bedauerlich, und auch ärgerlich. Franklin würde nicht begeistert sein. Dem Fremden fiel es sicher nicht auf, er wusste nicht, was ich war.
Ich lauschte angestrengt. Mein Vater war im Kaminzimmer, sein Gast bereits bei ihm. Zeit für meinen Auftritt. Lautlos glitt ich zur Tür hinein und suchte John, damit er mich anmelden konnte.
Begegnung zwischen den Welten
Draußen vor den Fenstern fiel leichter Nieselregen, was das Kaminfeuer noch viel gemütlicher erscheinen ließ. London war nass und kalt in diesen Tagen. Kaum zu glauben, dass sie eigentlich Sommer hatten. Kein Mensch würde jetzt die Heizung aufdrehen, aus Prinzip nicht. Doch so ein Kaminfeuer … aber er war ja nicht hier, um die Behaglichkeit von Gorlem Manor zu genießen. Die Leute, die in diesem Anwesen lebten und sich selbst als PSI-Orden bezeichneten, waren ihm suspekt. Er war ein Agent der Regierung, der sich mit Tatsachen beschäftigte. Für diesen Hokuspokus, mit dem die hier ihre Zeit verschwendeten, hatte er kein Verständnis. Doch seine Vorgesetzten bestanden auf der Zusammenarbeit mit dem Orden. Sie schätzten Franklin Smithers, den Leiter dieses Mutterhauses, auch wenn sie ihm mit Vorsicht begegneten. Mutterhaus! Wie albern. Er fuhr sich mit der Hand durch die kurzen schwarzen Haare. Das war alles nicht seine Welt. Seiner Meinung nach konnten sie die seltsamen Vorfälle auch sehr gut alleine lösen. Wer brauchte schon diese PSI-Spinner?
„Für mich ist die Ashera nichts anderes, als eine weitere Sekte“, erklärte er daher unbeeindruckt.
„Nun, die Ashera ist keine Sekte, Mr. Forthys“, konterte Smithers säuerlich und schob sich seine Brille zurecht. „Wir erforschen und dokumentieren, was wir über die Welt des Unbekannten erfahren. Und jeder Einzelne ist der Gemeinschaft treu und loyal ergeben, bis zu seinem Tod. Aber wir haben keine Dogmen, wir unterziehen niemanden einer Gehirnwäsche, noch versuchen wir, das Individuum Mensch zu verändern. Und wir ziehen auch niemandem sein Vermögen aus der Tasche, indem wir ihn uns hörig machen. Die Ashera hat das nicht nötig. Jeder hier ist frei in seinem Glauben und weitestgehend auch in seinem Handeln.“
Ja, ja – weitestgehend, dachte er. Welch dehnbare Umschreibung. Aber er sprach es nicht aus.
„Wir nehmen das mit der persönlichen Freiheit sehr genau, Mr. Forthys“, sagte Smithers warnend, für einen Moment hatte Warren Forthys das ungute Gefühl, dass dieser Mann tatsächlich seine Gedanken las. Aber das war natürlich Unsinn. Oder etwa nicht? Die Ashera behauptete schließlich offen, über derlei Fähigkeiten zu verfügen.
„Wissen Sie, wir nehmen hier auch nicht jeden auf.“
„Also doch nur die, die es sich leisten können, wie?“, rutschte es ihm heraus. Er bereute seine vorlauten Worte sofort, doch Smithers lächelte nachsichtig.
„Ja, so könnte man das ausdrücken. Nur die, die es sich leisten können. Nur die, die es sich leisten können, sich den Gefahren des Unbekannten zu stellen. Die eine Chance haben, eine Begegnung mit den Kreaturen der Nacht und der Finsternis zu überleben. Denn nicht alles, was wir erforschen, ist so ungefährlich wie ein paar verblichene Knochen einer angeblichen Hexe oder die halb zerfallene Schriftrolle einer altägyptischen Tempelpriesterin.“
Warren fühlte sich unwohl bei diesen Worten. Das klang alles so unglaublich und doch hatte man nicht den Eindruck, dass Franklin Smithers log oder einem was vormachen wollte. Er glaubte, was er da sagte, erweckte dabei nicht im Mindesten den Eindruck, verrückt oder paranoid zu sein. Ganz im Gegenteil, er war eine starke, selbstbewusste Persönlichkeit, mit Autorität und ganz klaren Führungsqualitäten. Erfahren, intelligent, gebildet und, vermutlich zu Warrens Glück, auch geduldig und beherrscht. Er musterte den Mann genauer. Seine außergewöhnlich hellen, bernsteinfarbenen Augen blickten wach. Er ging angeblich auf die Fünfzig zu, sah aber viel jünger aus. Warren achtete ebenfalls auf seinen Körper, im Dienst für den Security Service musste man fit sein. Wenn er in Franklins Alter noch so gut in Form war, konnte er sich glücklich schätzen.
„Ohne Ihnen nahe treten zu wollen, Mr. Smithers“, sagte er jetzt etwas vorsichtiger, „auch wenn Sie sagen, Sie hätten keinen Glauben, den Sie Ihren Anhängern aufzwingen, so nennen Sie sich doch nach einer dieser heidnischen Göttinnen. Und Sie huldigen ihr auch, haben sogar eine Art Heiligenbild von ihr, nicht wahr? Warum das, wenn Sie doch behaupten, hier herrsche Religionsfreiheit?“
Ein warmes Lachen war die Antwort. Smithers ging zu einem Sideboard, nahm zwei Gläser und füllte sie aus einer Karaffe mit bernsteinfarbener Flüssigkeit. Er reichte Warren ein Glas und dieser sog das Aroma tief in seine Nase. Echter schottischer Hochlandwhisky. Vermutlich der beste, den er je zu trinken bekommen würde.
„Mr. Forthys, Sie wissen einfach erschreckend wenig über uns und unsere Arbeit, oder über unsere Ideale. Das ist bedauerlich, eigentlich sogar unverantwortlich, wenn man bedenkt, dass sie die nächsten Monate mit uns zusammenarbeiten sollen. Ihre Vorgesetzten wissen zwar ebenfalls nicht alles über uns, aber doch sehr viel mehr als sie Ihnen mitgeteilt haben. Man hätte Sie besser unterrichten sollen, was uns angeht, aber ich kann das ja gerne nachholen.“
Er nahm auf einem der bequemen Ledersessel Platz und wies auf einen zweiten. Warren nahm die Einladung an.
„Nun, sehen Sie, wir halten uns an gewisse Regeln der großen Erdreligion. Allerdings sind dies keine Regeln, wie die zehn Gebote der Christen. Es sind einfache Lehren, die jeder beachten sollte, der keinen Schaden anrichten will. Man kann sie an keine Glaubensrichtung binden, sie basieren auf gesundem Menschverstand. Die Erdreligion kennt den Gott und die Göttin in vielen Aspekten. Die Gründer des Ordens haben die Göttin Ashera als Beschützerin der Gemeinschaft gewählt. Und so wurde der Orden nach ihr benannt. Wir erwarten, dass man die Regeln beachtet und befolgt, so weit es möglich ist. Aber wir zwingen niemandem den alten Glauben auf. Wir haben in unseren Mutterhäusern Christen und Moslems. Buddhisten und Hindus. Juden und Heiden und sogar Atheisten. Und jede nur erdenkliche andere Religion. Das Einzige, das wir nicht tolerieren, sind die schwarzen Religionen. Die, die sich der Dunkelheit und dem Bösen verschrieben haben. Aber ansonsten ist uns völlig egal, unter welchem Namen jemand zur göttlichen Kraft betet. Oder ob er überhaupt zu einem Gott betet. Das ist das Entscheidende in unserer Gemeinschaft. Wir sind eine Einheit – ein Orden, wie man seit den ersten Tagen sagt, obwohl auch das ein dehnbarer Begriff sein dürfte, wenn man ihn auf uns anwendet. Aber wir sind ganz sicher keine Sekte.“
Warren blickte Smithers skeptisch an, sagte aber nichts mehr. Es konnte ihm im Grunde genommen auch egal sein. Ihm waren solche Organisationen, Sekte oder nicht, einfach unheimlich. Vor allem, wenn sie so viel Macht, Vermögen und Einfluss hatten wie die Ashera. Aber seine Vorgesetzten sahen das eben anders, und er war es gewohnt, deren Anordnung Folge zu leisten und einfach seinen Job zu tun. Die Ashera hatte schon häufiger die Arbeit des Security Service erfolgreich unterstützt, ihre Kooperationsbereitschaft brachte ihr das Wohlwollen der Führungsetage und des Königshauses ein. Warren hielt das für pure Berechnung, oder zumindest eine kluge Strategie. Wie auch immer, diese Tatsache hatte ihn jetzt hierher geführt. Ausgerechnet ihn, der eher mit Argwohn und Misstrauen auf diese Leute herabsah. Es war eine bittere Pille gewesen, als sein Boss ihm diesen Auftrag erteilte. Aber eine Ablehnung, wäre nicht gut für seine Karriere gewesen. Er wollte schließlich nicht ewig die Drecksarbeit machen, oder noch schlimmer, den Bürohengst spielen.
„Und wer ist nun der Mitarbeiter, der mir zur Seite stehen soll?“, fragte er, um das Thema zu wechseln und nahm einen kräftigen Schluck von dem Whisky. Mann, der war wirklich gut.
„Nun, meine Tochter Melissa. Unsere beste Mitarbeiterin, mit ausgezeichneten Drähten zur Gegenwelt.“
Warren musste lachen. „Mr. Smithers, der MI5 glaubt nicht an Ihre Geister, Werwölfe, Vampire oder was weiß ich. Und ich tue das ganz sicher auch nicht. Also hören Sie auf von dieser ‚Gegenwelt’ zu reden. Für mich existiert nur das, was ich sehen kann.“
„Dann sollte ich Sie wohl zumindest warnen, Mr. Forthys.“
„Warnen? Wovor? Vor Ihrem ganz privaten Hausgeist?“ Er nahm noch einen Schluck aus seinem Glas. Smithers lächelte nachsichtig.
„Nein, eher vor meiner Tochter. Wissen Sie, sie ist sozusagen nicht von dieser Welt.“
Sein Blick wurde verschwörerisch. Was sollte das schon wieder? War das ein Ashera-Insider-Witz oder was? Warren hatte jedenfalls keinen Sinn für solchen Humor und runzelte die Stirn. Smithers tat das mit einer Handbewegung ab.
Der Mann, der Warren schon am Tor willkommen geheißen hatte, obwohl man das nicht gerade als ein Willkommen hatte bezeichnen können, trat ein.
„Mel ist noch nicht zurück, Franklin. Offenbar …“ Er zögerte auszusprechen, was er dachte. Warren erkannte, dass der Grund seine Gegenwart war. Man sah diesem Typen an, dass er überlegte, wie er es am besten umschreiben sollte. „Also“, meinte er schließlich seufzend, „sagen wir einfach, es dauert heute wohl etwas länger.“
Smithers nickte und seufzte ebenfalls leise, es klang fast resignierend. Doch ansonsten schien es ihm nicht besonders viel auszumachen, dass seine Mitarbeiterin, pardon – seine Tochter, sich verspätete. Hieß es nicht, Disziplin sei der Ashera so wichtig? Warren konnte ein zynischen Grinsen nicht unterdrücken. Blut war also auch hier dicker als Wasser.
„Gut, John, dann bring Melissa bitte zu uns, sobald sie wieder da ist.“
„Warum ist Ihre Tochter eigentlich nicht hier? Ich dachte, Sie hätten den Termin extra wegen ihr auf diese späte Uhrzeit gelegt.“ Er blickte auf seine goldene Rolex. Ein Imitat, aber das wusste ja keiner. Warren war stolz darauf. Viertel nach zwölf, mitten in der Nacht. Wenn die schon Termine um solch eine Uhrzeit machten, dann sollten sie wenigstens pünktlich sein.
„Sie wird gleich da sein. Aber sie hatte vorher noch etwas zu erledigen.“
Seltsame Leute, diese PSI-Spinner, dachte er zum zweiten Mal an diesem Abend. Der Blick seines Gastgebers ließ ihn schaudern. Wieder hatte er das Gefühl, dass Smithers seine Gedanken las? Der Butler, oder was immer er war, erschien kurz darauf wieder in der Tür.
„Miss Melissa ist zurück“, verkündete er steif, mit einem abschätzigen Blick auf Warren und verschwand sofort wieder.
„Nettes Personal haben Sie, Mr. Smithers.“
„Oh, wir haben kein Personal. Aber jeder in der Familie hat seine Aufgaben. John ist sozusagen unser Empfangskomitee. Und meine rechte Hand.“
Er wollte etwas erwidern, von wegen, er solle das ‚Empfangskomitee’ vielleicht mal ein bisschen auf Höflichkeit trainieren, kam aber nicht mehr dazu, denn die Tür flog abermals auf und eine junge Frau trat ein. Oder besser gesagt, sie schwebte herein. Jedenfalls bewegte sie sich mit einer Anmut, dass Warren für einen Moment die Luft weg blieb. ‚Nicht von dieser Welt’. Er musste an Franklins Worte seine Tochter betreffend denken und konnte dem nur zustimmen. Groß, schlank, mit feinen Gliedern. Smaragdgrüne Augen in einem ebenmäßigen, bleichen Gesicht. Die Blässe wurde noch durch schwarze Kleidung betont. Flammendrotes Haar fiel lose über ihre Schultern bis fast zur Taille hinab. Warren fühlte, wie sein Pulsschlag sich beschleunigte. Franklin stand auf und eilte ihr entgegen, sie umarmten sich liebevoll. Beinahe zu liebevoll für Vater und Tochter. Langsam erhob sich auch Warren von seinem Platz und schritt auf die beiden zu. Die junge Frau reichte ihm ihre Hand, ganz kalt, wahrscheinlich weil sie von draußen kam. Regentropfen glitzerten noch auf ihrem schwarzen Ledermantel und in ihrem Haar. Sie war schlicht atemberaubend, nach so einer würde er sich auf der Straße umdrehen. Und nicht nur das.
„Melissa“, erhob Smithers seine Stimme. „Darf ich dir Mr. Warren Forthys vorstellen? Er ist Mitarbeiter einer Spezialabteilung des MI5. Seine Abteilung wurde mit der Klärung einiger aktueller Todesfälle beauftragt. Todesfälle in den Reihen des House of Lords. Da die Ashera zum Tatort des letzten Opfers hinzugezogen wurde und wir den Duke of Woodward gerade in unserer Pathologie liegen haben, ist der MI5 an uns herangetreten, mit dem Anliegen einer Zusammenarbeit, um all diese mysteriösen Morde aufzuklären. Schnell und unauffällig.“
Die fein geschwungenen Augenbrauen der Frau hoben sich fragend. Ihre Lippen öffneten sich leicht und Warren sah etwas schimmern, das ihn für einen Moment irritierte. Doch dann war es wieder weg. Smithers nickte seiner Tochter mit undurchschaubarem Blick zu, offensichtlich sollte er diese Geste nicht sehen, doch er bemerkte es aus den Augenwinkeln.
„Ich habe Mr. Forthys bereits auf die Möglichkeit von“, Smithers zögerte einen Augenblick, „mystischen Wesen hingewiesen. Aber natürlich lehnt der Security Service deren Existenz nach wie vor kategorisch ab, wie du ja weißt. Und das obwohl wir so viele bereits belegen konnten.“
Die letzte Bemerkung hatte etwas ungehalten geklungen. Aber natürlich, die Ashera beschäftigte sich ja ausschließlich mit übersinnlichen Vorkommnissen. Ihre Daseinsberechtigung wäre gefährdet, wenn man die Unsinnigkeit ihrer Arbeit nachweisen könnte. Warren überhörte daher den Ton in Smithers Stimme. Obwohl er sich tatsächlich fragte, warum es diese Gemeinschaft schon so lange gab und die Regierungen der Welt sie so anstandslos duldeten. Er fühlte sich zusehends unbehaglicher, weil er mit diesen Leuten zusammenarbeiten sollte, doch ihm blieb keine Wahl, ebenso wenig wie der Ashera.
„Der MI5 glaubt, dass es sich um einen Serientäter handelt“, erläuterte Smithers weiter.
„Aha.“ Ihre Stimme war glockenhell. „Und welche Rolle haben sie der Ashera zugedacht? Zeuge oder Angeklagter?“
Die Art, wie sie sprach, ein wenig zynisch, ihre selbstbewusste stolze Haltung und ihre grünen Augen, die in seine Seele zu blicken schienen, verunsicherten Warren. Er lachte nervös, einen Moment senkte er seinen Blick, der dabei auf eine dünne Silberkette fiel, die sie um den Hals trug. Der Anhänger daran war ein fein gearbeitetes Pentagramm mit einem Kreis drum herum. Eine zweite Silberkette sowie eine Goldene lagen darunter, doch deren Anhänger verschwanden in ihrem Ausschnitt. Er spürte, wie sie ihn beobachtete und auf eine Antwort wartete. Beschämt, dass er sie so unverhohlen angestarrt hatte, und dann auch noch auf ihren Busen, hüstelte er.
„Nun, das kommt wohl ganz darauf an, wie kooperativ die Ashera in diesem Fall ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber der Orden ist schließlich schon öfter mit der Justiz aneinandergeraten. Er wird weltweit geduldet und natürlich auch respektiert. Aber gewissen Leuten ist er doch suspekt. Wenn der MI5 keine Hilfe erhält, könnte es unter Umständen Probleme für Sie geben.“
Sie schaute ihn mit einem seltsamen Lächeln und einem Glitzern in den Augen an. So als wolle sie sagen: ‚Ja, und dir sind wir auch suspekt, nicht wahr?’ Sein Herz setzte einen Schlag aus vor Furcht. Sie legte ihren Kopf schief, in ihren Augen funkelte es schelmisch.
„Sollte das etwa eine Drohung sein?“ Wieder blitzte etwas auf, das er nicht einordnen konnte.
„Das nicht, ich meinte nur …“
„Gut. Denn wenn Sie drohen wollen, Mr. Forthys, dann sollten Sie dies mit etwas weniger Angst in Ihrem Herzen tun.“
Ihre Stimme klang sanft, wie die einer Mutter, ihre Worte waren es keineswegs. Damit drehte sie sich um und verließ den Raum. Warren stieß die Luft aus.
„Ich hatte Sie ja gewarnt, Mr. Forthys“, hörte er Smithers hinter sich sagen. „Sie ist vermutlich die beste Hilfe, die ich Ihnen geben kann. Aber Sie sollten vorsichtig sein. Melissa ist anders. Und ich fürchte, dass auch sie Ihnen keinen menschlichen Mörder liefern kann.“
Warren schluckte hart. Wie sollte er das alles nur verstehen?
Spuren in der Dunkelheit
Nachdem Warren Forthys sich höflich verabschiedet hatte und gegangen war, kam ich wieder ins Kaminzimmer zurück. Meine Gefühle ihn betreffend waren gemischt. Ich mochte seine arrogante, engstirnige Art auf Anhieb nicht. Aber er sah verdammt gut aus. Wie es schien, hatte der Security Service tatsächlich James Bond im Angebot. Ach nein, der war ja MI6. Aber trotzdem, durchtrainiert und braungebrannt, ein echter Frauenverführer vermutlich. Ich würde ihn mal fragen müssen, ob er seinen Martini gerührt oder geschüttelt trank. Auf schwarze Haare stand ich, auch wenn ich die längere Variante bevorzugte, statt des akkuraten Kurzhaarschnitts, der wohl im Office gefordert wurde. Aber es war ja ohnehin nur eine vorübergehende Aufgabe und vermutlich würde sie mir mein Leben eher schwerer, als leichter machen. Mit einem vielsagenden Blick zu meinem Vater ging ich zum Kamin hinüber. Genüsslich nahm ich in einem der bequemen Ledersessel Platz und streckte meine Beine aus.
„Musste das wirklich sein?“, fragte er, klang aber keineswegs böse.
„Was?“ Ich zog es vor, die Unschuldige zu spielen, was ihn lachen ließ.
„Dass du seine Gedanken gelesen hast. Wir haben diese Fähigkeit zwar, aber du weißt, dass sie mit Bedacht einzusetzen ist. Vor allem mit Respekt.“
„Wer im Glashaus sitzt, Dad“, antwortete ich zwinkernd und er grinste mich schuldbewusst an.
„Du hast ja Recht. Mit der überheblichen Art des Superagenten hat er einen doch sehr in Versuchung geführt.“
Wir machten beide eine schuldbewusste Miene. Es war sonst wirklich nicht unsere Art. Aber hier hatten wir nicht widerstehen können.
„Ich werde mich bemühen, es während der Zusammenarbeit mit ihm zu unterlassen“, versprach ich.
„Danke. Das ist sehr nett von dir.“
Franklin betrachtete mich versonnen, als ich meine Beine übereinander schlug und mich ins weiche Lederpolster kuschelte. Ich wusste, was er sah. Die Wandlung hatte mich schöner gemacht. Meine Wirkung auf Sterbliche war magisch. Das verstärkte sich mit jedem Jahr. Und vor allem mit jedem Trunk vom mächtigen Blut meines Lords – Lucien. In den Augen meines Vaters geschah dies viel zu oft. Im Moment war er daher froh, dass ich mich in London befand. Weit fort von Miami und der Isle of Dark – Luciens Reich. Ich war kurz nach meiner Wandlung für einige Monate dort gewesen, um mich den Lehren des Lords zu unterziehen. Das hatte mir Sicherheit gegeben, mich stark genug gemacht für die Unsterblichkeit. Es hatte mich innerlich wie äußerlich verändert. Doch die drastischste Veränderung hatte eben jenes Ereignis mit dem Blut des unschuldigen Priesters bewirkt. Mein Vater wusste nichts davon, durfte es auch nie erfahren. Das hätte er nicht ertragen.
Was er sah, waren nur die äußerlichen Veränderungen. Meine helle Haut war jetzt fast durchscheinend blass. Ein starker Kontrast du den roten, sinnlichen Lippen. Die Glieder waren noch feiner und katzenhafter geworden. Meine Augen, so leuchtend grün und von einer Tiefe, dass es mich manchmal selbst im Spiegel erschreckte. Der schwarze Kohlestift betonte sie noch mehr. Etwas, das ich mir von Lucien abgeschaut hatte und ganz bewusst nutzte. Früher war mir Schminken eher lästig und überflüssig erschienen, aber heute wusste ich den ein oder anderen Trick zu nutzen, der mich einerseits menschlicher machte, andererseits meine übersinnliche Ausstrahlung unterstrich. Ausgefeilte Tarnung, so Luciens Lehren, war unser größter Vorteil bei der Jagd. Er war ein fünftausend Jahre alter Vampir aus Ägypten. Ich ertrank jedes Mal in seinen wundervollen nachtblauen Augen, liebte es, wie deren Tiefe durch die kunstvolle Umrahmung nach altägyptischer Art noch hervorgehoben wurde, so dass sie wirkten, wie ein sternenübersäter Nachthimmel oder das weite, dunkle Meer. Meine Augen wirkten mit den schwarzen Kohlestrichen wie geschliffene Smaragde. Franklin liebte meine Augen. Manchmal verlor er sich so tief darin, dass er mit dem Gedanken spielte, wie es wohl sein würde, wenn wir doch die Grenze überschritten, die wir niemals überschreiten wollten. Der Reiz war immer da, und Schuld daran trug allein der Dämon, der in uns beiden lauerte. In mir sowieso, weil ich bereits verwandelt war. Und in ihm vom kleinen Trunk, den er so viele Male schon von Armand empfangen hatte. Ein wenig vom Dämon sickerte auch damit schon in den Menschen hinein, ohne die Wandlung.
Verlegen räusperten wir uns beide. Wir hatten an dasselbe gedacht. Es stand uns deutlich ins Gesicht geschrieben.
„Hältst du es nicht auch für übertrieben, dass der MI5 sich mit diesen Mordfällen beschäftigt?“, bemerkte ich beiläufig.
Franklin war dankbar, dass ich das Thema erst gar nicht aufgriff und trat lächelnd hinter meinen Sessel, stützte sich auf die Kopflehne, um mich von oben zu betrachten. Ich musste meinen Kopf in den Nacken legen, um ihn anzusehen. Fast ohne mein bewusstes Zutun, legte sich wieder jenes geheimnisvolle Glitzern in meinen Blick, das in meinem Vater eine vertraute, aber nicht gerade beliebte Unruhe weckte. Er runzelte die Stirn. Verdammt!, dachte er, als er bemerkte, dass ich den Gedankengang von eben doch noch nicht ganz hatte fallen lassen.
„Mel, bitte. Nicht heute. Ich habe genug Sorgen.“
Ich ließ seinen Blick los und zuckte die Achseln. „Vielleicht würde es dich ja von diesen Sorgen ablenken.“ Er antwortete nicht. „Also warum interessiert sich der MI5 für diese Morde?“, fragte ich schließlich seufzend und verwarf den Gedanken, Franklin zu verführen für heute endgültig. Ich würde es ohnehin nie tun. Und er würde es auch nie dulden. Aber dann und wann spielten wir wohl beide mit dem Gedanken, da das Vampirblut in jedem von uns zu stark war, um es gänzlich zu unterdrücken.
„Die Opfer sind allesamt Angehörige des House of Lords. Hochangesehene Persönlichkeiten des Britischen Empire“, beantwortete Franklin meine Frage und trat nun hinter dem Sessel hervor, um sich in einen anderen mir gegenüber zu setzten.
„Jetzt sind sie tot, also wohl nicht mehr ganz so hochangesehen“, bemerkte ich.
„Melissa“, tadelte er sanft, aber ich nickte schon.
„Ja, ja, schon gut. Ich werde diesen Warren Forthys nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Und ein Auge drauf haben, dass er kein Opfer von Vampiren oder ähnlichem wird, an das er nicht glaubt.“ Ob er im Angesicht des Todes durch solch ein Wesen seine Meinung wohl ändern würde?
„Danke“, sagte Franklin. „Forthys ist der leitende Agent in diesem Fall und befehligt ein Team von elf weiteren Ermittlern, mit denen wir aber der Göttin sei Dank wenig bis gar nichts zu tun haben werden. Deine Aufgabe wird hauptsächlich sein, dafür zu sorgen, dass er diese Vorfälle irgendwann ad acta legt, wenn wir sie hoffentlich klären und beenden konnten. Über eine plausible Erklärung müssen wir uns Gedanken machen, sobald wir wissen, was dahintersteckt. Und achte darauf, dass er keine unangenehmen Bekanntschaften der dritten Art macht. Es sind ausschließlich Todesfälle, die wir mit übernatürlichen Vorkommnissen in Zusammenhang bringen. Ob es Vampirmorde sind, ist noch die Frage. Aber so oder so wird auch der MI5 keinerlei Erfolg haben. Weder bei der Arrestierung, noch bei der Verurteilung. Im Grunde nicht mal bei der Aufklärung. Und sollte er sie doch haben …“, er machte eine bedeutungsvolle Pause, „… nun, ich muss dir wohl nicht erklären, welch unangenehme Konsequenzen das hätte. Deshalb können wir sie unmöglich allein herumschnüffeln lassen. Dieser Forthys scheint mir jemand zu sein, der nicht eher Ruhe gibt, bis er den Fall gelöst hat.“
„Ah, also ein kleiner Dobermann. Mit so was habe ich Erfahrung.“ Ich spielte damit auf Armand an, der die Angewohnheit hatte, mich bei meinen Einsätzen für den Orden wie ein Wachhund zu begleiten und zu beschützen. In diesem Fall würde er sich wohl ein bisschen im Hintergrund halten müssen, um bei diesem Forthys kein unnötiges Misstrauen zu wecken.
„Sorge dafür, dass er Ruhe gibt.“
„Wer?“, fragte ich verwirrt, aufgrund meiner eigenen Gedankengänge. „Armand oder dieser kleine Schnüffler?“
„Forthys natürlich.“
„Schnell?“, fragte ich hoffnungsvoll und mit einem verschlagenem Lächeln.
„Nein, Mel!“, antwortete mein Vater entschieden. „Nicht schnell. Gründlich, ja. Aber nicht schnell. Und schon gar nicht auf diese Weise. Ich will nicht noch so jemanden wie ihn hier haben. Oder vielleicht sogar ein ganzes Dutzend von diesen bürokratischen Möchtegerns.“
„Schade.“
Wir schwiegen uns eine Weile an, weil Franklin mir meine sorglose Bemerkung durchaus übel nahm.
„Gibt es sonst noch etwas, das ich über diesen Fall wissen sollte?“, fragte ich schließlich und erhob mich gleichzeitig.
„Corelus hat uns die Leiche gebracht, die jetzt in unserer Pathologie liegt.“
„Oh! Aber er hat nicht etwa …?“
„Nein“, beeilte sich mein Vater zu sagen. „Er nahm die Witterung auf und fand Lord Woodward tot. Da seine feinen Sinne die übernatürliche Präsens an diesem Ort spürten, zog er uns sofort zu Rate. Es ist die erste Leiche, die in unsere Hände gelangte. Dass der MI5 nicht grade erfreut darüber ist, kannst du dir wohl denken.“
Jetzt verstand ich das Auftauchen dieses Forthys deutlich besser. „Ach, deshalb diese Kooperationsbereitschaft. Sie können sie uns nicht wegnehmen, aber sie wollen auch nicht, dass wir eigene Ermittlungen durchführen.“
Franklins Blick sprach Bände. Wortlos lud er mich mit einer Geste ein, ihm in die Pathologie zu folgen.
„Wie viele Tote gibt es bislang?“
„Drei. Also seit heute Nacht vier. Die anderen wurden jeweils bei der Polizei gemeldet, die aufgrund des Adelsstandes der Todesopfer gleich den Security Service hinzu gezogen hat.“
Vier Tote, genug, um von einem Serienkiller zu sprechen. Vor allem, wenn die Umstände identisch waren.
Sir Reginald hatte sicher schon mal besser ausgesehen. Nackt und kalt lag er auf dem metallenen Seziertisch. Sein Brustkorb war geöffnet worden, doch inzwischen wieder von einer groben Naht verschlossen. Seine Haut wirkte grau, aber er war auch nahezu blutleer. Franklins erste Überlegung ging in Richtung Vampir, doch Corelus bezweifelte dies. Seine feinen Lykanersinne kannten die Präsens von Nightflyern und dies hier war keine Tat, bei der einer der unsrigen die Hände im Spiel hatte. Auch, wenn es so aussehen sollte. Aus welchem Grund wohl?
Für einen Moment kam mir der Gedanke an Crawler, eine andere Art von Vampiren. Feige, schwache Lumpengestalten, die im Untergrund lebten und über die man sagte, dass sie meine Art irgendwann vernichten sollten, was ich angesichts ihrer Fähigkeiten und Kräfte für lächerlich hielt. Einzig ihr Fürst fiel aus dem Rahmen. Er hatte Macht und war sehr stark. Ich war ihm schon zweimal begegnet und hätte auf beide Begegnungen verzichten können. Aber auch wenn Crawler den Mord an Sir Reginald begangen hätte, wäre dies Corelus aufgefallen, weil ihr Geruch typisch war. Er glich vermoderndem Fleisch und Klärgruben.
Einige von ihnen waren in der City, das wusste ich. Gut versteckt agierten sie in der Kanalisation. Ihre Opfer beschränkten sie momentan auf Ratten und anderes Getier, das durch die Abwasserrohre kräuchte. Sie standen unter meiner Beobachtung, doch solange sie sich ruhig verhielten, führte ich nur eine Akte über sie im Zentralrechner.
Ich streifte mir ein paar Einweghandschuhe über, beugte mich über den toten Körper und öffnete eines seiner Augen. Oh, unser Lord hatte ein kleines Ersatzteil. Der Glaskörper war tatsächlich aus Glas. Ich ließ das Lid sinken und versuchte es bei dem anderen. Zwei Glasaugen konnte er ja wohl nicht haben.
„Äh …“, begann Dr. Green, unser Pathologie-Leiter, doch da hatte ich es schon selbst gesehen. Die Augenhöhle war leer. Ich hob überrascht die Brauen.
„Da hat wohl einer eine Vorliebe für Leckerbissen, wie?“
Mein Vater schluckte. Er konnte sich an meine Art von Humor, die mit dem Fortschreiten meiner Existenz als Vampir einherging, einfach nicht gewöhnen.
Vorsichtig betastete ich die diversen Wunden an Kehle und Torso. Es waren auch Stellen darunter, an denen ein Vampir niemals zugebissen hätte, um einen Menschen zu töten. Höchstens im Liebesspiel, was hier ganz sicher nicht stattgefunden hatte. Crawler waren da weniger wählerisch. Wieder etwas, das für sie als Täter sprach, aber das Gesamtbild passte zu ihnen sowenig wie zu meinesgleichen.
Als ich den Tisch umrundete, um mir einen besonders tiefen Biss unter der linken Achselhöhle anzusehen, stieß ich versehentlich gegen das Gestell. Sir Reginald wackelte kurz, dann glitt sein Arm von der Liegefläche. Ich schnappte überrascht nach Luft.
„Das passiert schon mal“, meinte Dr. Green und wollte den Arm zurücklegen, doch ich hielt ihn davon ab.
Als er mich fragend anblickte, deutete ich auf den Arm des Toten. Oder besser, auf den Boden darunter.
„Was?“, fragte der Pathologe.
Und auch mein Vater, der näher trat, begriff im ersten Moment nicht, was ich meinte. Ich nahm die Tischlampe vom Schreibtisch des Doktors und hielt sie direkt über den baumelnden Arm. „Seht ihr das denn nicht?“
„Was denn? Da ist nichts.“
„Eben, Dad.“
„Eben?“
Ich verdrehte die Augen. „Der Schatten. Wo ist sein Schatten?“
Beide Männer beugten sich jetzt gleichzeitig über den Arm und schauten auf den Boden darunter. Grinsend hatte ich vor Augen, wie sie gleich mit den Köpfen gegeneinander stoßen würden, was aber nicht geschah.
„Das ist völlig unmöglich“, sagte Dr. Green.
„Aber Doktorchen“, erwiderte ich. „Wir wissen doch alle, dass praktisch nichts unmöglich ist.“
Ich erntete einen zurechtweisenden Blick von meinem Vater, den ich ebenso ignorierte, wie die Versuche unseres Pathologen, mit unterschiedlichen Beleuchtungswinkeln, einen Schatten zu erzeugen, wo schlichtweg keiner mehr war.
„Lass uns nach oben gehen, Dad. Ich brauch den Zentralrechner. Und ist Corelus noch hier?“ Mein Vater nickte. Der Lykanerfürst hatte mitgedacht und ein Gästezimmer im Obergeschoss bezogen, falls ich noch Fragen an ihn hatte, nachdem ich den Fall übernahm. „Gut, dann würde ich später gerne mit ihm reden. Aber erst mal sollte ich mir die Leichen in der anderen Pathologie anschauen. Das heißt, falls sie nicht schon unter der Erde sind.“
„Nein“, sagte Franklin, „sie sind noch nicht freigegeben, weil es ja ungeklärte Mordfälle sind. Sie liegen in der Pathologie des MI5.“
„Direkt in deren Patho? Warum hat man sie nicht in der zentralen, städtischen Pathologie gelassen? Die haben auch Kühlboxen.“
Franklin antwortete nicht, sondern warf mir einen Blick zu, der andeuten sollte, dass ich wohl nicht ganz bei Trost sei, so eine Frage zu stellen, wo es doch schließlich um hochrangige Adlige ging. Gut, das konnte man nun sehen, wie man wollte. Für mich waren es schlicht tote Menschen, der Tod macht sie alle gleich.
„Wer ist der zuständige Pathologe?“
„Bishop.“
Ah, der Pathologe, dem die Toten vertrauen. Er hatte bislang jeden Todesfall aufklären können. Merkwürdig, dass ihm die fehlenden Schatten nicht aufgefallen waren. Andererseits konnte so etwas im fahlen Neonlicht einer Pathologie auch leicht übersehen werden, vor allem wenn die Toten auf einer weißen Bahre direkt unter der Beleuchtung lagen, was während des Obduktionsvorgangs üblich war. Und wer achtete auch schon auf Schatten von Toten? Es konnte natürlich auch sein, dass die anderen Toten noch einen besaßen. Das versprach interessant zu werden.
„Kann ich den Jaguar haben?“
Mein Vater schluckte hart. Der X-Type war sein Herzblut. Er pflegte den Wagen fürsorglicher als eine Mutter ihre Kinder. Dennoch stimmte er zögernd zu.
„Aber sei vorsichtig, Mel.“
Ich verabschiedete mich von Franklin mit dem Schlüssel seines Privatwagens in Händen und setzte mich mit einem Grinsen gleich einer Katze, die den Sahnetopf ausgeschleckt hatte, hinters Steuer. Wie lange war ich nicht mehr selbst gefahren? Lange jedenfalls. Es war so aufregend wie Weihnachten und Ostern zusammen, als der Motor schnurrend wie ein Kätzchen ansprang. Ein sehr großes, schnelles Kätzchen, dachte ich grinsend, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr aus der Garage. Vermutlich bewegte sich Franklin am Rande eines Herzinfarktes, als ich mit durchdrehenden Reifen den Kies der Zufahrt auseinander spritzte und johlend vom Anwesen raste.
Der Wagen fuhr sich gut, viel zu schade, um die meiste Zeit unter Verschluss zu stehen, weil Dad ja lieber den Chauffeur nutzte. Ob ich ihm künftig häufiger die Schlüssel abluchsen konnte?
Ab dem Stadtrand nahm ich das Tempo zurück, einen Strafzettel wollte ich ihm nun doch nicht antun. Die Pathologie lag im Thames House, direkt im Hauptgebäude des MI5. Für einen Moment war ich versucht, mich einfach reinzuschleichen, aber dann parkte ich den Wagen direkt vor der Tür, zückte meinen Ashera-Ausweis und befand mich wenige Minuten später an Bishops Seite bei drei nackten, aufgeschlitzten und wieder zugenähten ehemaligen Lords des British Parlaments.
„Gab es irgendwelche Besonderheiten? Etwas, das die drei miteinander verbindet? Außer ihrem Status natürlich.“
Bishop kannte mich schon von anderen Untersuchungen, allerdings hatten wir immer nur flüchtigen Kontakt. Übernatürliche Phänomene ignorierte er lieber und die 0815-Serienmorde waren kein Metier für die Ashera.
„Ja, Miss Ravenwood. Es lag gleich auf der Hand, dass es sich hier um einen Serienmörder handelt. Denn allen Opfern fehlen die Augen.“
Überflüssigerweise öffnete er allen dreien die Augenlider. Genau wie beim Duke of Woodward waren die Höhlen darunter leer. Auch die übrigen Verletzungen ähnelten sich. Bisswunden, gemäß dem Abdruckmuster alle vom gleichen Kiefer verursacht.
So weit so gut. Aber wie brachte ich den netten Doktor jetzt dazu, den Raum zu verlassen, damit ich die Sache mit den Schatten prüfen konnte?
„Dr. Bishop, ich würde gerne Proben mit in unser Labor nehmen. Denken Sie, das wäre machbar? Es wird auch nicht lange dauern.“
Ich setzte mein charmantestes Lächeln auf. Mit Erfolg. Selbstverständlich wäre das keine Problem. Er würde mir sofort die entsprechenden Behältnisse holen und mir bei der Entnahme der Proben behilflich sein. Mit beschwingten Schritten verließ er die Pathologie. Dem machte sein Job wohl wirklich Spaß, dachte ich bei mir. Viel Zeit würde mir nicht bleiben, denn der Raum mit den Probenbehältern lag direkt nebenan. Ich holte meine mitgebrachte Taschenlampe hervor, zog bei jedem Toten nacheinander den linken Arm von der Bahre und prüfte, ob sie einen Schatten auf den Boden warfen. Fehlanzeige. Also tatsächlich derselbe Mörder. Das sprach ebenso gegen die Crawler, wie auch gegen uns Nightflyer. Aber man konnte ja nie wissen. Gerade die Crawler waren noch unerforscht. Wir wussten kaum etwas über sie, außer dass sie meiner Art unterlegen waren.
Gerade rechtzeitig brachte ich die toten Körper wieder in ihre korrekte Position, als Dr. Bishop zurückkehrte. Wir entnahmen Gewebeproben, Blutproben stellte er mir aus den bereits vorhandenen zur Verfügung, da die Flüssigkeit in den Körpern selbst inzwischen vollständig geronnen war. Schließlich lag Lord Nummer eins seit über einem Monat, die beiden anderen seit knapp zwei Wochen hier.
Ich würde alles an unsere Pathologen weitergeben und mich in der Zwischenzeit mit der zentralen Datenbank der Ashera auseinandersetzen, ob ich dort Spuren von Dämonen oder ähnlichem fand, die es auf Schatten und Augäpfel abgesehen hatten.
Der Lycanerfürst Corelus gesellte sich wenig später zu mir in die Zentralbibliothek, wo ich ein Dutzend Suchanfragen durch den Rechner laufen ließ. Neugierig blickte er mir über die Schulter. Die Möglichkeit, Einsicht in unsere Datenbanken zu nehmen, ergab sich für Außenstehende selten bis nie. Aber Corelus ging seit der Geschichte mit den Engelstränen regelmäßig ein und aus in Gorlem Manor und hatte unsere Archive seinerseits mit interessantem Wissen über sich und seine Art gefüllt, das nicht einmal in ihrem Lycandinum stand.
Er glich nicht gerade dem klassischen Werwolf. Die größte Ähnlichkeit lag wohl noch in seinem grauen Fell, aber die leuchtend orangene Iris seiner Augen, die kurze Schnauze und seine Hände, die zwar aussahen, wie Pfoten, aber über einzeln bewegliche Finger mit langen Krallen verfügten, hatten nichts mit den Figuren aus Horrorfilmen gemein.
„Wonachh suchstt du, Mell?“ Seine schnappende Aussprache wirkte im ersten Moments stets fremdartig. Anfangs hatte ich es für lykaner-typisch gehalten, doch inzwischen kannte ich auch andere seiner Art, die wesentlich ‚akzentfreier’ redeten.
„Nach einer Kreatur, die Schatten stiehlt“, antwortete ich ihm und starrte zunächst weiter auf den Schirm.
Corelus knurrte, ich drehte mich verwundert zu ihm um und zog die Stirn in Falten. „Sagt dir das etwas?“
„Ess gibtt wenige, die Schattenn stehlenn. Aberr ich weißß von einemm, derr ess vielleichtt könnte. Ein Sölldnerr auss derr Unterrweltt. Der Schattenjägerr!“
Wie auf Kommando sprang eines der Suchfenster auf dem Bildschirm auf. Die Datei trug den Namen ‚Schattenjäger – der/die’.
„Na, welch ein Zufall“, kommentierte ich und öffnete den Ordner.
Der Schattenjäger, möglicherweise gab es sogar mehrere davon, war ein Krieger, der seine Fähigkeiten in jedermanns Dienste stellte, der es sich leisten konnte. Womit man bezahlte, stand allerdings nicht im Dokument. Auch nicht, dass er Schatten stahl. Dafür bewiesen Quellen, dass er mehrere tausend Jahre alt war und einige Skizzen zeigten zumindest Zähne, die zu den Bisswunden von Sir Reginald passten.
„Ichh weißß, dass derr Schattenjägerr in derr Nähe istt. Sein Dufftt schwebtt überr derr Stadtt.“
Nachdenklich schaute ich Corelus an. Das passte alles wunderbar zusammen. Vielleicht zu gut. Aber es war eine Spur, die einzige, die ich momentan hatte. Was machte dieses Wesen wohl hier und warum? Wenn er gewöhnlich anderen diente, was es fragwürdig, dass er hier aus eigenem Antrieb agierte
„Kommst du mit?“, fragte ich während ich meinen Mantel wieder anzog.
„Wohinn?“
„Na zum Tatort. Auf Spurensuche gehen.“
Corelus hatte kein Interesse daran gehabt, mich zu begleiten, also war ich allein losgezogen, um mir den Tatort anzuschauen. Schade, denn ein Spürhund wäre gar nicht schlecht gewesen. Die Polizei hatte die Gasse abgesperrt. Mit Kreide war Sir Reginalds Umriss auf das feuchte Pflaster gemalt. Meine Wölfin Osira materialisierte sich und lief sofort darauf zu, um die Stelle abzuschnüffeln. Ich musste lachen, denn sie betonte immer wieder, dass sie kein Spürhund war, wenn ich sie mal darum bat, uns mit ihrer Nase zu helfen. Ein sehr eigenwilliges Krafttier, dass mir die Göttin da zur Seite gestellt hatte. Aber ich liebte meine Freundin von Herzen.
„Nicht, dass du mir hier irgendwelche Spuren hinterlässt“, mahnte ich, woraufhin sie mir einen beleidigten Blick zuwarf.
Meine Augen suchten die nähere Umgebung ab. Häuserwände, Mülltonnen, eine kaputte Straßenlampe. Der Tatort war nicht zufällig gewählt worden, aber wie hatte der Täter einen Mann wie den Duke of Woodward hierher gelockt? Es war ein Rätsel. Männer wie ihn traf man nicht in solchen Gassen. Ich zog mein Handy aus der Tasche und wählte Franklins Nummer. Er nahm sofort ab.
„Dad, ich bin am Tatort. Sag mal, hat man irgendwas in den Sachen des Duke gefunden?“
„Was genau meinst du, Mel?“
„Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sir Reginald gewohnheitsmäßig in solch üblen Gassen unterwegs ist. Er muss doch einen Grund gehabt haben. Ich glaube nicht, dass er ein zufälliges Opfer geworden ist. Da hat es einer gezielt auf die Lords abgesehen, sonst würden sich die Todesfälle nicht so häufen. Hatte er einen Brief bei sich? Eine Nachricht auf dem Mobiltelefon? Irgendetwas? Wissen seine Angestellten von einem Anruf?“
Franklin schwieg einen Moment. „Nun, die Durchsicht seiner Kleidung ist abgeschlossen, aber Dick hat mir nichts Auffälliges berichtet. Ich frage ihn natürlich sofort noch mal.“
„Ja, tu das, Dad. Ich schaue mich hier weiter um, ob ich einen Anhaltspunkt finde, der uns auf die Spur des Täters bringt. Und was ist mit den Angestellten?“
„Da die Leiche noch nicht lange bei uns liegt, wurden sie noch nicht näher befragt. Ich gehe davon aus, dass der MI5 das erledigen wird. Apropos, was willst du diesem Forthys denn sagen, wenn du dich allein am Tatort rumtreibst?“
Ich verdrehte die Augen. „Das ist ja nicht verboten. Wenn ich etwas finde, schaue ich, wie ich es ihm am besten erkläre.“
Damit war Franklin nicht zufrieden, aber er nahm es hin. Ich untersuchte weiter die Gasse. Verdammt, es konnte doch nicht sein, dass der Täter nicht die geringste Spur hinterlassen hatte.
Hinter mir in der Dunkelheit hörte ich plötzlich Flügelschlagen. Gleich darauf glitt ein schwarzer Vogel mit ausgebreiteten Schwingen knapp über dem Boden auf mich zu. Ich erkannte eine blaue Feder in seiner linken Schwinge. Es war Camilles Seelenkrähe, meiner Tante, die mich im Orden zur Hexe ausgebildet hatte. Sie war im vergangenen Jahr an Krebs gestorben.
Ich hatte das Totemtier lange nicht gesehen und war schon fast der Meinung gewesen, dass sie Camille in die Gegenwelt gefolgt war. In der ersten Zeit nach ihrem Tod, hatte mich die Krähe begleitet. Doch dann war sie für Monate verschwunden. Ihr plötzliches Auftauchen überraschte mich. Kurz vor mir landetet sie auf einem Zaunpfosten.
„Was machst du denn hier, meine Liebe?“, fragte ich. Sie krächzte zweimal und sprang dann vom Zaun zu den Umrissen des Duke, wo sie mit ihrem Schnabel zwischen den Pflastersteinen pickte. Ewas Schimmerndes kam zum Vorschein. Die Spitze einer Klinge? Eine Kugel? Ich ging auf sie zu und hielt ihr meine Hand hin. Bereitwillig ließ sie das Metallstück hineinfallen. Es fühlte sich seltsamerweise weder kalt noch starr an. Nach genauerem Betrachten erwies es sich zwar als glatt und glänzend, aber nicht aus Metall, auch wenn es so aussah. Die Konsistenz war weich, ein bisschen wie Gummi. Es handelte sich um lebendes Gewebe. Mit offenem Geist ließ ich die Schwingungen dieses seltsamen Fundstücks auf mich einwirken. Erst herrschte nur Dunkelheit, doch dann zuckten Bilder vor meinem inneren Auge vorbei. Ein großes Wesen mit Schwingen. Metallische Haut, lange Krallen, das Schwert eines Kriegers. Ich sah ihn durch die Gassen laufen, dann vor dem toten Sir Reginald stehen, das Schwert erhoben. Laternenlicht spiegelte sich auf der Klinge. Ein Geräusch, die Gestalt wirbelte herum, die Laterne zerbarst, Splitter regneten herab, einer erwischte dieses Wesen.
Mehr sah ich nicht. Aber dieses winzige Stück Haut stammte von der Verletzung durch die Scherben der Straßenlaterne. Als ich es in der Hand drehte, erkannte ich getrocknete Flüssigkeit, schwarz, wohl das Blut dieser Kreatur. Was ich gesehen hatte, glich den Skizzen des Schattenjägers. Doch er war ganz offensichtlich nicht allein gewesen. Und die Vision sprach auch nicht zwingend dafür, dass er den Duke getötet hatte, obwohl es eine naheliegende Überlegung war. Denn was sonst tat er in der Nähe der Leiche?
„Wie es aussieht, muss ich den Schattenjäger finden, um Antworten zu erhalten.“
Leider hatte ich keine Ahnung, wo ich mit der Suche nach ihm beginnen sollte.
Ein Geräusch in den Schatten hinter mir ließ mich herumfahren. Meine Härchen im Nacken sträubten sich. Gefahr lag in der Luft. Es wurde schlagartig kälter. War da ein Zischen? Jeder Muskel meines Körpers stand unter Spannung, als ich mich den Müllcontainern näherte. Da war etwas, ich sah gelbe Augen im Dunkeln schimmern, fast stockte mir der Atem. Noch ein Schritt … zwischen den Containern sprang plötzlich etwas hervor, direkt auf mich zu. Instinktiv hob ich die Hände zur Abwehr. Der Laut, den mein Gegner ausstieß, verriet große Verärgerung, als er mich mit ausgefahrenen Krallen attackierte.
Lachend fing ich die Katze auf, die noch nicht so recht wusste, ob sie meine Gegenwart gut oder schlecht finden sollte. Sie brummte vor sich hin, war aber durch Kraulen zu besänftigen. Offenbar hatte ich ihr Abendessen vertrieben. Kaum dass ich es dachte, raschelte es noch einmal bei den Abfalleimern. Eine der runden Blechmülltonnen fiel scheppernd zu Boden. Die Katze auf meinem Arm fauchte, hieb mit ihren Krallen nach mir und erwischte mich im Gesicht. Fluchend ließ ich sie fallen, sah einen Schatten um die Ecke verschwinden. War das nicht ziemlich groß für eine Ratte? Aber je nach Winkel verzerrt das Licht die Größe eines Objektes zuweilen erheblich.
Ich fuhr mir mit der Hand über die blutigen Striemen. Sie heilten zum Glück schon wieder ab. Dennoch brannten sie. Von der Katze keine Spur mehr.
„Blödes Vieh.“
Die Krähe landete wieder auf meiner Schulter und brachte mir noch ein weiteres Indiz. Ein Büschel Haare, das zweifelsfrei nicht zu dem grauen Straßentiger gehörte. Rotbraun wie das Fell eines Löwen. Sehr merkwürdig. Es war keiner aus dem Zoo ausgebrochen, so was hätte man in den Nachrichten gehört. Verwirrt, aber zumindest mit ein paar ersten Spuren in der Hand, kehrte ich ins Mutterhaus zurück.
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info





