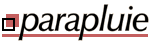
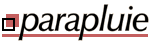 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 21: warschauer pakt
|
Kundera als PhilosophVom Erforschen der Existenz und Gefangenen der Geschichte |
||
von Thomas Sukopp |
|
Als Romancier ist Milan Kundera ein scharfsichtiger Erforscher der menschlichen Existenz, dessen Texte den "anthropologischen Skandal" totalitaristischer Systeme behaupten. Ist Kundera jedoch deswegen ein Philosoph? Eine Untersuchung von Kunderas Verhältnis zum Existenzialismus Sartres und Camus’ sowie zur Romanwelt Franz Kafkas kann helfen, das Philosophische in seinem Schreiben besser in den Blick zu bekommen. |
||||
Ist Milan Kundera ein Philosoph? Ein Klassiker dieser Disziplin ist er gewiß nicht. Ein Klassiker der Philosophie muß zu mindestens einer, besser mehreren Fragen der Philosophie einen bleibenden Beitrag geleistet haben, und: Er muß tot sein. Milan Kundera aber lebt und zwar seit über 75 Jahren. Von einem Schriftsteller erwarten wir zudem nicht, daß er ein Philosoph ist. Auch Kundera selbst hat Zweifel, ob ein Romancier als Romancier ein Philosoph sein kann. Befragt, warum ein Romancier auf das "Recht verzichten" soll, "in seinem Roman seine Philosophie direkt" als Behauptung auszudrücken, antwortet Kundera in Die Kunst des Romans: |
||||
"Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied in der Denkweise eines Philosophen und der Denkweise eines Romanciers. Man spricht oft von Tschechows, Kafkas, Musils Philosophie, usw. Aber versuchen Sie einmal, aus ihren Schriften eine in sich schlüssige Philosophie zu entnehmen! Selbst wenn ein Gedanke unvermittelt in einem Notizbuch festgehalten wird, ist er eher ein Exerzitium des Denkens, ein Spiel mit Paradoxa, eher Improvisation als Behauptung eines Gedankens." |
||||
Noch einmal also: Ist Milan Kundera ein Philosoph? Ja, wenn man die verschiedenen eingestreuten Bemerkungen über die großen Fragen der Philosophie in seinen Büchern liest. Gleichzeitig aber auch nein, denn Aphorismen oder Lebensmaximen der Marke Schopenhauer oder Lichtenberg sind diese Bemerkungen nicht. Kundera fehlt systematische Strenge, sie muß ihm fehlen, denn er schreibt Romane und keine philosophischen Lehrbücher. |
||||
Kundera ist daher kein Philosoph im engeren Sinne der Charakteristika, die aus meiner Sicht Philosophie von Literatur unterscheiden: Anspruch auf argumentative Klarheit; Präzision der Begriffe; reflexives Instrumentarium; Anspruch auf Wahrheit, Objektivität oder Intersubjektivität; Kritisierbarkeit. Selbst wenn wir keinem Rationalitätsideal verbunden sind, das Wahrheit oder Objektivität einfordert oder behauptet, so sind Aussagen gemäß einer Wahrheitstheorie innerhalb der Philosophie jedoch unter bestimmten Bedingungen "wahr", ein Anspruch, den ein Roman so nicht einzulösen versucht. Nach Kunderas Selbstverständnis ist ein Romanschriftsteller -- wenn auch kein Philosoph -- so doch ein "Erforscher der Existenz". Diese Überzeugung verbindet ihn mit Philosophen wie Sartre und Camus und von ihr aus soll hier eine Annäherung an die philosophischen Bemerkungen in Kunderas Texten versucht werden. |
||||
Das Philosophische in Kunderas Werk | ||||
Es sind die großen Themen, die existentiell bedeutsamen Situationen, in denen Kundera seine Helden das Schwere, die Schwere und die Leichtigkeit der Existenz erfahren läßt: Körper, Seele, Sein, Tod. Kunderas Figuren zeichnet aus, daß sie keinen Zugriff auf die Geschichte haben. Sie sind vielmehr Gefangene in einem "System von Grundsituationen" (Birchler), die irgendwie menschengeschaffen, aber nicht mehr steuerbar sind. Damit steht Kundera in der Nähe Kafkas, auf den wir weiter unten kurz zu sprechen kommen. Ein Aspekt der Undurchdringlichkeit, der fehlenden Kontrolle über die Gegebenheiten des Alltags ist Kunderas Schreiben in einem totalitärem Regime. Kunderas Romane von Der Scherz (1968) bis zu Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins (1984) leuchten die Auswirkungen eines real existierenden Sozialismus auf Kunderas Figuren (Ludvík, Teresa) aus. Um einen anderen Aspekt der Romankonzeption Kunderas zu verstehen, müssen wir Kunderas Verhältnis zum Existentialismus untersuchen. Dieser Essay ist ein Versuch, das Philosophische dieser beiden verwobenen Aspekte -- Kunderas Position als Autor im Totalitarismus sowie sein Verhältnis zur Existenzphilosophie -- herauszufiltern. Gehen wir dazu zunächst einen Schritt zurück. |
||||
Was macht Kundera, wenn er schreibt? Er hat die völlige Kontrolle über seine Figuren, er schafft Gestalten als Thesen und er reflektiert ständig über seinen Erzählstrom. Kundera spannt weite Bögen und die Pfeiler dieser Bögen sind oft kühne Postulate. Ein weiteres Charakteristikum Kunderas ist sein Anspruch auf Erkenntnis(gewinn) (siehe dazu Kvetoslav Chvatik in Die Fallen der Welt), der durchaus philosophisch zu verstehen ist. Es geht Kundera um die Enthüllung neuer Aspekte der menschlichen Existenz in der jeweiligen Zeit. Die Frage nach der Form des menschlichen Seins und dessen Konflikten in der jeweiligen Gesellschaft wird gestellt. Dabei ist die Welt des Romans als "Lebenswelt" zu verstehen. Sie hat keine fertigen philosophischen Konzepte anzubieten, dient aber als Ausgangspunkt philosophischen Experimentierens, als Laboratorium. Kundera grenzt seine Tätigkeit von systematischer Philosophie mehrfach ab. So wie sich Nietzsche der Systematik verweigert, allgemein akzeptierte Systeme aufweicht und sich ins Unbekannte vorwagt, muß nach Kundera "Authentisches Romandenken", wie er es in Verratene Vermächtnisse beschreibt, unsystematisch sein. |
||||
"Wenn ich eine starke Präsenz des Gedankens im Roman vertrete, bedeutet dies nicht, daß ich den sogenannten 'philosophischen Roman' liebe, diese 'Erzählform' für moralische oder politische Ideen. Authentisches Romandenken (wie der Roman es seit Rabelais kennt) ist immer unsystematisch; undiszipliniert; es steht Nietzsches Denken nahe; es ist experimentell: schlägt Breschen in sämtliche uns umgebenden Ideensysteme; es untersucht (vorwiegend mittels der Figuren) alle Wege der Reflexion; wobei es sich bemüht, einen jeden bis zu Ende zu gehen." |
||||
Der Verführung, systematisch zu denken, sollte ein Schriftsteller widerstehen. Sonst wird er ein Mensch mit "Überzeugungen", ein beschränkter Mensch, dessen Gedanken erstarrt sind. Experimentelles Denken will nicht überzeugen, sondern inspirieren, und ein Romancier muß beständig die Barrikaden niederreißen, die er mit seinem eigenen Denken um sich herum errichtet hat. Kundera entdeckt einen Skandal beim Niederreißen dieser Barrikaden. |
||||
Kunderas anthropologischer Skandal | ||||
Kunderas "antifanatisches" Denken steht in der Tradition der Aufklärung. Einmal ist Aufklärung wörtlich zu verstehen, im Sinne der Verständigung darüber, was der Fall ist. Dann ist Aufklärung ein Versuch, die conditio humana, das spezifisch Menschliche herauszustellen. Das spezifisch Menschliche nennt Kundera nicht. Aber Kundera gibt eine desillusionierende Antwort, wenn er, wie zum Beispiel hier im Gespräch mit Ian McEwan sagt, wozu Menschen fähig sind: |
||||
"Fanatiker hören nicht auf, Menschen zu sein. Fanatismus ist menschlich. Faschismus ist menschlich. Kommunismus ist menschlich. Mord ist menschlich. Das Böse ist menschlich. Genau deswegen sehnt sich Teresa [Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, T.S.] nach einem Zustand, in dem der Mensch nicht Mensch ist. Das Paradies der politischen Utopie beruht auf dem Glauben an den Menschen. Darum endet es in Massakern. Teresas Paradies beruht nicht auf dem Glauben an den Menschen." |
||||
Als Anmerkung sei gesagt, daß der Kommunismus in der Sicht Kunderas hoffnungsloser als der Faschismus ist. Dies ist er wegen seiner gnadenlosen Geschichtsteleologie. Für Kundera war er lange das Sinnbild des Ewigen. Die gesellschaftliche Situation in totalitären Staaten ist für ihn nicht zuerst ein politischer, sondern ein anthropologischer Skandal, d.h. etwas, was uns schockiert. Doch was ist das Schockierende? Wir sprechen gern von den schockierenden Methoden der Bürokratie, die den Gulag, politische Prozesse und stalinistische Säuberungsaktionen hervorgebracht haben. Wer so spricht, meint Kundera, der vergißt, daß es immer Menschen sind, die innerhalb eines politischen Systems für ein politisches System arbeiten. Jedes politische System ist so schlecht wie die Menschen. Menschen können nicht vier Meter hoch in die Luft spucken (Kundera), aber sie können töten und tun dies auch. Die anthropologische Frage, wozu Menschen fähig sind, steht hinter der politischen Frage. Oder: Sie ist grundlegender und in diesem Sinn der politischen Frage vorgeordnet. |
||||
Teresas Gegenvision und Gegenmittel in Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist die Utopie eines Lebens in einer Idylle ohne Menschen, zeitlich noch vor einem Rousseauschen Naturzustand. Dort besteht Glück in der Gleichförmigkeit des Bekannten. Im Anschluß an die Mythologie des Alten Testaments ist die Gleichförmigkeit des Daseins nicht Langeweile, sondern Glück. Das Leben im Kreis, im Kreislauf mit den Dingen der Natur läßt die Menschen Geborgenheit erfahren. Teresa sieht ein Dorf (ländliche Idylle) und denkt an das Paradies. Der biblische Adam im Paradies konnte sich nicht in der Quelle gespiegelt sehen. Die junge Teresa versuchte durch sich hindurch auf ihre Seele zu blicken und verglich Adam mit ihrem Hund Karenin, der sein Spiegelbild nicht erkennt. |
||||
"Der Vergleich zwischen Karenin und Adam bringt mich auf den Gedanken, daß der Mensch im Paradies noch nicht Mensch war. Genauer gesagt: der Mensch war noch nicht auf die Bahn des Menschseins geschleudert. Wir aber sind längst darauf geschleudert worden und fliegen durch die Leere der Zeit, die auf einer Geraden abläuft. Doch existiert in uns immer noch eine dünne Schnur, die uns mit dem fernen, nebelhaften Paradies verbindet, wo Adam sich über die Quelle neigt und, im Gegensatz zu Narziß, nicht ahnt, daß dieser blaßgelbe Fleck, der im Wasser auftaucht, er selber ist. Die Sehnsucht nach dem Paradies ist das Verlangen der Menschen, nicht Mensch zu sein." (Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins) |
||||
Auf dieses utopische Gegenmittel kann der moderne Mensch nicht zurückgreifen. Er hat in der Tschechoslowakei Kunderas (Kundera emigrierte 1980 nach Frankreich) mit höheren Mächten zu kämpfen, die sein Leben erschweren. |
||||
Kafka: Das bürokratisierte Universum des Menschen | ||||
Kafka ist einer der Gewährsmänner Kunderas. In Die Kunst des Romans erzählt er eine Geschichte, die an Kafka erinnert. Ein Ingenieur wird durch Zufall verleumdet, die Verleumdung ist als Verleumdung bekannt, aber der Irrtum kann im Labyrinth der Bürokratie des kommunistischen Regimes nicht zurückgenommen werden. Ähnlich beginnt Der Scherz mit einem solchen. Eine als Scherz gemeinte Postkarte Ludvíks besiegelt sein Schicksal. (Der Scherz erzählt, wie ein Witz, der in Ideologenhände gelangt, Ludvíks Schicksal besiegelt). |
||||
Mit Kafka macht Kundera einen Bruch in der Geschichte der europäischen Literatur aus und damit einen Bruch im Verhältnis des Menschen zur Welt: Die Welt ist Kundera und Kafka zur Falle geworden. Ein Buch über Kundera trägt einen entsprechenden Titel: "Die Falle der Welt: Der Romancier Milan Kundera". Worin besteht nun diese Falle und was ist es, das Kafka diagnostiziert? Der moderne (psychologische) Roman wird meistens an dem Dreigestirn Proust, Joyce und Kafka festgemacht. Kundera sieht einen Abschluß im Entwicklungsprozeß des Romans mit den beiden Erstgenannten. Mit Kafka, Broch und Musil beginnt für ihn etwas Anderes. Menschen kämpfen hier nicht mehr mit den Ungeheuern in ihrem Innern, sondern mit Einflüssen von Außen, wie Kundera sie im Interview mit McEwan beschreibt: |
||||
"Bei Kafka kommt das Ungeheuer zum ersten Mal von außen: die Welt wird als Falle empfunden. Der Mensch wird von der Außenwelt bestimmt: von der Macht im 'Schloß', von der Macht des unsichtbaren Gerichts im 'Urteil'. In meinen Büchern ist es die Geschichte, die den europäischen Menschen einfängt. (Anmerkung [Kunderas; TS]: Die Dimension des Politischen kümmert die Helden der Romane des 18. Jahrhunderts nicht, sie taucht nur am Rande auf. Die Politisierung des Privaten ist jüngeren Datums)." |
||||
Wir sind also laut Kundera in der Welt gefangen, in der konkreten, greifbaren Geschichte. Wir sind weniger durch unsere Komplexe, unsere Kindheit u. a. beschränkt als durch die alles bestimmende Geschichte, der wir uns nicht entziehen können. "Sie ist der Krieg. Sie ist ein politisches Regime." Diese Darstellung Kunderas beschreibt einen Teil dessen, was als Ferment des Existentialismus gilt, ein Teil des Unbehagens an der Moderne (Freud), an der technisierten, bürokratischen Welt. Es beschreibt ein Lebensgefühl und Intuitionen, die eine Generation von Literaten und Philosophen -- vielleicht die Generation Kafkas --, teilten. Werfen wir nun anhand von Der Prozeß und Das Schloß einen genaueren Blick auf Kafka. Der Ingenieur (ähnliches gilt für Josef K. in Das Urteil oder für den Landvermesser K. (ebenfalls in Das Schloß)) ist mit einer Macht konfrontiert, die ein unabsehbares Labyrinth darstellt. Wenn wir nur die für die Romanfiguren existentiell relevanten Dinge betrachten, können wir sagen: Die Welt ist eine uneinsehbare, nicht verstehbare Institution. |
||||
Romanciers vor Kafka haben Institutionen als Kampfplätze entlarvt, auf denen es rauh zugeht, wo aber immer die (persönlichen oder anderen) Interessen von Menschen aufeinanderprallen. Da ging es noch menschlich zu. Und vor allem: Diese Konflikte waren prinzipiell verstehbar. Bei Kafka ist die Institution ein Mechanismus, der nach seinen eigenen Gesetzen funktioniert, so als hätte ihn ein Mensch irgendwann programmiert. Die bei Kafka auf diese Weise "entmenschlichte" Macht wird in Kunderas Sicht gerade als Teil des oben beschriebenen "anthropologischen Skandals" gesehen. Bei allen Unterschieden zwischen den Szenarien in Kafkas Romanen einerseits und Kunderas Blick auf die Gefangenen der Geschichte andererseits, die "schockierenden Methoden der Bürokratie" (Kundera), sind hier wie dort Menschenwerk. Der Mechanismus der Bürokratie ist bei Kafka und Kundera so programmiert, daß er mit menschlichen Interessen nichts mehr zu tun hat. Daher ist er unverständlich. Die Bürokratie in Kafkas Geschichten hat noch mehrere Folgen, wie sie Kundera in Die Kunst des Romans entwickelt. Dazu zählen die Entwertung der physischen Existenz, da die Existenzberechtigung von Menschen auf (Fehlern in) Akten beruhen. Ein weiterer Punkt ist die Umkehrung des Verhältnisses von Strafe und Schuld. Die Figuren Kafkas fühlen sich schuldig und suchen die Strafe. Schließlich verschärft die Komik bei Kafka die aussichtslose, absurde Lage seiner Helden. Wir werden weiter unten sehen, in welchen kafkaesken Situationen die Figuren Kunderas gefangen sind und fragen zunächst nach ihrem Zusammenhang mit existenzphilosophischen Fragestellungen. |
||||
Kunderas Figuren und die Armut der Existenzphilosophie? | ||||
Probleme der Identität, genauer die Entzauberung der Welt durch ständige Konfrontation mit dem Kontingenten und Unvollkommenen finden wir insbesondere in Die Identität. Hier lassen sich leicht Verbindungen mit existenzphilosophischen Schriften herstellen. |
||||
Kundera sieht sich nur bis zu einem bestimmten Punkt in einer Tradition mit existentiellem Denken, wie er im Gespräch mit Ian McEwan erläutert: |
||||
"[D]er Roman ist die einzige Möglichkeit, die menschliche Existenz in allen ihren Aspekten zu beschreiben, zu zeigen, zu analysieren, herauszuschälen. Mir ist keine andere intellektuelle Anstrengung bekannt, die dieser Leistung des Romans gleichkäme. Nicht einmal die existentialistische Philosophie. Das besondere des Romans ist seine Skepsis, die er grundsätzlich gegen alle Gedankensysteme hegt. Er setzt als Prämisse voraus, daß es grundsätzlich unmöglich ist, menschliche Existenz in irgendeine Art von System einzupassen." |
||||
Hier wird erneut Kunderas Sicht auf das Verhältnis von Literatur und Philosophie deutlich. Ich stimme Kundera zu, wenn er auf den Reichtum des Romans zu sprechen kommt, der menschliche Existenz weniger abstrakt beschreiben und erforschen kann als Philosophie. Allerdings ist seine Skepsis gegenüber Gedankensystemen mit Blick auf die existenzialistische Philosophie in dieser Deutlichkeit wohl nicht berechtigt, denn mindestens in Bezug auf Camus wäre es verfehlt, bei seinem Werk von einem System zu sprechen. Nun wollte Camus sich selbst nicht als Existenzphilosophen verstehen. Er hat allerdings zu dem, was menschliche Existenz ausmacht, viel mehr als alle anderen Philosophen geschrieben, so zum Beispiel über den Selbstmord als philosophisches Problem. Kundera beschreibt in einer Kurzformel den Roman in Die Kunst des Romans als eine "Meditation über die Existenz mittels der Perspektive imaginärer Figuren". Denken wir hier an Sartres Ekel sowie Camus' Der Fremde und Die Pest. In Der Fremde beginnt das geschilderte Drama der Existenz mit einer Meditation über die Konfrontation Meursaults mit einer ihm übermächtigen Natur. Auf die Frage, warum er einen Menschen getötet hat, antwortet er dem Richter folgerichtig, die Sonne sei Schuld. Im Unterschied zum Romancier denkt ein Existenzphilosoph nicht nur über Existenz, sondern auch über ihre Einordnung in philosophische Zusammenhänge nach. Sartre hat viel über den ontologischen Status des Seins reflektiert. Warum hat er nicht einfach das Seiende geschrieben? Ein zweiter Unterschied zwischen einem Philosophen und einem Romancier in Anlehnung an Kundera ist, daß die Gesprächspartner des Philosophen andere Philosophen sind, deren Perspektive er einnimmt, wenn er gegen sie argumentiert, ihre Voraussetzungen analysiert oder einfach ihre Texte interpretiert. |
||||
Eine Parallele zwischen Kundera und Sartre zeigt sich durch einen Vergleich von Sartres Der Ekel und Kunderas Die Identität. Insbesondere in diesem Text finden wir Probleme der Identität, genauer der Entzauberung der Welt durch ständige Konfrontation mit dem Kontingenten und Unvollkommenen behandelt, und von hier aus lassen sich leicht Verbindungen mit existenzphilosophischen Schriften herstellen. Wie im Ekel wird die Vertrautheit des eigenen Körpers auch in Kunderas Text fragwürdig. Die Selbstverständlichkeit physischer Existenz kommt dem Geliebten Chantals in Die Identität abhanden. "[Es] kam ihm so vor, als existierte sie nicht mehr für ihn, als sei sie anderswo hingegangen, in ein anderes Leben, wo er sie, wenn sie ihm begegnete, nicht mehr erkennen würde." An einer anderen Stelle kulminiert die fast schon Ekelgefühle auslösende Beschaffenheit des menschlichen Körpers in einer theodizee-ähnlichen Frage: |
||||
"Seit seiner letzten Begegnung mit F. denkt er daran: das Auge: das Fenster der Seele; das Zentrum der Schönheit des Gesichts; der Punkt, in dem sich die Identität eines Individuums konzentriert; aber gleichzeitig ein Sehwerkzeug, das ständig gesäubert, befeuchtet, mit einer speziellen Flüssigkeit mit einer Dosis Salz gepflegt werden muß. Der Blick, das größte Wunder, das der Mensch besitzt, wird zum Säubern also regelmäßig von einer mechanischen Bewegung unterbrochen [...]. [Doch] was für ein jämmerliches Schicksal, die Seele eines hingeschluderten Körpers zu sein, dessen Auge nicht schauen kann, ohne alle zehn, zwanzig Sekunden gesäubert zu werden! Wie kann man glauben, daß der andere vor uns ein freier, unabhängiger Mensch ist? Wie kann man glauben, daß sein Körper der getreue Ausdruck einer ihm innewohnenden Seele ist? Um das glauben zu können, mußte man das dauernde Blinzeln des Lids vergessen. Man mußte die Bastelwerkstatt vergessen, aus der wir herkommen. Man mußte einem Vertrag des Vergessens zustimmen. Gott selbst hat ihn uns auferlegt." |
||||
Ein weiteres existenzphilosophisches Thema (z. B. Camus' in Der Mythos von Sisyphos), das Kundera aufgreift, ist die Zufälligkeit des eigenen Seins, die Fadenscheinigkeit und Zerbrechlichkeit der Identität. Das sind Themen, die Chvatik in Die Fallen der Welt "grundlegende existentielle Meditationen des Romans" nennt. Wenn wir auf Die Unsterblichkeit blicken, dann wird die Sehnsucht nach Unsterblichkeit in Kunderas Sicht auf sehr anspruchsvolle Art formuliert. Diese Unsterblichkeit, die die Identität eines Individuums überwindet, ist, wie Chvatik (Die Fallen der Welt) anhand von Kunderas Text demonstriert, erstrebenswert. |
||||
"Nicht das (vergebliche) Streben nach romantisch arrangierter Unsterblichkeit, sondern die Empfindung der Fülle des Daseins in Anonymität, ohne Subjektivität und Egoismus; das schweigende Sein ist der höchste Wert: |
||||
Der Roman ist das Medium der Suche nach einem Sinn. Kunderas Figuren leiden am Sinnverlust. Welche Art von Transzendenz gibt es noch, wenn Gott als sinnstiftende Instanz sich mindestens zurückgezogen hat? Welche Transzendenz bleibt nach dem Verlust der Transzendenz? Ein Kandidat ist Unsterblichkeit, wenn Gott Garant einer geistigen, symbolischen Existenz nach dem Tod ist. Unsterblichkeit in einer Welt ohne Gott als untheologisches, unmetaphysisches Thema tritt bereits in Goethes Dichtung und Wahrheit auf und wird von Kundera wieder aufgenommen. Die irdische Variante der Unsterblichkeit ist das Nachleben im Gedächtnis künftiger Menschen. Strickt nicht jeder Mensch so seit seiner Jugend an seiner kleinen Unsterblichkeit, fragt Kundera in Die Kunst des Romans. |
||||
Die Folge des Verlustes Gottes ist grenzenlose Freiheit (Sartre) und grenzenlose Einsamkeit (im Sinne metaphysischer Heimatlosigkeit). Deswegen gibt es die Sehnsucht nach irdischer Unsterblichkeit in Form von Liebe. Die kleine Unsterblichkeit ist die Anerkennung von Freunden und der Familie. Als zweiten zwischenmenschlichen Effekt verbindet Kunderas Position mit dem Verlust Gottes gleichzeitig auch die Überwindung des menschlichen Herrschaftstriebes als Folge der Erkenntnis der essentiellen Relativität menschlichen Daseins. "Niemand ist der Stellvertreter irgendeiner anderen und höheren Instanz." kommentiert Richard Rorty diese Position. Kundera spricht Menschen das Recht auf Herrschaftsgewalt über andere Menschen ab. Dies ist in der Tat nur die politische Spitze eines Eisbergs, der sich in Die Kunst des Romans so darstellt: |
||||
"Der Mensch wünscht sich eine Welt, in der Gut und Böse klar geschieden sind, ist er doch von dem unbezähmbaren Verlangen beseelt, zu urteilen, bevor er begreift. Auf diesem Verlangen beruhen Religionen und Ideologien. [...] Sie fordern, daß jemand recht hat; entweder ist Anna Karenina Opfer eines bornierten Despoten oder Karenin ist Opfer einer unmoralischen Frau; entweder wird der schuldige K. von einem ungerechten Gericht überfahren, oder hinter dem Gericht verbirgt sich die göttliche Gerechtigkeit, dann ist er schuldig. Dieses 'Entweder-Oder' zeugt von der menschlichen Unfähigkeit, der essentiellen Relativität der menschlichen Dinge ins Auge zu sehen, zeugt von der Unfähigkeit, die Abwesenheit eines höchsten Richters hinzunehmen." |
||||
Und so führt uns der Weg über die Existenzphilosophie wieder zurück zu Kafka, dessen Texte für Kundera gerade diese Relativität verkörpern. Entsprechend deutlich spricht sich Kundera daher etwa gegen eine Lesart Kafkas aus, die metaphysischen Trost innerhalb einer theologischen Deutung seiner Texte anbietet. Einer solchen Interpretation zufolge steht die "wahre Realität" der Menschen hinter ihrer physischen. Und platonisch gewendet lautet Kafkas Kurzform des Höhlengleichnisses dann so: Menschen in ihrer physischen Existenz sind nur Projektionen auf dem Bildschirm der Illusionen. Die beiden Helden, der Landvermesser K. und der Prager Ingenieur, sind Schatten ihrer Karteikarten. Schlimmer noch: Sie sind Schatten eines Irrtums in einer Akte und haben nicht einmal das Recht auf ihre schattenhafte Existenz. Theologische Deutungen haben diese Skizze ausgebaut und Kafkas Romane als religiöse Parabeln gedeutet. Im Ansatz operiert die Logik dieser Deutung folgendermaßen: Wenn die irdische Wirklichkeit nur schattenhaft ist, dann muß die wahrhaftige Wirklichkeit im Un- bzw. Nicht-Menschlichen, im Unzugänglichen oder Übermenschlichen liegen. Kundera sieht das als eine Fehlinterpretation an. Kafka spricht nicht in einer allegorischen Darstellung zu uns, sondern beschreibt eine konkrete menschlicher Situation. Ich möchte hinzufügen: eine religiöse Interpretation verharmlost die Kafkasche Zuspitzung einer ausweglosen Situation, indem sie metaphysischen Trost anbietet. |
||||
Kundera gewinnt der religiösen Deutung trotzdem in einer intelligenten Beobachtung etwas ab. Sie ist aufschlußreich, denn überall, wo die Macht sich vergottet, schafft sie ihre eigene Theologie. Wenn die Macht wie ein Gott auftritt, ruft sie religiöse Gefühle hervor. Das wissen und nutzen Diktatoren ebenso wie die Manager von Teeniebands. |
||||
Politik: Vom Zeitalter sozialistischer Diktaturen zur Zeit der Imagologen | ||||
Menschen streben nicht nur in einem schwachen Sinn nach Unsterblichkeit. Die große Unsterblichkeit besteht in den Taten und Werken, durch die ein Mensch noch nach dem Tod zu den Menschen spricht: durch künstlerische Werke und historische oder sonstige Taten, derer die Menschen sich erinnern. Der Drang der Menschen nach Unsterblichkeit, diese Sehnsucht wird von Ideologen mißbraucht, die Menschen in einer Bewegung die Überwindung der Einsamkeit im Kollektiv versprechen. Wie mißbrauchen Ideologen in Der Scherz menschliche Sehnsucht? Ludvík schickt folgende Postkarte an seine Freundin Marketa: "Optimismus ist Opium für die Menschheit. Ein gesunder Geist stinkt nach Dummheit! Es lebe Trotzki! Ludvik!" (Der Scherz, S. 41) Neben den provokanten Formulierungen besteht der Scherz darin, daß Ludvík mit allen politischen Aussagen, die ihm seine Freundin vorher schriftlich mitgeteilt hat, einverstanden ist, aber sich dafür rächen wollte, daß sie glücklich und zufrieden ist, während er sich nach ihr sehnte. Die Partei fällt von Ludvík ab, seine Freundin wird aufgefordert, sich von ihm zu trennen. Ludvík wird außerdem der Schule verwiesen und zum Militär eingezogen. Er ist ein Feind des Sozialismus, weil er als solcher behandelt wird und jedes Dementi verstärkt diese Feindschaft. Ähnlich wie bei Kafka führt das Komische ins Zentrum des Aussichtslosen. Angesichts der Folgen, die das Absenden einer Postkarte hat, kann man nicht sagen, daß "alles nur ein Mißverständnis war". Wie im Christentum, das auf Angst vor der eigenen Sündhaftigkeit beruht, findet Ludvík nach "selbstkritische[r] Gewissensforschung" seine Schuld. Er meint, gerecht bestraft worden zu sein. Junge, intelligente Menschen glauben an ein Regime, an den Erfolg des Sozialismus, auch an die bevorstehende Revolution in Westeuropa, sie sind begeistert und legen sich ständig Rechenschaft gegenüber ihren Genossen und der Partei ab. Nur wenn Menschen sich ihrem Wesen nach und nicht nur aus Entschluß mit der Partei identifizieren, wenn sie echte proletarische Revolutionäre sind, dann sind die keine Individuen mehr, sondern ganz die Partei. Das politische System, in dem Kunderas Scherz spielt, fordert die Selbstaufgabe des Einzelnen. Wer als ganzer Mensch der Partei gehört und dann einen Fehler wie Ludvík begeht, ist eben kein Mensch, der einen Fehler begangen hat, sondern kein Mensch mehr, der in der Binnensicht dieses Sozialismus im System leben kann. Er hört auf, Mensch zu sein und ist ein Feind der Partei. Wieder sehen wir, was Kundera mit dem "anthropologischen Skandal" meint, von dem weiter oben die Rede ist. Was für Ludvíks tägliches Leben daraus folgt, sehen wir im nächsten Abschnitt. |
||||
Wenden wir uns vorher dem Zeitalter nach dem Zusammenbruch des Sozialismus zu. Im postideologischen Zeitalter, nach dem Ende der mächtigen politischen Ideologien, treten nach Kundera die Imagologen, die Manipulatoren der öffentlichen Meinung, an die Stelle der Diktatoren (der Partei, ihrer Funktionäre usw.). Es existiert nur das, von dem in den Massenmedien behauptet wird, daß es existiert. Im Gegensatz zu den Zeiten des Sozialismus leben wir danach, so Wolfgang Welsch und andere Ästhetiker, im Zeitalter der Ästhetisierung des Alltäglichen. Während in den Diktaturen des Sozialismus wenigstens von "Wahrheit" die Rede war, ersetzt heute das Ästhetische Wahrheit oder dringt mindestens "in den Kern von Wahrheit" ein (Welsch). Harmloser: Es existiert nur das Bild des jeweiligen Teils der Wirklichkeit, das gezeigt wird. Ein tausendmal bearbeitetes, geschnittenes, verzerrtes, zu Reklameslogans verkürztes Bild. Ich möchte hinzufügen: ein Bild, das Kraft der Wiederholung unsterblich wird. Wir brauchen uns an Bilder nicht zu erinnern, wir tragen bestimmte Bilder in uns. Das heißt, wir assoziieren nicht frei, sondern medial konditioniert. Moderne Politiker wissen das. Schlichtes Denken, Denken in Klischees und die Wirklichkeit in Klischees sind die Stichworte, die etwa der Publizist und Journalist Karl Lüönd liefert und die jeder am heimischen Fernseher nachvollziehen kann. Politische Führer sind genauso Meister des Gesinnungskitsches wie viele der medial Erfolgreichen. Sie müssen überzeugen und tun dies durch gnadenlose Komplexitätsreduktion, Verpackung statt (und als) Inhalt und mittels Kitsch. Lüönd beschreibt diesen Typus so: "Sein Merkmal ist das Wiederholte und Aufgekochte, vorgetäuschte Originalität, simulierte Echtheit -- und hemmungslose Unterordnung unter einen Zweck: Ertrag und Wirkung." Um es mit Kundera zu sagen: "Die Aufgabe des erfolgreichen Politikers besteht darin zu gefallen, und zwar der größtmöglichen Anzahl von Leuten. Um das zu erreichen, muß er auf die Klischees zurückgreifen, die sie hören wollen." Wie gewinnen Politiker Mehrheiten? Indem sie Menschen überzeugen, die ihren Plänen nicht zustimmen würden, wenn sie diese im Detail kennen würden. Der jüngste US-Wahlkampf war der Triumph der Trivialisierung und Verkitschung. Politik gefällt niemandem, aber ein glückliches Familienleben erweckt Vertrauen. Symbole, Verpackung und Botschaften, die jeder versteht, möglichst inhaltsfrei dargeboten: So funktioniert politischer Kitsch. (Siehe dazu auch wieder das Gespräch zwischen Kundera und McEwan). |
||||
Kontingenzbewältigung als Aufgabe von Kunderas Figuren | ||||
Kehren wir zu Ludvík zurück. Der Verurteilte empfindet Ekel gegenüber dem Verkehr mit einer Prostituierten. Dieser Ekel stammt aus der Erkenntnis und der damit verbundenen Wehmut über die Gewöhnlichkeit seiner Situation. Ludvík erkennt, daß |
||||
"dies (die Möglichkeit zu einer Prostituierten zu gehen und Erhabenes wie Vulgäres zu erleben, T.S.) zur charakteristischen, fundamentalen und gewöhnlichen Situation meines jetzigen Lebens geworden war. Daß dadurch das Umfeld meiner Möglichkeiten genau begrenzt, der Horizont des Liebeslebens, das nunmehr meines sein würde, genau bezeichnet war. Daß diese Situation nicht ein Ausdruck meiner Freiheit (wie ich es hätte auffassen können, wäre mir das ein Jahr früher zugestoßen), sondern ein Ausdruck meiner Determiniertheit, meiner Beschränktheit, meiner Verurteilung war. Und ich bekam Angst. Angst vor diesem erbärmlichen Horizont, Angst vor diesem Schicksal [...]". |
||||
Hier wird klar, was Kundera mit dem Gefangensein in der Geschichte meint. Die große Geschichte greift über den Umweg der Partei, der Gegebenheiten des Sozialismus usw. ins Schicksal des Einzelnen ein, vereinnahmt dieses Schicksal und bestimmt es. In diesem Sinn ist Ludvík in der Geschichte gefangen. Wer das "Lenkrad der Geschichte" nicht in der Hand hielt, für den gab es kein Leben, sondern nur "Vegetieren, Langeweile, Verbannung, Sibirien", schreibt Kundera in Der Scherz. Ludvík findet sein Leben bald angenehmer und lebenswerter dank Lucie, einer jungen Frau, die ihn liebt. |
||||
Auch in den späten Werken Kunderas fehlt seinen Figuren ein umfassender Trost, den etwa Gott, Geschichte oder eine unsterbliche Seele liefern könnte. Die moderne Welt ohne Gott, die Welt des Rationalismus, ist eine hermetisch abgeschlossene Welt ohne Transzendenz, in der selbst die Sprache nur sich selbst reproduziert. An die Stelle der zum Fetisch stilisierten Gesetzmäßigkeit tritt das Zufällige. Überall stoßen die Helden der Romane Kunderas auf die vervielfältigten Grenzen. Sie sehnen sich nach Überwindung durch Liebe, die Rückkehr zum Mythos, zu einer vorphilosophischen Welt, zum reinen Sein, doch Kundera versagt ihnen die Erlösung. "[Der] Erzähler läßt sie ohne Erlösung sterben, zufällig, durch einen Tod ohne Ernst und Tragik. Agnes (Die Unsterblichkeit) stirbt zufällig auf der Straße [...]", formuliert Chvatik dies in Die Fallen der Welt. In Die Unsterblichkeit wird so deutlich, daß sich Kundera als Erzähler danach sehnt, Menschen in einer Welt gültiger Werte, voller Ordnung mit sich selbst und im Einklang mit einem reinen Sein vorzufinden. Diese Sehnsucht wird enttäuscht und nicht durch eine neue skeptische Metaphysik aufgehoben. Selbst wenn, um mit Kundera zu sprechen, im Leben kein Glück liegt, wenn kein Glück darin liegt, "dieses schmerzende Ich durch die Welt zu tragen", dann können wir uns doch würdig erweisen, diese Sehnsucht zu ertragen. |
||||
Erforschung der Existenz | ||||
Kundera ist kein Philosoph im engeren Sinn. Das ist weder eine Auszeichnung noch ehrenrührig. Er greift existenzphilosophische Themen wie die Kontingenz des Daseins, seine Zufälligkeit und das Leben des modernen Menschen in einem Universum ohne Gott auf. Für Kundera gehören die Befindlichkeiten, die Existenzweisen seiner Figuren und ihre Gefangenschaft in der Geschichte zusammen. Als moderne Menschen sind ihnen Selbstverständlichkeiten abhanden gekommen. Ihrer Individualität hat sich in einem bürokratisierten, entmenschlichten Universum eine Maschinerie angenommen, die wir Partei oder Sozialismus nennen können. Mit dem Ende des Sozialismus, der wie alle Diktaturen einen anthropologischen Skandal offenbart, haben die großen Fragen menschlicher Existenz nicht etwa ihre Spitze und Bedeutung verloren. Hier liegt eine Stärke des Romanciers Milan Kundera. Sein umfassendes Bild menschlicher Existenz kreist um Tod, menschliches Sein, Liebe und Sexualität, Entfremdung in der Welt, Sehnsucht nach Einssein mit sich und der Welt und um die menschliche Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Dabei kann und will Kundera kein Philosoph sein, auch wenn er philosophisch Bedeutsames schreibt. Ein wichtiger Erforscher menschlicher Existenz ist er dennoch. |
||||
|
autoreninfo

Thomas Sukopp arbeitet am Seminar für Philosophie der TU Braunschweig (Deutschland). Er studierte Chemie, Philosophie, mittelalterliche und neuere Geschichte. Momentan promoviert er in Philosophie mit einer Arbeit über antinaturalistische Argumente in Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Seine philosophischen Schwerpunkte liegen in naturalistischer Ethik, Philosophie der Menschenrechte, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie.
Veröffentlichungen:
Menschenrechte: Anspruch und Wirklichkeit, Marburg: Tectum 2003. -- Was ist und was leistet Menschenwürde? In: Philosophia Naturalis 41 (2), 2004, 315-351. -- Against Quine? Probleme eines Naturalisten: Wahrheit, Normativität und die Rolle der Evolution. In: prima philosophia 18 (2) 2005, 133-148.
Homepage: http://www.thomas-sukopp.de E-Mail: thomas.sukopp@gmx.de |
||||
|
|