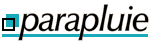
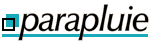 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 25: Übertragungen
|
Versuch über das UnübertragbareDie Allmacht der Übertragung und die Inseln der Rebellion |
||
von Susanne Göße |
|
In der spätkapitalistischen Massengesellschaft ist Übertragbarkeit zum Herrschafts- und Kontrollinstrument geworden, dessen Mechanismen sicherstellen, daß sich nichts den Gesetzen des Marktes entziehen kann. Was übertragbar ist, ist austauschbar, läßt sich mit einem finanziellen Gegenwert versehen und kann somit vermarktet werden. Verloren gehen so Individualität, Freiheit und jene unübertragbaren Werte, die sich nur noch in einem Prozeß sozialen und kulturellen Widerstandes retten lassen. |
||||
Am Anfang des Überlegens steht die Übertragung -- ein Begriff, dem es an Weite nicht mangelt, ein Sammelbecken von liebevoller Aufnahmebereitschaft, in dem Vieles zusammenfindet, mit oder ohne inneren Zusammenhang: Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen an Genen, Molekülen oder Tieren werden auf den Menschen übertragen, Übertragung ist ein zentraler Begriff in der Psychoanalyse und in den Rechtswissenschaften, Organe werden übertragen, Texte von einer Sprache in die andere, Viren von Lebewesen zu Lebewesen oder von Computer zu Computer, Musikclips, Navigationshilfen, Bibliotheken, 'real life' Konzerte, Fußballspiele, Katastrophen, Revolutionen, Know-how und Kriege können weltweit via Internet, TV, Handy übertragen werden. Alles scheint in alles übertragbar, Ströme von Daten, Waren, Geld und Energie werden rund um den Erdball ununterbrochen produziert und transferiert, eine unvorstellbares, allgegenwärtiges dicht gesponnenes Netz von Übertragungen, das uns umgibt und in dem wir uns bewegen. Wo so viel Machbarkeit, so viel Möglichkeit ist, verstellt diese Totalität vielleicht nur den Blick für das Unmögliche, nicht Machbare. Was sperrt sich gegen die Allmacht des Übertragbaren? Was läßt sich nicht übertragen? |
||||
Und da kommt einem doch spontan einiges in den Sinn: Träume, Gedanken, Gefühle, Leben, Tod. Gedanken sind (jedenfalls noch) nicht übertragbar -- es wäre das Ende der Lüge -- und auch Gefühle nicht. Selbst der Mitfühlendste kann nie genau das Gleiche empfinden wie ich im selben Moment, z.B. Schmerzen oder auch Liebe, sonst gäbe es keine unerwiderte Liebe mehr. Mein Leben ist nicht übertragbar, ich kann es nicht weitergeben oder das eines anderen erhalten. Auch mein Tod wird allein meiner sein, ich kann ihn nicht abgeben oder austauschen; ist die Schwelle einmal überschritten, kann ich nicht einmal mehr irgendeine Erfahrung davon anderen vermitteln. |
||||
Diese erste kleine Sammlung deckt sich im wesentlichen mit den Überlegungen Schleiermachers in seiner Güterlehre. Leib und Leben sind für ihn das "völligst abgeschlossene und unübertragbarste Eigentum", Gefühl, Individualität, das Beharrliche, Substantielle, Eigentümliche gehören in die Sphäre des Unübertragbaren. Das Wesen des Übertragbaren ist dagegen Trennung und steter Wechsel, Gemeinschaft und Gespräch. Das ideale Medium der Übertragung ist für Schleiermacher das Geld. Es läßt sich beliebig trennen, ist damit beliebig übertragbar und prädestiniert als Mittel des Tausches. Je größer die Affinität zum Geld, desto mehr nehme jedoch das Individuelle ab, denn "je weniger Individualität, desto weniger Anhänglichkeit an festes Eigenthum, sondern nur an Geld", so Schleiermacher im Brouillon zur Ethik. Anders ausgedrückt: Was sich nicht trennen läßt, was also eine untrennbare Einheit, eine Ganzheit, darstellt, ist unübertragbar. Wer nur ans Geld denkt, wird gleicher gemacht. Gleiches ist übertragbar und austauschbar. Zum Unübertragbaren gehört das Nicht-Austauschbare, Nicht-Ersetzbare, das Nicht-Gleiche, das Andere, Verschiedene, die Differenz -- als das, was den Menschen ausmacht. |
||||
Auch Simmel betont in der Tradition Schleiermachers diese Differenz, denn es komme darauf an, "daß man dieser bestimmte und unverwechselbare ist", der " Akzent des Lebens und der Entwicklung" liege nicht auf dem Gleichen, sondern auf dem "absolut Eigenen". Im Gegensatz zu Schleiermacher, der Übertragbares und Unübertragbares noch als zwei "oscillierende" Gegenpole im Gleichgewicht sah, sieht Simmel die Balance durch die fortschreitende Vergeldlichung der Gesellschaft schon zerstört und die Seite des Unübertragbaren, der Differenz, dadurch empfindlich bedroht: Indem "das Geld alle Mannigfaltigkeiten der Dinge gleichmäßig aufwiegt, alle qualitativen Unterschiede zwischen ihnen durch Unterschiede des Wieviel ausdrückt, indem das Geld [...] sich zum Generalnenner aller Werte aufwirft, wird es der fürchterlichste Nivellierer, es höhlt den Kern der Dinge, ihre Eigenart, ihren spezifischen Wert, ihre Unvergleichbarkeit rettungslos aus." Diese Entwicklung sieht er letztlich ins Ende des Individuums münden. |
||||
Es ist die Frage, ob wir am Ende dieser Entwicklung angekommen sind. Heutzutage dringt das Übertragbare in immer stärkerem Maße in die Bereiche des Unübertragbaren ein, und engt damit den Bereich des Individuellen immer mehr ein. Der eine Grund dafür ist, daß unsere Gesellschaft in einem Grade durchkommerzialisiert ist, wie dies noch zu Simmels Zeiten undenkbar gewesen wäre -- auch ehemals unantastbare Güter werden inzwischen auf ihren Geldwert nivelliert und objektiviert. Die Frage "Was ist etwas wert?" wird in klingender Münze beantwortet, ethische, moralische oder personale Werte spielen kaum noch eine Rolle. Es bleibt als letztes die Gier. Was keinen Geldwert hat, ist wertlos und wird entsprechend behandelt. Was einmal in Geldwert umgerechnet ist, hat zwar einen Wert, ist aber zur Ware degradiert, wird taxiert und gehandelt: Verwertung entwertet. Dafür gibt es viele Beispiele, nur ein paar seien hier angeführt: Die Natur wird in Dollar umgerechnet, damit sie überhaupt einen Wert hat, um wenigstens so weitere gnadenlose Ausbeutung zu verhindern. Dafür kann man sich jetzt von Luftverschmutzung durch Regenwaldzertifikate freikaufen. Noch für Brecht war der Begriff des Kunstwerks nicht zu halten für ein Ding, das entsteht, wenn ein Kunstwerk zur Ware verwandelt wird. Heute zählt ein Ding gar nicht mehr als Kunstwerk, wenn es nicht auf dem Markt möglichst hoch gehandelt wird. Simmel legte Wert auf die Feststellung, daß mit Geld nur wirtschaftliche, nicht aber persönliche Werte oder gar Personen gemessen werden können. Das heutige Recht, wie Stefan Meder bemerkt, spricht ganz selbstverständlich "Geldersatz für 'entgangene Urlaubsfreuden', Ehrverletzungen, [...] 'Kind als Schaden', Persönlichkeitsrechtsverletzungen" zu. Unser Leib, einst "unübertragbarstes" Gut, läßt sich inzwischen durchaus gewinnbringend als Ersatzteillager für Organübertragungen nutzen. Offizielle Organbanken können die Nachfrage nach Herzen, Lebern, Nieren u.v.m. nicht befriedigen, so daß inzwischen weltweit ein Schwarzmarkt für Nieren entstanden ist. |
||||
Der andere Grund für das Überhandnehmen der Übertragung ist die stetig fortschreitende Technik, die Übertragungen in einem Ausmaße und einer Qualität ermöglicht, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Lassen sich daraus weitere Merkmale des Übertragbaren ableiten? Gehen wir vom Ideal aus, sollte die vollkommene Übertragung in der richtigen Reihenfolge, ununterbrochen und ohne Verlust ankommen. Leider ist Übertragung ohne Verlust nicht zu haben. Auch die idealste ist immer ein Prozeß der Veränderung -- was die Übertragung zunächst von der Wiederholung oder Kopie unterscheidet. In diesem Prozeß der Verwandlung liegt genau die Stärke der Übertragung. Die Kopie ist sklavisch an das Original gebunden, die Übertragung enthält dagegen ein schöpferisch-umformendes Element.; was ein Moment der Freiheit gegenüber dem Original schafft. Übersetzungen wären laut Benjamin gar nicht möglich, "wenn sie Ähnlichkeit mit dem Original anstreben" würden; Novalis sah in den "verändernden Übersetzungen" sogar den "höchsten poetischen Geist" walten. Der Preis, der für diese Freiheit, für dieses kurze Aufscheinen schöpferischer Kraft zu zahlen ist als Mahnung an die Schattenseite des Übertragens, ist der Verlust. Im Zeitalter der Datenübertragung, der virtuellen Welten schrumpft durch die immer ausgereiftere Technik das schöpferische Moment naturgemäß immer mehr, das Verändernde soll möglichst gering gehalten werden und mit ihm der Verlust. Planung, Vorhersehbarkeit, Berechnung werden vorherrschend. Angestrebt wird das perfekte Duplikat, am besten in Echtzeit. Ginge jedoch das angestrebte Ideal der totalen Übertragung in Erfüllung, wären wir sehr nahe an der Wiederholung, der endlosen Wiederholung des Ewiggleichen. Mit dem Versuch, den Verlust auszumerzen, geht nicht nur das Schöpferische im Moment der Veränderung, diese Freiheit und Selbstbestimmtheit im Moment der Schöpfung verloren, es soll auch das Dunkle, Schattenhafte, den Tod vergessen lassen, der jeder Übertragung innewohnt: Es gibt keinen Weg zurück. Wir gehen immer mit Charon auf die letzte Reise. |
||||
Die Vergeldlichung als deutlichste Form der Berechenbarkeit und mit ihr die Objektivierung auf rein wirtschaftliche Werte und die zunehmenden Möglichkeiten der Übertragungstechnik, die in fast allen Bereichen des Alltags und des Privaten Einzug gehalten haben, führt zu einer ungehemmten Ausbreitung des Übertragbaren in alle Lebensbereiche, auch die persönlichsten, privatesten, die früher nur als unübertragbar, absolut eigen und unantastbar zu denken waren. Diese Entwicklung ist im Kern nivellierend, sie ist ein Gradmesser für den Verlust des Individuellen in unserer Kultur, die immer mehr eine der wachsenden Angleichung und Anpassung ist. Eine Welt, in der für Eigenes, Individuelles, Anderes kein Platz ist. Das Ideal ist nicht die Differenz, sondern das Gleiche, das jederzeit Ersetzbare und Austauschbare. Es geht um Produktion des Ewiggleichen, als Uniformität, Konformität, Funktionalität, abwechselnd immer neu verpackt als Trend, Mode, Themenwelle. Wenn Leben und Entwicklung die Differenz braucht, dann zeigt sich hier eine Entwicklung zu Erstarrung und Stillstand. |
||||
Übertragungswiderstände | ||||
Dieser Entwicklung als Gegenpol entgegenzuwirken, wird der Kunst als gesellschaftliche Aufgabe zugewiesen. Sie soll diesen Übertragungsmechanismus stören, um so die Illusion von Lebendigkeit zu erzeugen. Kunst erhält Ventilcharakter, sie stellt ein Reservoir des gesellschaftlich erlaubten Außen dar. Diesem Außen kommt Illusionscharakter zu, da seine Gegenentwürfe und Störfeuer gegen die Übertragbarkeit von der Übertragungsindustrie immer wieder vereinnahmt werden, sei es als 'Ausstellung', sei es als 'Ware'. Wo die Kunst im Superlativ gefeiert wird, ist sie am gefährdetsten. Daher sucht die Kunst Wege, sich ihr eigenes, selbstbestimmtes Terrain zu erobern, sich ihrer Übertragbarkeit zu entziehen. Warum aber dieser Widerstand gegen das Übertragen-werden? Die Antwort ist einfach: Übertragene Kunst ist -- streng genommen - keine Kunst mehr, denn das, was ein Kunstwerk ausmacht, ist unübertragbar. Benjamin beschreibt diesen Vorgang schon sehr früh anhand der Folgen der technischen Reproduzierbarkeit für das Kunstwerk: Es verliere seine "Aura", d.h. seine Einzigkeit, sein Hier und Jetzt, seine Authentizität und seine Autorität, die auf seiner Eingebundenheit in die Tradition und seiner Herkunft aus dem Ritual beruhten. Den Begriff der Reproduktion auf den der Übertragung hin erweiternd, vergrößert sich der Verlust zur Vernichtung: die Art der Übertragung bestimmt, was ein übertragenes Kunstwerk zu sein hat. Das Übertragungsmedium übernimmt die Herrschaft über das Kunstwerk und bestimmt das Endprodukt. So wie Theater im Fernsehen kein Kunstwerk mehr ist, sondern zu einer schlecht gemachten Fernsehsendung herabsinkt. |
||||
Benjamin erweitert den Begriff der "Aura" hin zu einer Kulturkritik und konstatiert einen "gegenwärtigen Verfall der Aura", was er auf zwei Faktoren zurückführt, die mit der zunehmenden Bedeutung der Massen zusammenhängen. Die Masse wolle sich die Dinge "räumlich und menschlich näher bringen", und sie tendiere zur "Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit" durch die Aufnahme von deren Reproduktion. Die medientechnische Vollzeitberieselung in unserer Massengesellschaft und die bei jeder Gelegenheit gezückten Fotoapparate oder Digicams zur Archivierung jedes noch so unbedeutenden Ereignisses bestätigen die Weitsicht von Benjamins Thesen in geradezu erschreckendem Maße. Sie weisen aber auch sehr klar auf eine weitere Schwierigkeit hin, unter der die Kunst im Zeitalter der Massenunterhaltung zu leiden hat, und die sich noch einmal am Beispiel des Theaters im Fernsehen verdeutlicht. Das Fernsehen ist Unterhaltung für die Massen und erfüllt ihr Bedürfnis nach Nähe in zweierlei Hinsicht: Es findet in den eigenen vier Wänden statt, und die Kamera fungiert stellvertretend für den Zuschauer wie ein nahes, heimliches Auge. Fernsehen ist damit prädestiniert als das Medium für Tratsch, Geschwätz und Voyeurismus. Theater braucht die Distanz, als ursprüngliches Spiel für die Götter hat es zwischen Zuschauer und Schauspieler den Abstand gelegt. Die erzwungene Distanzlosigkeit im Fernsehen erniedrigt das Theater, die große, bedeutungsvolle Geste kippt ins Lächerliche. |
||||
Diesem Verlust konnte Benjamin immerhin noch etwas Positives abgewinnen, nämlich den Aspekt der Befreiung: Die technische Reproduzierbarkeit emanzipiere das Kunstwerk von seinem "parasitären Dasein am Ritual", das reproduzierte Kunstwerk werde immer mehr die "Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerks". Tatsächlich sind Tendenzen des Spiels mit der eigenen Reproduktion in der Kunst mit dem zunehmenden Konsumismus ab den 1960er Jahren aufgekommen, man denke an die Pop-Art und Andy Warhol. Damit hatte sich aber die Wahrnehmung, was Kunst ist, auch im ganzen geändert. Noch zehn Jahre vorher wären Warhols Bilder gar nicht als Kunstwerke angesehen worden, sondern als Gebrauchsgrafik. Andy Warhol stellte dazu lapidar fest: "Gleichgültig, wie gut du bist, wenn du nicht auf die richtige Weise vermarktet wirst, wird sich niemand an dich erinnern". Hier zeigte sich erstmals eine Parallellsetzung des Künstlers mit einem Konsumartikel: Wichtig ist das richtige Marketing. Dennoch konnte der Künstler noch glauben, das Spiel zu kontrollieren, wenn er die Übertragungsmechanismen, gerade auch der medien- und marktgerechten Verwertung und Verbreitung, durchschaut hatte. |
||||
Inzwischen haben die Übertragungsmechanismen die Kontrolle übernommen, die Zeiten des Spiels und der ironischen Kommentierung sozialer Übertragungen sind vorbei. Tatsächlich begibt sich ein großer Teil der Kunst in die Unterordnung, wenn mit den üblichen sozialen Ausschlußverfahren -- allen voran Geldentzug als Wegdrücken in die gesellschaftliche Wertlosigkeit - gearbeitet wird. Diese Kunst läßt sich widerspruchslos in Kunstprodukte zerteilen, vermarkten und in die Übertragungswege einspeisen, die bestimmen, in welches Stereotyp sie einzusortieren ist: 'Neue Wilde', 'Neo-Dada' usf. Verknappung der Mittel bei gleichzeitiger Verringerung von Einnahmequellen jenseits der gesellschaftlichen Institutionen führt zum sogenannten Sponsoring, bei dem Unternehmen und damit der kapitalistische Markt Zugriff auf die Kunst bekommen und diesen auch zu nutzen wissen. Wie die sozialen Übertragungen als Herrschaftsmechanismus funktionieren, läßt sich in diesem Bereich geradezu paradigmatisch ablesen. Der Markt bestimmt, was Kunst ist. So heißt es in einer Pressemitteilung der Semperoper Dresden von seiten ihres Sponsors VW: "In den gemeinsam erarbeiteten Formen unserer Zusammenarbeit sehen wir die konsequente Umsetzung der Werte der Marke Volkswagen." |
||||
Übertragung ist Okkupation, und Kunst darf den Hofnarren machen. Die konventionellen Übertragungsmechanismen ihrer gesellschaftlichen Rezeption, die sich durch die Massentauglichkeit als Event im Traditionellen konserviert hat, sind Strategien der Vereinnahmung und Unterordnung. Wo ist da die Verbindung von Verlust und Freiheit, in einer Zeit, die sich alles als kommunizierbar, konsumierbar, reproduzierbar aneignet? Was bleibt von der Freiheit, wenn sich der Übertragungsverlust zur Vernichtung ausgeweitet hat? Freiheit als nothing left to lose? |
||||
Will Kunst sich der Fremdbestimmung entziehen, muß sie sich ständig neu aus dieser Umklammerungen befreien. Das Spiel mit dem Unübertragbaren ist auch ein Kampf gegen das Herrschaftsinstrument Übertragung. Der Preis dafür ist eine gewisse Marginalisierung: Diese Kunst erreicht meistens nur noch ein relativ kleines Publikum. Neue Musik experimentiert schon lange mit dem Widerstand gegen die Allmacht der Übertragungen auf der Rezeptions- wie der Reproduktionsebene. Zeitgenössische Kompositionen enthalten "etwas Unkalkulierbares, Irreduzibles", so Johannes Bauer, sie lasse sich nicht mehr in die starren Vorgaben von Notationssystemen übertragen, neue Musik sei eher "offen interpretierbar als komprimierbar". |
||||
Zusammengefaßt: Zur Übertragung gehört das Berechenbare, Vorhersehbare, Kalkulierbare, Funktionale, Ankommen und Erreichbarkeit. Wer über das Wie der Übertragung bestimmt, besitzt die Deutungshoheit und damit die Macht. Übertragung schließt Verfügbarkeit mit ein, und Verfügbarkeit ist ein Kennzeichen der Unterordnung. In der Kunst werden daher bewußt eingesetzte Formen des Nicht-Ankommens, des Entziehens, der Nicht-Funktionalität immer wichtiger. Formen der Unverfügbarkeit, sich diesem Herrschaftsmechanismus zu entziehen, sind ein Ausreizen der Möglichkeiten des Unübertragbaren oder gezielte Störungen der Übertragung, mit denen die Kunst experimentiert. Deren Qualitätsmerkmal kann man als "maximale Unschärfe" bezeichnen: bewußt nicht mehr greifbar sein. Das Willkürliche, Zufällige, Spontane, Unkalkulierbare, Unabschließbare, Nicht-Wiederholbare gehören zum Bereich des Unübertragbaren, entziehen sich jeglicher Vereinnahmung und schaffen so Refugien der Selbstbestimmtheit, Inseln der Rebellion, bieten aber auch immer wieder Anlaß für neuerliche Vereinnahmungen. Freiheit wird, wie sie der chinesische Dichter Bei Dao definiert, zum "Abstand zwischen Jäger und Gejagtem". |
||||
Kunst ist dabei nicht mehr nur der Bereich der Künstler, die Kunstwerke produzieren, sondern ein sehr großer, gesellschaftlicher Komplex von künstlerisch-kreativen Berufen und Lebensentwürfen aller Art. Arbeit und Leben ist in ihm vorgeblich freier und individueller gestaltet, scheint von Zweckrationalität und Funktionalität freier zu sein als andere Bereiche. Tatsächlich bezahlt der Einzelne den Preis dafür durch Selbstausbeutung. Das nicht-monetaristische, nicht-materialistische Ideal, das die Kreativen als Gegenentwurf gegen den als bedrohlich erlebten Kapitalismus verstehen, führt tatsächlich dazu, sie noch stärker auszubeuten und ihnen den Zugang zu allen kostenintensiven, sozialen Errungenschaften zu verweigern. Die übergeordneten, gesellschaftlichen Verwertungsinstitutionen schöpfen den erwirtschafteten Mehrwert ab, während die Urheber der kreativen Leistungen in unsicheren, rechtlosen Verhältnissen leben und das neue 'Prekariat' bilden. Die permanente existentielle Bedrohung und der hohe Konkurrenzdruck läßt den Gedanken an Widerstand gar nicht erst zu und ist durch die Vereinzelung der Existenzen auch kaum möglich. |
||||
Der Mensch in der Übertragungsmaschine | ||||
Die prekäre Existenz, dauernd bedroht vom gesellschaftlichen Absturz, ist ein vertrautes Phänomen geworden und eine Begleiterscheinung einer großen Systemkrise, die wir einer auf den ersten Blick gelungenen Übertragung von Ideologie verdanken. Durch ein Klima der Angst wurde die Ökonomie über das Schreckgespenst der Globalisierung zur neuen Heilslehre. Alle Bereiche des Lebens wurden ökonomischem Denken unterworfen: Kosten-Nutzen-Rechnung. Funktionalität, Mobilität, Flexibilität. Die Erwerbsbiografien verlangten Anpassung und Gleichschritt, ohne dafür Sicherheit zu geben. Während der Erwerbstätige für die Unternehmen immer berechenbarer werden muß, wird das Leben des Erwerbstätigen durch die Unternehmen immer unberechenbarer. Das Ideal wird der bindungslose Arbeitsnomade, schnell zu verunsichern und leicht lenkbar, der jeden Kollegen als Konkurrenten sieht und in dauernder Angst vor Kündigung lebt. Private Lebensentscheidungen und soziale Verpflichtungen, ob Eheschließung, Kindererziehung, Alten- und Krankenpflege, wurden ebenfalls dem Diktum ökonomischer Vernunft unterworfen, auf eine Kosten-Nutzen-Rechnung reduziert. Die irreduzible Dimension des Menschseins, die auf familiärer und sozialer Bindung und Verantwortung ruht, schrumpfte zum 'emotionalen Faktor'. Angst in allen ihren Formen wurde das vorherrschende gesellschaftliche Grundgefühl. Gemäß neuester Studien avancierte Angst in Verbindung mit Depression innerhalb kürzester Zeit zur vierthäufigsten Todesursache in den westlichen Industriestaaten. Sieht man Depression als nach innen gerichtete Aggression, paßt dazu, daß Konflikte bei der Arbeit nicht mehr im öffentlichen Raum, sondern im Innern ausgefochten werden. Wer seinen Job unverschuldet z. B. durch eine Firmenübernahme verliert, beschimpft sich dennoch selbst als Versager. Die Selbstbeschimpfung ist ein Unterwerfungsgestus, eine Ent-Würdigung. Der nicht-aufgenommene Kampf, der nicht-geleistete Widerstand endet in der Feigheit des Höflings, der meint, durch Schmeicheln und Verstellen doch noch an den Tisch des Herren zu kommen. |
||||
Teilen und trennen gehören zum Wesen der Übertragung und nicht von ungefähr klingt die alte Grundregel des Herrschens, "divide et impera", an. Moderne Bürokratie-, Verwaltungs- und Wirtschaftssysteme haben sie zur effizienten Übertragung von Herrschaftsstrukturen perfektioniert. Die neuen Möglichkeiten der Technik erlauben es, unglaubliche Datenmassen zu speichern, zu nummerieren, zu katalogisieren, bei Bedarf aufzurufen und zu rekombinieren. Der moderne Mensch hat zuerst eine Nummer, erst dann einen Namen. Dem feingeknüpften Netz ineinandergreifender Abhängigkeiten entspricht der immer dichtere Kokon dauernd ankommender Informationen, Sensationen und Sentimentalitäten, den die Übertragungsindustrie um uns herum als Schutzwall gegen die Zumutungen einer sozialen Wirklichkeit, die zunehmend als bedrohlicher und kälter erlebt wird, errichtet hat. Die neotheologische Stellung der Medien mit ihrem gläubigen Publikum ist dabei passende Ergänzung der neokapitalistischen Durchstrukturierung der Gesellschaft. Wie in der Arbeit so auch im Leben hat der Subalterne im dauernden Empfangsmodus zu sein. Der Zusammenfall von Berufs- und Privatleben entspricht der Vermischung von Öffentlichem und Privatem auf allen Kanälen, immer vorne das Internet mit seinen Blogs, Chatrooms und Netzwerken. Die Macht der Übertragungsmedien lenkt inzwischen ganze Staaten, wie Italien und Amerika als Mediendemokratien zeigen. Wer die Übertragungswege besitzt, besitzt die Macht über Meinungen, Moden, Lebensstile, Konsumverhalten. |
||||
Johannes Bauer zieht Bilanz: "Die moderne Gesellschaft ist eine intensive und extensive Übertragungsmaschine von Machtverhältnissen, eine konzertierte Aktion von äußerem Druck und verinnerlichter Kontrolle, die keine Brüche, Irritationen, keine Besinnung, keine Exzentrik des Außerhalb mehr zulassen will. [...] Die Verinnerlichung funktionaler Standards wird durch Dressur und Selbstschutz zu Mündigkeit und Freiheit erklärt." Macht ist aber bei genauerer Betrachtung nicht nur ein Angebot, sondern benötigt auch zwingend der Nachfrage. Die Nachfrage schafft jeder Einzelne, der an die Heilsversprechungen ewigen Glücks durch Konsum als Passepartout für gesellschaftlicher Akzeptanz, Erfolg, Lebenssinn glaubt, sich nach den Bequemlichkeiten der einfachen Lösungen sehnt. Der Einzelne stellt die Verbindung her zur Übertragungsmaschine, erst sein Einverständnis ermöglicht die Übertragung. |
||||
Übertragung funktioniert dabei wie eine Ansteckung auf dem Nährboden sozialer Opportunität. Ein Wissen, das sich inzwischen z.B. das 'virale Marketing' zunutze gemacht hat, bei der, Verläufe von Grippeepidemien simulierend, Werbebotschaften unerkannt wie Viren von den Kunden freiwillig selbst verbreitet werden sollen. Je mehr Leute sich angesteckt haben, desto schneller verbreitet sich die Information. Ist bei der Ansteckungsrate eine kritische Masse einmal überwunden, verläuft die Verbreitung exponentiell und die Chancen für eine Massenepidemie sind groß. Die Übertragungsdichte als reine Quantität ist daher eine wichtige Voraussetzung für die Ausbreitung der Übertragung. Weitere Voraussetzung sind Einfachheit bzw. Reduktion. Meinungen z. B. übertragen sich am schnellsten und effektivsten, wenn sie Widersprüche scheinbar auflösen, einfache Lösungen anbieten, komplexe Sachverhalte vereinfachen, kurz und knapp daherkommen. Komplexität ist eher hinderlich: Alles, was ein Mit-, Nach- und Umdenken erforderlich macht, ist nur bedingt übertragungs(medien)-tauglich. Es läßt sich nur schlecht in kleine Infohäppchen zerteilen, erfordert Zeit und Konzentration, und hat damit wenig Chancen, über die kritische Masse hinauszukommen. So kommt es zu einem Phänomen, das man "Pseudo-Übertragung" nennen könnte. Pseudo-Übertragungen fehlt jenes Verbindende, das eigentlich zur Übertragung als Voraussetzung gehört. Sie ist ein Manipulationsmechanismus. Viele populärwissenschaftliche Veröffentlichungen gehören ebenso dazu wie politische Wahlkampfparolen, die teilweise bis zur Verfälschung vereinfachen. Die Übertragung ökonomischer Theorien auf die komplexe, irreduzible Praxis menschlicher Lebenswelten ist so eine Pseudo-Übertragung, wie sich an den zahlreichen pathologischen Effekten zeigt, die durch sie entstanden sind. |
||||
Second Life | ||||
Zu den Pseudo-Übertragungen lassen sich auch einige der Vorgaukelungen der virtuellen Welt zählen. Übertragungen reichen ja nicht nur in unser Leben hinein, sondern wir sollen und wollen unser Leben auch ins Internet übertragen, wie z. B. in Chatforen, Freundschaftsnetzwerken, Blogs und eben auch im weltweit beliebten Spiel Second Life. Second Life ist eine Entwicklung des Amerikaners Philip Rosedale, für welche er in einem Spiegel-Artikel als "Gott unserer Zeit", als "folgenreichster Weltenerschaffer und Gemeinschaftsstifter seit Moses" gepriesen wird. Rosedale selbst unterscheidet gleich gar nicht zwischen Fiktion und Realität: "Wenn man Dinge verändern kann, wenn sie emotional berühren, dann sind sie auch echt". |
||||
Wenn es also 'echt' ist, kann ich dann im Internet ein besseres, schöneres zweites Leben führen und übertragen sich die dort gemachten Erfahrungen in mein reales Leben, so daß ich im ersten Leben z. B. selbstbewußter, lebensfroher, anziehender werde? Und falls nicht, was ist dann daran echt? Second Life ist tatsächlich ziemlich ernüchternd. Es wird bewohnt von überbegabten, überschönen, letztlich immergleichen virtuellen Ichs. Da es sich um selbstgewählte Wunsch-Ichs handelt, bringt Second Life auf fast erschreckende Weise zwei Thesen zusammen: Die Entwicklung geht von der Differenz weg zum Gleichen. Die äußeren Normen werden verinnerlicht. Daraus folgt, daß alle den Wunsch haben, möglichst nicht von der Norm abzuweichen und gleich schön, gleich begabt, gleich erfolgreich sein wollen. Individualität beschränken sich auf die Auswahl der in Second Life käuflich zu erwerbenden Konsumartikel. Da ist das zweite nicht anders als das erste Leben: Der 'style' ist das, was in unserer Gesellschaft vom Individuellen übrig geblieben ist. Das ist das wirklich Echte daran -- und natürlich das Geld, das man für den Aufbau des Traum-Ichs zu bezahlen hat. Was sich ins reale Leben überträgt, ist die Abbuchung von der Kreditkarte. |
||||
Der Verlust, den unsere Gesellschaft sich wegrationalisieren und wegtechnisieren möchte, bleibt doch im System, er läßt sich nur verschieben, nicht entfernen. Der Verlierer ist das Individuelle, Eigene, die Differenz, die letztlich das Menschliche, das Lebendige ausmacht. Wo die Angleichung aller perfektioniert wird, findet der Mensch nur noch im Verlust seine eigene Identität, seine Verschiedenheit. Im Glück sind alle gleich, man denke an die immer lachenden Gesichter der Werbung, das Unglück ist individuell: jeder hat sein eigenes. Dieser Verlust, der sich z. B. als Gedächtnisverlust oder Wahnsinn äußern kann -- ein in Hollywood-Filmen sehr häufig durchgespieltes Thema -- befreit aus den Zwängen einer Gesellschaft, in der man nur noch Funktion sein muß. Es ist die Freiheit des sozialen Verlierers, die Freiheit des nothing left to lose -- Freiheit in der Negation. |
||||
Differenz ist auch ein Weg des Sich-Entziehens. Man denkt nicht von ungefähr an die ontologische Differenz Heideggers, der an die Stelle des Dualismus von Subjektivität und Objektivität die Differenz setzte, um dadurch den Bereich des Seins dem erkennenden Zugriff zu entziehen. Daß die Differenz sich jeglicher Vereinnahmung entzieht, hat Emmanuel Lévinas konsequent für den Bereich des Menschen weiter gedacht. Unverfügbarkeit macht er ganz an der Andersheit des Anderen fest. Am deutlichsten zeigt sich die Differenz im Antlitz des Anderen, dessen Eigenschaften auch die des Unübertragbaren beschreiben könnten: Bedeutung ohne Kontext, unmittelbar, nackt, maßlos, nicht begreifbar, nicht berührbar, nicht faßbar, und vor allem: Widerstand. Widerstand ist die Behauptung des Rechts auf die eigene Differenz; er bedeutet, Inseln des Unübertragbaren zu finden und zu besetzen. Das kann der Mut sein, sich fallen zu lassen ins Unberechenbare und Willkürliche, die Freude, der Sand im Getriebe sein, das Vertrauen in eigene Werte, Wahrnehmung und Erfahrungen. Es ist die Stimme des Kindes, die sagt: "Der Kaiser ist nackt". Es ist die Freiheit, schneller zu laufen als der Jäger. Eine anstrengende Freiheit. Aber es gibt keinen Weg zurück. |
||||
Für die Einblicke in die Philosophie der Differenz danke ich Dr. Katharina Mai, Stuttgart. |
||||
|
autoreninfo

Susanne Göße studierte Sinologie, Komparatistik (MA) und BWL (Dipl.) in Tübingen, Taipei (Taiwan) und Zürich (Schweiz). Sie verfasste Theaterstücke (Anstatt Rashomon, Stadttheater Ulm; Fest für Liebende in unglücklicher Konstellation, Akademietheater München), Lesungen (Abendstern, München 2003), erarbeitete Konzeption und Dramaturgie für internationale Theaterprojekte (u. a. in VR China, Vietnam) und organisierte deutsch-chinesische Kulturveranstaltungen. Sie übersetzte zeitgenössische chinesische Lyrik (Chinesische Akrobatik -- Harte Stühle, Tübingen 1995, Glasfabrik, Tübingen 1993) veröffentlichte zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften, Anthologien sowie einen Tagungsband (Zeichen Lesen -- LeseZeichen, Tübingen 1999).
|
||||
|
|