Jonathan Barnes debütiert mit skurrilem Kriminalroman
Presseschau vom 6. März 2008
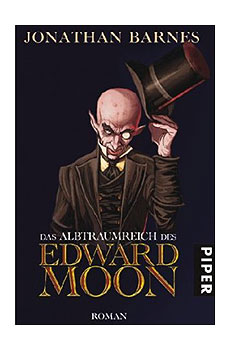 BERLIN (BLK) – Die „FAZ“ beschäftigt sich mit Jonathan Barnes’ Debütroman „Das Albtraumreich des Edward Moon“, die „FR“ rezensiert Bill Bufords „Hitze“. Die „NZZ“ widmet sich dem Erzählband „Bordell der Toten“ von Carlos Eugenio López, und die „SZ“ bespricht Horace Engdahls Textsammlung „Meteore“.
BERLIN (BLK) – Die „FAZ“ beschäftigt sich mit Jonathan Barnes’ Debütroman „Das Albtraumreich des Edward Moon“, die „FR“ rezensiert Bill Bufords „Hitze“. Die „NZZ“ widmet sich dem Erzählband „Bordell der Toten“ von Carlos Eugenio López, und die „SZ“ bespricht Horace Engdahls Textsammlung „Meteore“.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
Die „FAZ“ erklärt Hanna Johansens Roman „Der schwarze Schirm“ zur „Parabel einer modernen Beziehungslosigkeit und der Untauglichkeit alter Familienstrukturen“. Während einer Zugfahrt kreuzten sich die Lebenswege zweier Frauen: Die Ältere von beiden befinde sich „seit langem auf der Suche nach ihrer Tochter“, die Jüngere scheint ihre leibliche Mutter nie kennen gelernt zu haben. Trotz aller „Küchenpsychologie“ gelinge es Johansen durch ihre „nuancenreiche Sprache“ in dieser beklemmenden Charakterstudie „Sympathien für ihre glücklose Heldin zu wecken“, meint die Rezensentin Sabine Doering.
Thomas Scholz rezensiert für die „FAZ“ Jonathan Barnes’ Debütroman „Das Albtraumreich des Edward Moon“. Das Markanteste an Barnes’ Werk sei zum einen die „bizarre Komposition“ aus „kulturhistorischen Komponenten“ und „modernen Verschwörungstheorien“ und zum andern die „unerwarteten Wendungen“ des Handlungsplots. Obwohl der Autor sich augenscheinlich noch „auf der Suche nach einem unverwechselbaren Stil“ befinde, könne man in erster Linie den Bruch mit den„literarischen Konventionen“ und die „originelle Geschichte“ als gelungen erachten, meint Scholz.
Der Filmwissenschafter Marcus Stiglegger analysiere in seinem wissenschaftlichen Filmbuch „Ritual und Verführung“ die seduktiven Strategien des Kinos, berichtet die „FAZ“. Anhand zahlreicher Filmklassiker lege er exemplarisch dar, warum wir „beim Ansehen eines Filmes in ihn eintauchen wie in einen Traum“. Zwar stehe man am Ende der Lektüre „ohne knackige Erkenntnis“ da – der Witz liege jedoch darin, beobachten zu können, wie der Akademiker sich „immer wieder lustvoll von dem mitreißen lässt, was er doch sezieren soll“. So habe beispielsweise „noch niemand so schön“ über die Strandszene aus „Das Piano“ geschrieben wie Stiglegger.
Die „FAZ“ lobt Dirk von Petersdorffs „Geschichte der deutschen Lyrik“ und bezeichnet den schmalen Band „als ideale Ergänzung zu einer guten Gedichtanthologie“. Der Autor verstehe es, durch „Prägnanz und kluge Auswahl“ die Entwicklung der deutschen Dichtkunst von den Anfängen bis zur Neuzeit stilvoll zu skizzieren. Petersdorffs Anliegen „Lust auf Gedichte zu machen“, gehe mit diesem „Lektürekompass“ zu Recht auf, befindet die „FAZ“.
Mit den hundert populärsten Redensarten befasse sich Hugo Pruys’ „Bis in die Puppen“, schreibt die „FAZ“. Das „unverzichtbare Nachschlagewerk“ zeichne sich vor allem dadurch aus, dass der Autor nahe am Gegenstand gearbeitet habe, da er jeder Redensart eine ausführliche Erläuterung zu ihrer Herkunft widme. Zudem erweisen die Ausführungen Pruys’ besonders dem „im Alltag unter Druck“ Stehenden, weil nach der passenden Formulierung Suchenden, ihre Nützlichkeit.
„Frankfurter Rundschau“
Unter der Überschrift „Küchenhölle“ bespricht Sylvia Staude in der „Frankfurter Rundschau“ („FR“) den neuen Roman „Hitze“ von Bill Buford, in dem er über seine Erfahrungen als Amateurkoch in Restaurantküchen berichte. Buford erzähle „witzig wie Anteil nehmend“ von den „Essens-Menschen“, den Köchen und Fachkräften, mit denen er arbeitete. Das Buch verdeutliche, dass das „kleine Essen“ der Großmutter, liebevoll angerichtet, viel wertvoller sei als maschinell hergestelltes „großes Essen“. Mit Herzblut stellt der Autor laut Staude die Sehnsucht nach einem „erdverbundenen, handfesten, den ursprünglichen Dingen zugewandten Leben“ dar.
„Neue Zürcher Zeitung“
Eine „beachtliche Bandbreite stilistischer Varianten“ entdeckt Kersten Knipp für die „NZZ“ in der Erzählsammlung „Bordell der Toten“ des spanischen Schriftstellers Carlos Eugenio López. Eine Erzählung aus dem Band sei aus der Perspektive eines Schlachtschweins geschrieben, das sein Schicksal erst erkennt, als es bereits zu spät ist. In einer weiteren Geschichte schlage ein Politiker vor, Leichname doch vor ihrer Beerdigung für eine Weile „der erotischen Begierde der Lebenden“ zu überlassen. An Stellen wie diesen offenbare sich der gleichgültige „Nihilismus einer entfesselten Ökonomie.“ Der Autor belege einmal mehr, dass er zu den finstersten Vertretern seiner Zunft gehöre: Ihm gelinge es, aus der Banalität des Bösen „die erstaunlichsten Effekte zu schlagen“.
„Social Cooking Romania“, ursprünglich Begleitband einer Ausstellung in Berlin, erteile dem Leser Kunstlektionen über Essen und Politik, schreibt die „NZZ“. Es ginge dabei nicht etwa um „gastronomische Anekdoten“, sondern um Kulinarisches als „Spiegel der rumänischen Geschichte“. Der Künstler Dan Mihaltianu zeichne beispielsweise eine „knappe, interessante Geschichte der kulinarischen Identität Rumäniens“. Rezensentin Petra Kipphoff begrüßt diese Perspektive als willkommene Alternative zum „Küchenlatein der Überflussgesellschaft“, wie sie beispielsweise die Documenta 12 zu Ausdruck gebracht habe.
„Süddeutsche Zeitung“
Das Buch „Meteore“ des Literaturkritikers Horace Engdahl sei eines von der raren Sorte, das „keinen Krach“ mache, findet Rezensent Andreas Dorschel in der „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“). Engdahl, Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie, folge bei der Darstellung seiner Gedanken der Maxime, den „Überzeugungen freien Lauf zu lassen“. Dementsprechend seien seine Bemerkungen „scharf umrissen, artikuliert, kraftvoll“. Aus der Textsammlung spricht laut Dorschel die „Freude am Denken“, aufgeschrieben mit einem „vollendeten Understatement“, das aus Stärkte resultiert.
Laura Weissmüller rezensiert den Roman „Fünf Tage im Juli“ von Franz Xaver Karl. Der Roman handle vom Sterben eines Familienvaters und zeige die Familie „beim letzten Bilanzziehen“, wie die Rezensentin schreibt. Der Münchner Autor versuche, möglichst „unterschiedliche Familienmitglieder zu entwerfen“, was jedoch manchmal zu einer stereotypen Zeichnung der Figuren führe, teilt Weissmüller weiter mit. Der Roman sei eine „Seelenschau“ und glänze mit „wunderbaren Wortbildern“, klar und poetisch in ihrer Wirkung.
Michael Frieds Studie über den Maler Adolph von Menzel (1815-1905) mit dem Titel „Menzels Realismus“ lebe von „geschickt gewählten Vergleichen“, schreibt Andreas Strobl in der „SZ“. Erhellend seien Frieds Überlegungen, Menzels Bilder mit denen seiner Zeitgenossen in Relation zu stellen und auch die amerikanische Kunst der damaligen Zeit einzubeziehen. Es fehlen jedoch „wesentliche Aspekte Menzelscher Kunst“, und der Leser erfahre zu wenig über den Erfinder Menzel, bemerkt Strobl. Frieds „Manie ständiger Parenthesen“ sei dem Lesevergnügen abträglich, seine spekulative Perspektive sei wiederum „erfrischend“, zumal dieser Bereich der Kunstgeschichte bereits „derart ausgiebig beackert“ worden sei. (mar/mik/win/wip)
Literaturangaben:
BARNES, JONATHAN: Das Albtraumreich des Edward Moon. Aus dem Englischen von Biggy Winter. Piper Verlag, München 2008. 400 S., 19,90 €.
BUFORD, BILL: Hitze. Abenteuer eines Amateurs als Küchensklave, Sous-Chef, Pastamacher und Metzgerlehrling. Aus dem Amerikanischen von Dinka Mrkowatschki. Carl Hanser Verlag, München 2008. 384 S., 24,90 €.
ENGDAHL, HORACE: Meteore. Aus dem Schwedischen von Klaus-Jürgen Liedtke. Verlag BuchKunst Kleinheinrich, Münster 2008. 131 S., 18 €.
FRIED, MICHAEL: Menzels Realismus. Kunst und Verkörperung im Berlin des 19. Jahrhunderts. Aus dem Englischen von Heinz Jatho. Wilhelm Fink Verlag, München 2008. 344 S., 39,90 €.
JOHANSEN, HANNA: Der schwarze Schirm. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2007. 160 S., 17,90 €.
KARL, FRANZ XAVER: Fünf Tage im Juli. Roman. Blumenbar Verlag, München 2007. 252 S., 18 €.
LÓPEZ, EUGENIO CARLOS: Bordell der Toten. Erzählungen. Aus dem Spanischen von Susanna Mende. Kein & Aber, Zürich 2007. 207 S., 18,90 €.
PETERSDORFF, DIRK VON: Geschichte der deutschen Lyrik. Verlag C. H. Beck, München 2008. 124 S., 7,90 €.
PRUYS, KARL HUGO: Bis in die Puppen. Die 100 populärsten Redensarten. Edition q im bebra Verlag, Berlin. 142 S., 9,90 €.
Social Cooking Romania. Deutsch/Rumänisch. Herausgegeben von der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin 2007. 206 S., 16 €.
STIGLEGGER, MARCUS: Ritual und Verführung. Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film. Bertz + Fischer, Berlin 2007. 240 S., 25 €.
Presseschau vom 5. März 2008
Andere Stimmen
- Charakterstudium am Sterbebett | „Fünf Tage im Juli“ von Franz Xaver Karl
- Im Reich des Bizarren | Jonathan Barnes’ Debütroman „Das Albtraumreich des Edward Moon“
- Träume in düsterem Licht | Hanna Johansens tragischer Roman „Der schwarze Schirm“
Rezension
Rezensionen im Original
- Bill Buford: Hitze (Carl Hanser Verlag) / Kritik „FR“
- Eugenio Carlos López: Bordell der Toten (Kein & Aber Verlag) / Kritik „NZZ“
- Neue Gesellschaft für bildende Kunst (Hrsg.): Social Cooking Romania / Kritik „NZZ“
Verlage
- C.H. Beck
- Bertz + Fischer
- Blumenbar Verlag
- Verlag BuchKunst Kleinheinrich
- Bebra Verlag
- Wilhelm Fink Verlag
- Hanser Verlag
- Kein & Aber
- Neue Gesellschaft für Bildende Kunst
- Piper Verlag