Heinrich von Gottes Gnaden – eine Biografie über Heinrich den Löwen
Geschichte und Erinnerung sind der Nährboden adliger Selbstgewissheit
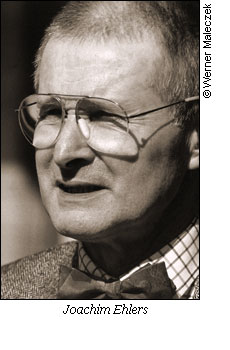 Obwohl die adlige Familie der Welfen, wie dies seit der Antike überliefert und zur Machtausübung und zum Machterhalt üblich war, ihre Genealogio Welforum schon früh durch meist klerikale Geschichtsschreiber aufzeichnen ließ, datieren die Historiker das Geburtsjahr ihres wichtigsten Repräsentanten, Heinrich des Löwen, nicht genau, 1129/30, oder auch, 1132/33, nach der Steterburger Chronik; doch auch hier die Ungewissheit, ob nicht der Kopist der einzigen Schrift nicht einen Übertragungsfehler beging. Auch der vermutliche Geburtsort, die Ravensburg, ist zwar nicht gesichert, aber wahrscheinlich. Sein Todestag hingegen, am 6. August 1195 in Braunschweig, dürfte sicher genannt sein. Der Probst Gerhard von Steterburg nannte dieses Datum in den Annales Stederburgenses. Der Historiker Joachim Ehlers legt die Biografie des wohl bekanntesten und auch umstrittensten Herrschers des Hochmittelalters vor.
Obwohl die adlige Familie der Welfen, wie dies seit der Antike überliefert und zur Machtausübung und zum Machterhalt üblich war, ihre Genealogio Welforum schon früh durch meist klerikale Geschichtsschreiber aufzeichnen ließ, datieren die Historiker das Geburtsjahr ihres wichtigsten Repräsentanten, Heinrich des Löwen, nicht genau, 1129/30, oder auch, 1132/33, nach der Steterburger Chronik; doch auch hier die Ungewissheit, ob nicht der Kopist der einzigen Schrift nicht einen Übertragungsfehler beging. Auch der vermutliche Geburtsort, die Ravensburg, ist zwar nicht gesichert, aber wahrscheinlich. Sein Todestag hingegen, am 6. August 1195 in Braunschweig, dürfte sicher genannt sein. Der Probst Gerhard von Steterburg nannte dieses Datum in den Annales Stederburgenses. Der Historiker Joachim Ehlers legt die Biografie des wohl bekanntesten und auch umstrittensten Herrschers des Hochmittelalters vor.
Der Biograf summiert das Aussehen und den Charakter des Herzogs von Braunschweig durch die vorliegenden Quellenmaterialien „als dunkelhaarigen, gutaussehenden, schlanken und körperlich durchtrainierten Mann (...), von hoher Intelligenz und militärisch tüchtig“. Weil der in hochadliger Familie früh verwaiste Mann frühzeitig gelernt hatte, „sich durchzusetzen, einen starken Sinn für Besitz und Erwerb auszubilden und sein bis zur Arroganz übersteigertes Selbstwertgefühl offen zu zeigen“, war Heinrich der Löwe lange in der Machtauseinandersetzung zwischen den Welfen und den Staufern der selbstbewusste, ja skrupellose Machthaber: „Gebotene Loyalität verletzte er um eigener Ziele willen und achtete die Rechte anderer nicht sehr hoch“.
Gerade die „Aktion im Unvorhersehbaren“ bestimmte seine Erfolge, aber auch seine Niederlagen. Die verschiedenen überlieferten Stammbäume der Welfen, die Ehlers mit der süddeutschen Linie, in Schwaben, als Herzöge von Bayern, dem Herrschaftszentrum am Bodensee, um Altdorf und der Ravensburg 1123/26 datiert, der norddeutschen Linie, die als „Sächsische Welfenquelle“ 1132/37 im Kloster St. Michael zu Lüneburg entstanden ist, sowie der „Historia Welforum“ von 1167/74, machen bereits deutlich, dass die welfische Hausgeschichte den Herrschaftsanspruch auch – das findet der Chronist besonders erwähnenswert – durch eine „große Aufmerksamkeit für bedeutende Frauen im Familiengedächtnis der Welfen“ pflegte.
Ähnlich wie in der Chronik Friedrichs, gibt es auch keine gesicherten Informationen darüber, wie Heinrich der Löwe als Kind und Jugendlicher herangewachsen ist, wie er unterrichtet, von wem und wie er in das „Herrscherhandwerk“ eingewiesen wurde, welche Sprachen er beherrschte. Wie in der Zeit und in den adligen Herrscherauffassungen üblich, war Heinrich freilich von früh an konfrontiert mit den Ansprüchen auf Land und Macht. Sicher dürfte sein, dass sein späteres Herrschaftsdenken und -handeln bestimmt war von der Kombination aus Landfriede und Lehnrecht, das ihn im Gegensatz zu der bis dahin praktizierten sächsischen Rechtsauffassung brachte.
Heiden inmitten der Christen, das durfte nicht sein. Die Zisterzienser mit ihrem Abt Bernhard von Clairvaux wollten diese Ungeheuerlichkeit ausmerzen, mit dem Slawenkreuzzug 1147/48, bei dem der junge Heinrich eine geschickte Bündnis- und Machtpolitik betrieb und so in das das Investiturrecht von 1122 eingriff, wonach ein neu gewählter Bischof in Gegenwart des Königs mit den weltlichen Gütern und Hoheitsrechten ausgestattet wurde.
Doch Heinrich der Löwe dachte schon weiter. Bereits ab 1152 beanspruchte er, trotz des Widerstands der Fürsten den Titel für sich: „Henricus Die gratia dux Bawarie et Saxonie“ (Heinrich von Gottes Gnaden Herzog von Bayern und Sachsen). Beim Italienfeldzug des Königs war Heinrich nicht nur mit dem größten Kontingent beteiligt; sein Machtanspruch orientierte sich dabei auch daran, die Güter des Hauses Este für sich zu beanspruchen, die sein Urgroßvater Welf IV. besaß. Doch der Widerstand der italienischen Fürsten und vor allem des Papstes ließen diese Illusion zerrinnen.
Wie in den adligen Familiendynastien üblich, war auch die Heirat mit Clementia von Zähringen (1147) eher ein Zweck- und Machtbündnis, denn eine Liebesverbindung. So war es nicht ungewöhnlich, dass im November 1162 im Beisein des Kaisers, in Konstanz die Ehe aus „politischer und dynastischer Natur“ geschieden wurde, auch begründet damit, dass dem Herzog kein männlicher Erbe geboren wurde. Die im Februar 1168 arrangierte Eheschließung mit der 14jährigen Mathilde, der Tochter des englischen Königs Heinrichs II., eröffnete Heinrich dem Löwen europäische Horizonte. Als Schwiegersohn des seinerzeit neben dem Kaiser mächtigsten europäischen Herrschers stieg Heinrich der Löwe in die Familie der Könige auf.
Seine mit viel Pomp und Aufsehen durchgeführte Reise 1171 nach Konstantinopel und Jerusalem unterstrich Heinrichs Anspruch auf königliche und ritterliche Herrschaft. Dem Triumphzug nach Konstantinopel, wo er fürstlich empfangen wurde, folgte der Einzug nach Jerusalem und die großzügigen Schenkungen und Stiftungen Heinrich des Löwen für die Grabeskirche und den Ritterorden der Templer und Johanniter. In den Geschichtsinterpretationen kursiert, wie auch bei Joachim Ehlers, die Vermutung, dass Heinrich der Löwe durch die deutliche Abstinenz gegenüber den Werbungen des Kaisers, sich mit seinem Heer am Kampf gegen die lombardischen Städte zu beteiligen, zu einem Wendepunkt in seiner bisherigen Haltung gegenüber den Staufern kam, ja diese kritischere Position sogar provozierte.
Heinrich des Löwen Hofhaltung, seine Bemühungen die adligen Lehnsherren an sich zu binden, entsprach der hochherrschaftlichen Praxis von Abhängigkeit und Gefolgschaft. Besonders sein Hof in Braunschweig, mit dem Palas, dem Burgplatz, der Burgkapelle und der Stiftskirche St. Blasius symbolisierten für den Herzog das sichtbare Symbol ererbter und legitimierter Herrschaft. „Sie haben diese Stadt glanzvoll erhöht“; der Ruf verkündet es über den ganzen Erdkreis, so verkündet es der Schreiber des Evangeliars Heinrichs des Löwen.
Der auf einen hohen Sockel aufgestellte aus Bronze gegossene Löwe sollte nicht nur die in der kaiserlichen Tradition gewachsene Vorstellung von Macht und Kraft des „Königs der Tiere“ darstellen, sondern ihn selbst präsentieren: „Ich, Heinrich von Braunschweig, bin der Löwe“, so ließ er seinen Anspruch auf die oberste Macht in seinem Land, als oberster Richter und Feldherr, auf seine Münzen prägen. Seine Vorstellungen von Ritterlichkeit und sein Bemühen, nicht nur als Herrscher, sondern auch als Stifter und sogar als Mäzen für Kunst und Literatur aufzutreten, zeigen sich noch heute in den überlieferten Werken, wie etwa im „Rolandslied“ ,im „Tristrant“ und den zahlreichen Kunstwerken und Reliqiaren, die sich in Museen und Kirchen befinden.
Die sich durch Heinrichs Verweigerung, Friedrich im Kampf gegen die lombardischen Städte beizustehen abzeichnende Distanz zur kaiserlichen Macht, Heinrichs des Löwen zweifellos auch provozierend und arrogant dargestellte Machtfülle, mussten ihm vielfältige Gegnerschaft bringen. Besonders Philipp von Heinsberg, Erzbischof von Köln, betrieb für den Kaiser die Entmachtung Heinrichs, die schließlich in kriegerische Auseinandersetzungen mündeten, bei denen Heinrich der Löwe Goslar angriff, Nordhausen und Mühlhausen zerstörte und erst einmal scheinbar als Sieger nach Braunschweig zurückkehrte.
Ächtung durch den Kaiser und sein Feldzug gegen Heinrich dem Löwen in Sachsen brachten schließlich die Niederlage. Beim Erfurter Hoftag im November 1181 musste sich Heinrich geschlagen geben. Der Fußfall vor dem Kaiser besiegelte den endgültigen Verlust der Herzogtümer Sachsen und Bayern. Auf Intervention König Heinrichs II. von England durfte Heinrich der Löwe sich mit Herzogin Mathilde, der zehnjährigen Tochter und den fünf- und neunjährigen Söhnen auf die Burg seines Schwiegervaters in die Normandie begeben; allerdings, wohl als Geisel des Kaisers, seinen Sohn Lothar zurücklassend.
Der Geschichtsschreiber vermutet, dass die Aufnahme des vom Kaiser Geächteten und Verbannten Heinrich in Anjou durch Heinrich II. nicht aus verwandtschaftlichen Gründen erfolgte, sondern mit dynastischen Kalkülen des englischen Königs zu tun hatte. Die darauf folgenden Bemühungen des englischen Königs, durch ein Ehebündnis eine staufisch-angevinische Verbindung zustande zu bringen, gelang, wobei Heinrich der Löwe so etwas wie Nützer und Nutznießer des Arrangements werden konnte, weil Heinrich II. diese Verbindung verband mit der Aufforderung an den Kaiser, Frieden mit Heinrich dem Löwen zu schließen.
Nicht zuletzt trug dazu auch die „handstreichartig arrangierte Vermählung Heinrichs, des Sohnes Heinrich des Löwen, mit der Erbtochter des rheinischen Pfalzgrafen Konrad von Staufen“ bei, wie der Biograf erläutert; was in der Geschichtsschreibung als Einbruch der Welfen in staufische Herrschaftspositionen am Rhein gewertet wird. Im September 1185 jedenfalls kehrte das Herzogenpaar nach Braunschweig zurück. Joachim Ehlers korrigiert dabei das Bild, das der Historiograf Arnold von Lübeck um 1200 von Heinrich dem Löwen verbreitete: demnach „saß er in Braunschweig und war zufrieden mit seinem Erbgut“. Vielmehr versuchte „Herzog Heinrich“, wie er sich künftig nannte, alles, um seine Rechte und Besitztümer wieder zu erlangen, bis hin zu Intrigen und Versuchen, Bündnispartner gegen den Kaiser zu finden.
Die Machtverhältnisse bewirkten, dass Friedrich 1188 seine Anhänger zu einem zweiten Kreuzzug nach Jerusalem aufrief, wozu er auch Heinrich den Löwen aufforderte. Der Verlockung, dass er, sollte er daran teilnehmen, wieder in Teile seiner früheren Würden eingesetzt werden könnte, widerstand er und wählte die weitere Option, die der Kaiser ihm oktroyierte und verließ erneut Braunschweig, zusammen mit seinem ältesten Sohn, um in der Normandie und in England Aufenthalt zu nehmen.
1189 dann kehrte Heinrich der Löwe nach Braunschweig zurück, um sogleich mit Hilfe des Erzbischofs Hartwig II. von Bremen die Grafschaft Stade als Lehnsgebiet zu erwerben. Die sich erneut andeutende Macht des Braunschweiger Herzogs war ein Alarmzeichen für König Heinrich VI., Friedrich Barbarossas Sohn und Erbe, sowie die deutschen Fürsten. Der wohl dilettantisch vorbereitete Feldzug gegen Heinrich den Löwen scheiterte. Heinrich und sein Sohn schienen den Zipfel der Macht erneut ergreifen zu können, jedenfalls für die norddeutschen Gebiete. Doch Heinrich des Löwen Zeit war abgelaufen.
Das Grabmal Heinrichs des Löwen und seiner Frau Mathilde in St. Blasius in Braunschweig kündet von diesem „illustris princeps Hinricus, dux Bawarie et Saxonie et dominus in Brunswich, fundator noster“. Das biografische Denkmal setzt Joachim Ehlers: „Heinrich der Löwe hat in dem Bewusstsein gelebt, einer der ältesten Adelsfamilien der Christenheit anzugehören, durch Abkunft von den trojanischen Franken, karolingischen Kaisern und mächtigen Vorfahren hochlegitimiert zur Herrschaft“. Kenntnisreich und quellenbewusst erläutert der Biograf, weshalb „aus dem Herzog keine historische Integrationsfigur für Bürger“ werden konnte, sondern vielfach in der Geschichte für ideologische Zwecke und selbstherrliche Kalküle benutzt wurde, ob einerseits „als Kämpfer für die Größe des Reiches“ oder andererseits „als Verräter an Kaiser und Reich“. Man wird mit Fug und Recht sagen können, dass es Joachim Ehlers mit der Biografie Heinrichs des Löwen gelingt, den Herzog von Braunschweig „in seine Welt zurück zu holen“.
Literaturangaben:
EHLERS, JOACHIM: Heinrich der Löwe. Biographie. Siedler Verlag, München 2008. 496 S., 24,95 €.
Verlag