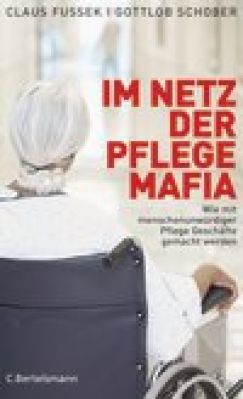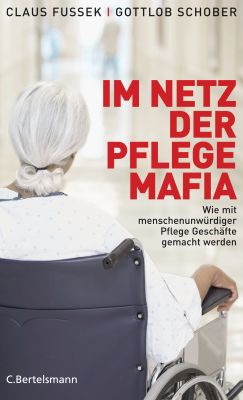|
|
Startseite > Bücher > Sachbuch > C. Bertelsmann Verlag > Claus Fussek und Gottfried Schober > IM NETZ DER PFLEGEMAFIA > Leseproben > Vorwort |
Vorwort
| IM NETZ DER PFLEGEMAFIA
Claus Fussek, Gottfried Schober Taschenbuch, 400 Seiten |
Jeder Mensch hat seine unverlierbare Würde, die ihm von Gott verliehen ist. In diesem Geist wird die Bewohnerin/der Bewohner betreut. Ihr/ihm wird im Rahmen dieses Vertrages die bestmögliche
Hilfe für ein weitgehend selbstbestimmtes Leben gewährt.
Präambel des Heimvertrags eines kirchlichen Trägers
In keinem anderen Bereich unserer Gesellschaft ist der Kontrast zwischen dem, was Träger zu leisten vorgeben, und dem, was tatsächlich für hilfsbedürftige Menschen getan wird, größer als in der Altenpflege. In den letzten Jahren wurden unerträgliche Zustände in Heimen und in der ambulanten Pflege aufgedeckt.
Artikel 1 unseres Grundgesetzes ist hier, wenn man die Realität betrachtet, quasi außer Kraft gesetzt. Die Würde der alten Menschen ist »antastbar«, müsste es eigentlich heißen. »Pflegeerleichternde Maßnahmen« wie Fesselungen, Psychopharmaka-Missbrauch und Ähnliches sind leider an der Tagesordnung.
Hilf- und wehrlose Menschen werden häufig so behandelt, dass sie zwangsläufig in eine höhere Pflegestufe eingruppiert werden müssen. Dahinvegetierende Pflegebedürftige bringen nach der Logik der Pflegeversicherung mehr Geld als Menschen,
deren noch bestehende Fähigkeiten ständig gefördert werden.
Die Folgen sind vielfach Erniedrigung, Gewalt und Vernachlässigung. Die meisten Pflegerinnen und Pfleger sind auch aufgrund restriktiver Arbeitsvorschriften überfordert. Sie fühlen sich ausgebeutet, können sich mit ihrem Beruf kaum noch identifizieren.
Dass für persönliche Zuwendung im System keine Minute vorgesehen ist, demotiviert sie.
Natürlich geht es auch anders. Wir haben Pflegeheime kennengelernt, denen wir unsere Eltern anvertrauen würden. Wir sind Pflegekräften begegnet, die mit leuchtenden Augen erzählten, dass sie Pflegebedürftige wieder von der Magensonde weg bekommen haben. Die alten Menschen essen und trinken jetzt wieder selbst und haben damit eine höhere Lebensqualität.
Doch leider sind das Ausnahmen.
Dass in einem der reichsten Länder der Welt das Argument der finanziellen Engpässe immer wieder als Rechtfertigung für einen kaum merklichen Fortschritt und damit für menschenunwürdige Pflege herhalten muss, halten wir für einen Skandal. »Unter den gegebenen Bedingungen leisten wir eine optimale
Pflege« ist einer der Lieblingssätze vieler Heimträger. Nur ein radikaler Systemwechsel vermag diese Zustände zu ändern. Wir brauchen eine Abkehr von passivierender Pflege. Sie ist teuer und zerstört die Eigenständigkeit alter Menschen. Das ist unstrittig!
Alle Probleme sind wissenschaftlich ausreichend aufgearbeitet – alle Ergebnisse liegen auf dem Tisch. In der deutschen Pflegelandschaft gibt es kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.
• Warum sind gerade alte und pflegebedürftige Menschen derart entwürdigenden und lebensbedrohenden Bedingungen ausgesetzt?
• Warum lösen Skandalberichte in der Öffentlichkeit nur hilflose Empörung aus (im Gegensatz zu sonstigen Reaktionen auf Missstände oder Vergehen, bei denen in aller Regel sofort Gesetzesverschärfungen gefordert werden)?
• Warum bitten unsere Informanten um Wahrung ihrer Anonymität, wenn sie nachweislich nur die Wahrheit wiedergeben?
• Warum droht engagierten und couragierten Pflegekräften der Verlust ihres Arbeitsplatzes, wenn sie sich zur öffentlichen Kritik an ihrer entwürdigenden Berufspraxis entschließen?
• Warum stellen Staatsanwälte Ermittlungsverfahren, in denen es um alte Menschen geht, häufig schnell wieder ein? Handelt es sich hier um einen rechtsfreien Raum?
• Warum steht eine hohe Rendite über menschenwürdiger Pflege? Wer verdient an Pflegefonds?
• Warum werden die Auswirkungen dubioser Immobiliengeschäfte auf die Pflegequalität fast nicht untersucht?
• Warum kostet auch schlechte Pflege im Heim zwischen 2500 und 3500 Euro?
Diese Fragen wollen wir auf den folgenden Seiten beantworten. Kaum jemand interessiert sich für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine ehrliche Kostentransparenz ist offensichtlich politisch
nicht durchsetzbar! Auch eine Reform der Pflegeversicherung wird daran wenig ändern.
Wir, die Autoren dieses Buches, kennen uns seit sechs Jahren.
Vom Beginn unserer Zusammenarbeit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Situation pflegebedürftiger Menschen zu verbessern, und führen in den folgenden Kapiteln die Ergebnisse unserer jahrelangen Arbeit, ergänzt durch viele neue Recherchen, zusammen.
Wir möchten erreichen, dass pflegebedürftige Menschen jeden Tag zu essen und zu trinken bekommen, und zwar in dem Tempo, in dem sie kauen und schlucken können. In etlichen Pflegeheimen ist dies aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich.
Bewohner werden dort mit »pflegeerleichternden und pflegevermeidenden « Magensonden versorgt. Damit sind nicht die medizinisch notwendigen Hilfsmittel gemeint, sondern die zahlreichen Sonden, die inzwischen in den Krankenhäusern »auf Druck vieler Pflegeheime« eingesetzt werden. Die auf solche Weise »Versorgten« dürfen nichts mehr essen, nichts mehr
kauen, nichts mehr schlucken, nichts mehr schmecken! Diese Vorstellung ist für die meisten Pflegeheimbewohner ein Albtraum und auch ein Grund, warum sie dann erklären: »So möchte ich nicht mehr leben!«
Inzwischen hat auch der Medizinische Dienst der Kranken- und Pflegekassen festgestellt, »dass in einer Vielzahl von Pflegeheimen die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr nicht mehr sichergestellt werden kann«. Das heißt im Klartext: Pflegebedürftige
Menschen hungern und verhungern beziehungsweise trocknen in Pflegeheimen aus. Wir sprechen hier nicht vom Elend der Flüchtlinge in der sudanesischen Provinz Darfur, sondern von Pflegeheimen in Deutschland. Wir sind fassungslos, dass alte Menschen teilweise wochenlang nicht aus dem Bett kommen.
Sie liegen den ganzen Tag herum und starren die weiße Wand an. Niemand spricht mit ihnen, sie warten auf den Tod, isoliert und endgelagert! Das ist unmenschlich und grausam!
Beim Besuch der Altenpflegemesse 2007 in Nürnberg konnten wir uns ein Bild davon machen, zu welch einem Wirtschaftsfaktor sich die Altenpflege in letzter Zeit entwickelt hat. So sind inzwischen Windeln erhältlich, die ein Fassungsvermögen von unglaublichen 3,8 Litern haben. Wir fragen uns, wer sich das ausgedacht hat. Wie lange müssen Menschen in solchen Windeln
liegen, damit sich dieses Produkt für potenzielle Käufer rechnet?
Es ist ein Anreiz für Heimträger und deren Pflegekräfte, Menschen nicht mehr zur Toilette zu führen! Wie lange würde ein fröhlich Zechender in einem Zelt des Münchener Oktoberfestes nach dem Genuss von vier Maß Bier diese unwürdige Situation aushalten?
Sprechen wir jetzt einmal nicht von »Würde«, von den »entsetzlichen Schmerzen« – betrachten wir den Pflegeskandal nur unter »volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten«!
Die Behandlung eines großen Dekubitalgeschwürs in einem Krankenhaus kostet etwa 25 000 bis 30 000 Euro. Zehntausende offene Druckwunden müsste es nicht geben, wenn man heute nach den medizinisch-pflegerischen Erkenntnissen – den
»Expertenstandards« – vorgehen würde. Das heißt, wir leisten uns den Irrsinn, volkswirtschaftlich hunderte Millionen zu verschwenden und gleichzeitig vielfach menschenunwürdig zu pflegen.
Wer soll das verstehen?
Uns ist in den vergangenen Jahren der »Pflegediskussion« eines vollkommen klar geworden: Solange an den Folgen der schlechten Pflege viel Geld verdient werden kann, wird sich am Grundsatz nichts ändern. Selbst die Krankenkassen scheinen kein großes Interesse daran zu haben. Warum stellen sie den Verantwortlichen kaum Regressforderungen für teure »Pflegefehler«?
Die Pflegekassen haben sich zusammen mit der Bundesregierung und den Heimträgern inzwischen offensichtlich »arrangiert«: Man möchte »die alten Menschen nicht weiter verunsichern« und eine »Skandalisierung« verhindern. In der Vergangenheit
haben sich nach Pflegeskandalen immer wiederkehrende Argumentationsschemata entwickelt.
Ein Beispiel: Mehrere alte Menschen leiden in einem Pflegeheim unter Dekubitalgeschwüren, und sie bekommen zu wenig zu essen und zu trinken. Zunächst wird der Träger, von Journalisten darauf angesprochen, darauf verweisen, dass personenbezogene Daten nicht weitergegeben werden können. Manchmal lassen sich Journalisten auf diese Weise abwimmeln. Ist die
Beleglage aber erdrückend, so wird der Heimträger einen »bedauerlichen Einzelfall« einräumen und in diesem Zusammenhang auch auf ein »zertifiziertes Qualitätssicherungssystem«, das »den Qualitätssicherungsprozess« überwache, hinweisen.
Damit möchten die Betreiber den Journalisten zu verstehen geben, dass man auf individuelle Fehler entsprechend zu reagieren in der Lage sei. Die nächste Eskalationsstufe: Den Medien, die über die sogenannten »Einzelfälle« berichten, wird im Nachgang
eines solchen Berichts »Skandalisierung« und »Panikmache« vorgeworfen.
Daraufhin schaltet sich häufig die Politik ein. Sie verharmlost und mahnt, dass ein »ganzer Berufsstand durch bedauerliche Einzelfälle und ein paar schwarze Schafe« unter »Generalverdacht gestellt« werde. Man dürfe nicht »pauschal kriminalisieren und diffamieren«. Und: Nicht alle Heime seien schlecht!
So sagte zum Beispiel die Bundesgesundheitsministerin im September 2007 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: »Die überwiegende Mehrheit der Pflegeeinrichtungen und -dienste leistet eine hervorragende und aufopferungsvolle Arbeit an den pflegebedürftigen Menschen!« Fünf Jahre zuvor hatte ebendiese
Ulla Schmidt der Opposition vorgeworfen, ihr seien »die
erschreckenden Missstände in Pflegeheimen« offensichtlich völlig gleichgültig. Wie kann es zu so grundverschiedenen Einschätzungen kommen? Haben sich die Rahmenbedingungen in den
letzten Jahren deutlich verbessert? Nein! Dieser Zitatvergleich bestätigt, dass Politiker in die Richtung argumentieren, aus der gerade der Wind weht.
Hält der öffentliche Unmut über die Pflegemisere länger an, so folgen möglicherweise Anfragen von Abgeordneten, oder man bildet Arbeitsgruppen und veranstaltet Anhörungen wie beim »Runden Tisch Pflege«. Damit wird wenigstens der Anschein
erweckt, als wäre man aktiv geworden. In diesen Gremien treffen sich dann die Vertreter der Kassen, Wissenschaftler, Experten, Vertreter der Pflegeverbände … Man kennt sich, man duzt sich, man diskutiert, und am Ende kommen nur unverbindliche Erklärungen, Empfehlungen und Verlautbarungen heraus,
die man dem Volk auch noch als Erfolg verkauft.
Vage Formulierungen wie etwa das Wort »mittelfristig« verdeutlichen, dass man zunächst einmal nichts ändern will. Es steht zum Beispiel im Koalitionsvertrag von Union und SPD aus dem Jahr 2005 bezüglich des sogenannten Pflegebegriffs. Der liegt zwar mittlerweile aus Bayern schon fertig ausformuliert und evaluiert vor und soll beispielsweise demenziell erkrankte
Menschen in der Pflegeversicherung besser berücksichtigen – dennoch sieht es die Bundesregierung als notwendig an, unter anderem »die finanziellen Konsequenzen« umfassend zu klären.
Das Ergebnis wird erst im November 2008 erwartet, also nach Inkrafttreten der Pflegereform. Umgekehrt hätte das Ganze Sinn gemacht.
Und so gab es zuerst ein »rundes Tischchen«, ein Eckpunktepapierchen, ein Gesetzesentwürfchen, und bald wird auch noch ein Gesetzchen verabschiedet. Über all dem steht das ungeschriebene Gesetz: Die Pflege darf nicht mehr kosten! Pardon, liebe Politiker – für solche Mauscheleien haben alte Menschen
kein Verständnis mehr.
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info