
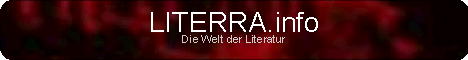
|
|
Startseite > Bücher > Belletristik > Ullstein Verlag > Joy Fraser > SCHIMMER DER VERGANGENHEIT > Leseproben > Schimmer der Vergangenheit |
Schimmer der Vergangenheit
| SCHIMMER DER VERGANGENHEIT
Joy Fraser Taschenbuch, 368 Seiten |
Wir waren etwa gegen fünfzehn Uhr vom Himmel gefallen. In dem unwegsamen Gelände kamen wir nur langsam voran. Immer wieder mussten wir uns bücken, Äste zur Seite schieben, mit den Füßen drauf treten um sie nicht dem Hintermann ins Gesicht schnellen zu lassen, und aufpassen wo wir hin traten oder hin fassten. Hinzu kam, dass wir uns ständig mit der Hand ins Gesicht oder auf den Rücken des Vordermannes klatschen mussten, wegen der Angriffe mehrere Moskitoarmadas. Die Malaria Prophylaxe, die wir alle weiterhin hätten einnehmen müssen, war mit dem Gepäck verschwunden und ich hoffte mit jeder Mücke die ich erschlug, dass dieses Gebiet nicht von Malaria Erregern verseucht war. Es war jetzt achtzehn Uhr und ich war fix und fertig.
"Wir müssen uns einen Platz für die Nacht suchen."
Ich konnte kaum noch gehen und mein Rücken schmerzte heftig. Der Wald roch süßlich, nach verfaulenden Pflanzen und frischem Blattgrün. Der Geruch legte sich wie Schmierseife auf die Schleimhäute, es war heiß und uns klebten die Kleider am Körper. Ab und zu hallten unsere Rufe durch den Regenwald, "Schaut mal, da! Was ist das für ein komisches Tier?", beim Anblick eines den Weg kreuzenden unbekannten Kriechtieres. Die schönsten Papageien begleiteten unseren Weg, riesige Schmetterlinge tauchten aus dem Dickicht auf, umflatterten uns kurz und verschwanden wieder. Die ein oder andere Schlange kroch aufgeschreckt von unserem rücksichtslosem Eindringen davon. Derlei Begegnungen lösten sofortige Schreiattacken und Adrenalin-Schübe aus. Ab und zu riefen wir nach Jack, doch eigentlich rechnete nun niemand von uns noch damit ihn zu finden.
"Ich verdurste", meldete Barbara.
"Hoffentlich stoßen wir morgen auf Wasser", sagte ich mehr zu mir selbst.
Mir klebte die Zunge am Gaumen und mir war zum Heulen. Angeblich soll in solchen Wäldern alle paar hundert Meter wenigstens ein Rinnsal oder sogar ein Wasserfall anzutreffen sein, hatte Robert mir erzählt. Er meinte, sollte er einmal irgendwo stranden, dann viel lieber in einem Urwald, als beispielsweise in einer Wüste. Urwald sei klasse, hier könne man überleben. Bei dem Gedanken an ihn kamen mir die Tränen und unsere gefährliche Situation wurde mir bewusster. Sich durch den Dschungel zu schlagen war eine Sache, aber nun hatten wir das Problem einen sicheren Schlafplatz zu finden. Auf dem schwammigen Boden aus verrottendem Kompost, verseucht von Insekten, schien mir keine verlockende Aussicht zu sein.
Angst, Verzweiflung und Ekel schnürten mir die Kehle zu. Zu Hause hatte ich Schwierigkeiten eine kleine Gartenspinne aus der Wohnung zu befördern, ohne hinterher eine Therapie zu benötigen. Für gewöhnlich fiel Robert die heldenhafte Aufgabe zu, mich von dem Untier zu befreien. Im Dunkeln würde ich keinen Schritt weitergehen. Wir waren todmüde und es war jetzt schon fast dunkel unter dem dichten Blätterdach. Ich konnte die anderen nur noch als farblose Konturen erkennen. Und plötzlich, als ich meinen Blick durch das dichte Grün schweifen ließ, war da ein Gesicht. Das Gesicht eines Indios. Es war ein dunkelbraunes, junges Gesicht und es kam mir bekannt vor. Ich erkannte den Indio vom Flughafen, doch diesmal ohne Kriegsbemalung. Ich starrte ihn an bis ich blinzeln musste, und er war verschwunden. So unvermittelt, wie er erschienen war, war er plötzlich fort.
Ich rieb mir die Augen und war nicht sicher, ob der Schlag auf meinen Kopf beim Aufprall nicht der Ursprung der Erscheinung sein könnte. Ich wollte die anderen nicht beunruhigen, deshalb beschloss ich darüber zu schweigen.
"Räumt mit den großen Blättern hier den Kompost auf einen Platz, so viel ihr könnt", rief ich den schattenhaften Gestalten meiner Freundinnen zu.
Es war mir wieder etwas aus dem Überlebenstraining eingefallen und ich dankte Robert dafür mich damit fast zu Tode gelangweilt zu haben.
"Dann reißen wir jede Menge von den großen Blättern ab und legen sie als Matratze aus. So ist es gut. Wir legen uns drauf und decken uns mit den Blättern zu."
Ich suchte unauffällig die Umgebung ab, aber es war kein Indio mehr zu sehen.
Man folgte meinen Anweisungen widerspruchslos. Jedes Blatt wurde akribisch auf die Anwesenheit von Spinnen oder ähnlich unangenehmen Zeitgenossen untersucht.
"Gott sei Dank haben wir noch unsere Feuerzeuge. Da soll mal einer sagen, rauchen ist ungesund", scherzte ich und die anderen lachten, sodass die pure Verzweiflung in eine dunkle Ecke unserer Seelen zurückwich.
Wir sammelten allerlei Gehölz und entfachten nach mehreren erfolglosen Versuchen ein kläglich qualmendes Feuer, denn das Gehölz war feucht.
Der Qualm hatte den Vorteil Insekten abzuschrecken. So hoffte ich jedenfalls. Wir sammelten noch mehr Holz, bis wir ein Feuer von der Größe der Pfadfinderlagerfeuer aus meiner Kindheit entfacht hatten. Wären nicht unsere Ängste und Schmerzen und der Verlust von Jack gewesen, hätte es ganz gemütlich sein können. Leise unterhielten wir uns, bis wir die Augen nicht mehr offen halten konnten.
Als wir uns für Schlafen entschieden, breiteten wir die Asche zum abkühlen aus. Ich hatte mir gemerkt um die Schlafstätte gestreute Asche würde eine Menge Kriechtiere von unseren Körpern abhalten. Sie mögen nicht darüber laufen oder kriechen. Es war jetzt stockdunkel und ganz still, die Sterne hatten keine Chance durch das Blätterdach zu dringen und die Dschungelbewohner waren alle gleichzeitig wie auf ein Geheimkommando verstummt. Wäre ich nicht so müde gewesen, hätte ich mich zu Tode gegruselt.
"Und jetzt hoffen wir, dass uns keine wilden Tiere mit einem prima Abendessen verwechseln", murmelte Anette vor sich hin, in ihre Blätterdecke gehüllt. Die Blätter dienten mehr dem Schutz vor Insekten, als zum warm halten, denn die Nacht präsentierte sich kaum kühler als der Tag.
"Hoffentlich suchen sie schon nach uns. Karin, deine Tante meine ich", sagte Barbara mit sorgenvoller Stimme.
"Bestimmt", beruhigte Karin sie, obwohl mir schien, dass auch sie sich wenig Hoffnung machte. Wie sollte man uns in dem dichten Urwald von oben sehen können? Zu erschöpft um an Riesenameisen und anderes Getier zu denken, schliefen wir ein.
Der Morgen dämmerte, als ich erwachte. Alle Dschungelbewohner waren Frühaufsteher und summten, quakten, schrieen mit unglaublichem Getöse. Der Schlafplatz war nicht sehr bequem gewesen und mir tat alles weh. Ich stand auf und versuchte mich auf Puddingknien vorwärts zu bewegen. Als ich mich streckte durchzuckte mich ein stechender Schmerz vom Genick bis zum Steißbein. Erschrocken beugte ich mich vor und stellte dabei fest, dass mir sämtliche Rückenmuskeln bis zum zerreißen schmerzten. Außerdem konnte ich kaum den Kopf drehen. Schleudertrauma, fiel mir sofort ein. Meine Schultern fühlten sich an, als ob jemand mit großem Druck versuchte, mich in den Erdboden zu rammen.
Anette erwachte. Auch sie hatte Probleme mit der aufrechten Haltung.
"Ich glaube, wir haben einen Muskelkater von gestern. Au, mein Nacken schmerzt auch", sagte sie und dehnte vorsichtig ihre Glieder.
"Außerdem sind wir überall grün und blau."
Ich lachte und wies Anette auf ihren rechten Arm hin. Sie blickte wenig überrascht auf einen tellergroßen Bluterguss.
Ich registrierte einen heftigen Schmerz in meiner rechten Körperseite.
"Mir tut die Hüfte weh, ich traue mich gar nicht, hinzusehen."
"Doch, musst du aber", sagte Anette "Zeig mal her."
Erbarmungslos hob sie mein T-Shirt an, zog mit dem Finger am Bund meiner kurzen Hose und schaute hinein.
"Uuh", war ihr Kommentar und sie schaute angewidert zur Seite.
"Was ist?"
"Deine ganze rechte Seite ist blaugrün und geschwollen. Hat das gestern noch nicht weh getan?"
"Gestern hat mir alles gleichmäßig weh getan. Heute schmerzen manche Stellen mehr als andere."
Sie lachte und dann untersuchten wir uns gegenseitig und nannten uns die Stellen, die gefährlich aussahen. Ich wunderte mich danach nicht mehr, warum es über meiner linken Niere so brannte. Anette hatte so etwas wie eine Zecke an mir entdeckt. Ich wäre fast in Ohnmacht gesunken und fiel auf die Knie, als sie es mir eröffnete. Dann fiel mir ein, dass diese Tiere wahrscheinlich auch am Boden lebten und ich sprang panisch wieder auf die Beine. Karin und Barbara, durch meine Schreie geweckt, meinten, man dürfe die Zecke nicht entfernen. Wenn man etwas falsch mache, könne sich die Stelle entzünden. Ich war entsetzt mit einem Parasiten an meinem Körper weiter zugehen, aber Barbara behauptete, es sähe nicht anders aus, als eine herkömmliche Waldzecke und sie würde sicher bald von allein abfallen, sobald sie sich an mir satt getrunken hätte. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte zu vermeiden in hysterische Schreie auszubrechen.
Karin und Barbara klagten über die gleichen Muskelschmerzen und bestanden darauf, ebenfalls nach Parasiten abgesucht zu werden. Gott sei Dank fanden wir nichts weiter. Scheinbar hatte die Asche ihre Wirkung nicht verfehlt, doch sie konnte nicht verhindern, dass sich irgendetwas aus den Bäumen auf uns fallen ließ. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken und ich begann ein Gespräch um mich abzulenken.
"Da das Frühstück heute zu Gunsten unserer guten Figur ausfällt, sollten wir den kühlen Morgen nutzen und gleich aufbrechen." Ich blickte fragend in die Runde.
"Das nenne ich Urlaub. Naturnah, inklusive Fitnesstraining, Fastenwoche und das Bearbeiten von Insektenphobien", scherzte Anette bitter.
Es ging weiter nach Norden. Wir entwickelten einen einschläfernden Laufrhythmus wobei wir wie mechanisch den Urwald zerteilten und nieder trampelten. Ab und zu ein Schrei, ausgelöst durch eine Schlange oder ein anderes Grauen erregendes Tier, ansonsten hüllten mich die Geräusche des Dschungels ein. Zwischen einer Million Zikaden und den Schreien exotischer Vögel, versuchte ich bewusst meine ängstlichen Gedanken zu verdrängen.
Tief im Inneren war ich sicher wir würden hier herausfinden. Mein Glaube an das zwanzigste Jahrhundert und seine Zivilisation, die sich meist unerwünscht überall breit macht, war unerschütterlich. Es hätte mich nicht gewundert, wären wir plötzlich auf ein fünf Sterne Hotel gestoßen.
Ich fragte Anette gerade nach dem Befinden des Parasiten auf meinem Rücken, was ich ungefähr alle zwanzig Minuten tat, als Karin abrupt stehen blieb.
"Hört mal", sagte sie.
Wir lauschten. Haarsträubende Urwaldgeräusche umhüllten uns. Merkwürdige Tierlaute, Knacken im Gebüsch. Und noch etwas anderes.
"Da rauscht etwas", sagte ich.
"Vielleicht ein Wasserfall", rief Barbara und machte sich von dem Gedanken an klares kühles Wasser getrieben auf den Weg durch dichtes Gebüsch. Wir bogen ein paar Äste auseinander und da war er. Ein schmaler Wasserfall, der mit Getöse von hoch aufragenden Felsen herab donnerte. Das Wasser mündete in einen kleinen See, und da war auch Roberts Rinnsal, das aus dem See ins Tal hinunter floss.
Wir hatten noch nie einen schöneren Anblick erlebt. Lachend und stolpernd rannten wir auf den See zu und schöpften mit beiden Händen das kühle Wasser in unsere Gesichter. Ich trank mich satt und schaute mich um. Dieser Platz hatte seinen besonderen Reiz. Um den See war der Urwald nicht ganz so dicht, es war wie eine Lichtung. Ich legte mich ans Ufer und blickte in den blauen Himmel. Also würden wir nicht verdursten. Robert hatte Recht behalten. Überall Wasser im Urwald, sagte er, und wir hatten tatsächlich welches gefunden.
Anette war mutig und schwamm im See. Mir war er trotz der Hitze viel zu kalt und ich ließ nur etwas Wasser über meine Arme und Beine laufen. Das Wasser kam aus dem Hochgebirge, aber Anette genoss das Bad sichtlich. Sie legte sich danach erschöpft neben mich. Barbara und Karin hatten auch keine Lust zum baden, wuschen sich jedoch ausgiebig und kühlten ihre zahlreichen schmerzenden Stellen. Sie saßen etwas weiter weg am Rand des Sees und unterhielten sich leise. Anette setzte sich auf und schüttelte ihr schwarzes Haar. Sie hatte eine Pagenfrisur und sah daher gleich wieder frisch frisiert aus. Beneidenswert. Meine langen blonden Locken machten immer was sie wollten. Sie reichten mir bis unter die Schulterblätter und ich hatte sie hier meistens zu einem dicken Zopf geflochten, der auch ohne Haargummi zusammen blieb. Robert hasste das. Du siehst aus wie die Magd Zenzi, die gleich die Kühe melken geht, war sein liebevoller Kommentar.
Robert.
Was würde er dazu sagen wenn er mich so sehen könnte? In Anwendung seiner Überlebenskunst. Der Gedanke amüsierte mich.
Typisch Isabel, oder so etwas. Er musste mich immer necken. "Fahr du nur mit deinen Weibern in den Urlaub", hatte er gesagt, wobei er Weiber scherzhaft betonte. "Ich kann als selbstständiger Unternehmer nun mal nicht so einfach weg. Aber passt auf euch auf. Ihr kommt doch immer irgendwie in Schwierigkeiten."
Wie Recht er damit hatte. Wir hatten bei unseren vergangenen Unternehmungen einige Abenteuer zu bestehen. Ein abgeschlepptes Auto nachts um halb drei, brennende Tischdecken beim Fondue, oder Barbara, die beinahe an einer Gräte erstickt wäre und wir den Notarzt, einen hübschen Kollegen von ihr aber leider verheiratet, rufen mussten.
Doch das hier war der Gipfel. Wir vier verloren im Dschungel, einfach unübertrefflich.
"Meinst du, wir kommen hier wieder raus?"
Ich sah hoch und blickte in Anettes Gesicht.
"Hm...."
Ich sah mich um. Das war eine ganze Welt für sich. Diese Ballung von Leben und Gefahr, dieses Fressen und Gefressen werden. Rücksichtslos versuchte jeder, ans Licht zu kommen. Die Lianen erwürgten den Baum, in Panik an ihm hoch hastend, breiteten sich über seine Krone aus, ohne zu wissen, dass sie damit ihn, und somit sich selbst töteten. Ein ständiger Kampf ums Dasein. Und nun waren auch wir in diesen Kampf verstrickt.
"Da bin ich ganz sicher", sagte ich wahrheitsgemäß, wobei ich mich über meine Sicherheit ein wenig wunderte.
"Und warum?"
Anette war verblüfft. Ich grinste. Ein verstehendes Lachen erschien in ihrem Gesicht.
"Ach so, deine innere Stimme, ja?"
Ich nickte. Anette glaubte genau wie ich an Dinge wie den sechsten Sinn und die tiefere Wahrheit der Intuition.
"Gut. Das lasse ich gelten", sagte sie, stand auf und ging noch eine Runde schwimmen. Nach ein paar Minuten hörte ich sie rufen.
"Hey, hier drin gibt es Fische! Wir könnten versuchen zu angeln."
"Da!", rief Karin.
"Und was für einer", sagte ich.
Das Schauspiel wollte ich mir nicht entgehen lassen und trat neben sie. Karin versuchte aus einem langen Ast und einem Blatt daran eine Angel zu konstruieren. Leider fiel das Blatt im Wasser ab und die Fische zeigten dem Stock nur die kalte Rückenflosse.
"So geht das nicht", murmelte Anette und beugte sich mit Karin über das vermeintliche Angelgerät. Ich beobachtete inzwischen Barbara, die an einer flachen Stelle des Sees versuchte Fische mit der Hand zu fangen. Ohne jegliches Resultat. Plötzlich fiel mir auf, dass an ihrem Hals etwas in der Sonne aufblitzte.
"Hey, Barbara. Gibst du mir mal deine Kette?"
"Na klar, damit könnte es gehen, gute Idee."
Sie trug ein dünnes Lederband mit einem Bergkristallanhänger. Wir knoteten das Lederband an einen Stock, sodass es in seiner ganzen Länge herunter hing. Dann knoteten wir einen spitzen Dorn, den wir von einem Gebüsch abgebrochen hatten an das Band. Der sollte dem Fisch im Hals stecken bleiben.
Barbara runzelte die Stirn.
"Werden die da rein beißen? Der Knoten ist fast größer als der Dorn."
"Robert hat mir mal erzählt, dass Fische in unbewohnten Gebieten auf alles hereinfallen und einfach überall rein beißen."
"Du und dein Robert", stöhnte Barbara.
"Scheinbar ist er doch zu was nutze. Du solltest ihn heiraten", riet mir Anette.
Die Angel wurde ausgeworfen, beziehungsweise in den See gehalten. Eine halbe Ewigkeit blieb Anette unbeweglich. Plötzlich zuckte die Angelschnur.
"Ja! Da ist einer dran. Schnell, helft mir."
Wir eilten ihr zu Hilfe und ein mittelgroßer Fisch unbekannter Art landete klatschend auf dem Boden. Ich hatte inzwischen etwas Unterholz gesammelt und mit Hilfe meines Feuerzeuges eine schöne Kochstelle errichtet. Zwei gegabelte Stöcke links und rechts, einen als Drehspieß darüber, fertig war der Grill. Es sah allerdings eher danach aus, als wolle ich den Fisch räuchern. Dicker Qualm stieg langsam hoch in den blauen Himmel und ich hoffte ein Flugzeug würde ihn sehen. Doch bisher war noch keins über das Gebiet geflogen. Ich verwarf den frustrierenden Gedanken und konzentrierte mich auf den vor mir liegenden, sich windenden Fisch, der hoffentlich nicht giftig war.
Wir wollten allerdings kein lebendes Sushi essen. Jemand musste dem irdischen Dasein dieses Fisches ein möglichst abruptes Ende bereiten. Wir stellten uns alle hinten an.
"Wir warten bis er erstickt ist", schlug Barbara schließlich vor.
Also hockten wir, das Kinn auf die Hände gestützt, im Kreis und schauten dem armen Fisch bei seinem Todeskampf zu.
"Ich bin satt", sagte ich spontan, als der Fisch endlich aufhörte zu zucken.
Karin ergriff die Initiative.
"Unsinn, ich hab Hunger. Jetzt wird er gegrillt."
Mit unvermuteter Kaltblütigkeit bohrte sie dem seligen Fischlein den Grillspieß durch die Eingeweide und hängte ihn über das Feuer.
"Okay, ab sofort ist Karin die Köchin", beschloss ich, als ich meine Sprache wieder gefunden hatte. Die anderen nickten zustimmend.
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info




