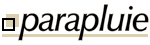
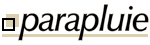 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 20: ohr
|
"That's a human ear all right"Blue Velvet und das Ohrgan |
||
von Oliver Speck |
|
Blue Velvet, David Lynchs Kultfilm aus dem Jahr 1986, ist der einzige Film, der das Ohr nicht nur als Mittel zum symbolischen Zweck benutzt, sondern es bewußt zu Ende denkt. Dazu trennt Blue Velvet in seiner berühmten Anfangssequenz das Ohr vom Körper und damit auch den Sinn vom Organ. Wenn Sinn und Organ dann in einer Allegorisierung gegeneinander ausgespielt werden, zerstört dies nicht, wie man erwarten könnte, den Spaß am Film. Was hier "Ohrgan" genannt wird, ist nichts weniger als der Motor des Kinos -- die Übersetzung von Wortsinn in Bild und Bild in Sinn, und deren anschließende Zusammenfügung in einer phantasmatischen Szene. |
||||
"Yes, that's a human ear all right." -- Mit diesem lakonischen Satz quittiert Detective Williams den unerhörten Fund, den Jeffrey Beaumont ihm in einer braunen Papiertüte überreicht. Das abgeschnittene Ohr, achtlos weggeworfen in einem Brachland, ist das erste Anzeichen dafür, daß etwas faul ist in dieser in David Lynchs Kultfilm Blue Velvet (1986) in Szene gesetzten idyllischen amerikanischen Kleinstadt. Denn das Ohr, wie Menschen mit einer Mittelohrentzündung leidvoll erfahren müssen, ist nicht nur zum Hören da, es dient auch dem Gleichgewichtssinn. Und dieses Gleichgewicht ist empfindlich gestört in Lumberton, USA: Korruption, Erpressung, Drogenhandel und Perversion regieren hinter der kleinbürgerlichen Fassade. |
||||
Fast zwanzig Jahre nach der Uraufführung, nach unzähligen Skandalen und Kriegen, wirkt die beißende Kritik an der amerikanischen Idylle hinter dem 'picket fence', dem allgegenwärtigen weißen Gartenzaun, möglicherweise etwas bemüht; Blue Velvet bleibt jedoch einer der wenigen Filme, die sich das Ohr zum Thema nehmen. Die Dialektik von Hören und Sehen wird natürlich von vielen Regisseuren zur Spannungssteigerung genutzt, allen voran Fritz Lang in seinem großartigen Film M -- Eine Stadt sucht einen Mörder (1931). Die Stimme des Kindermörders bleibt wohl jedem Zuschauer in Erinnerung -- und zwar deswegen, weil man sie hilflos einem Körper zuordnen will. Michel Chion hat der Stimme aus dem Off, die er "akusmatisch" nennt, ein ganzes Buch gewidmet. Wer ein Geräusch hört, will die Quelle desselben erfahren. Dies ist eine ganz natürliche Reaktion unseres Hirnstammes, die sich jeder noch so billige Horrorfilm zunutze macht. Die Kombination von Sehen und Hören ist natürlich auch komisch -- Hitchcock läßt 1935 in The 39 Steps den schrillen Schrei einer Frau in das Pfeifen einer Lokomotive übergehen. Auch sollten The Conversation (1974) von Francis Ford Coppola und Brian DePalmas Thriller Blow Out (1981) nicht unerwähnt bleiben. Allein Blue Velvet aber dissoziiert das Ohr vom Körper, trennt den Sinn vom Organ und spielt beide in einer Allegorisierung gegeneinander aus, ohne jedoch den Spaß am Film selbst zu zerstören; im Gegenteil, die Übersetzung von Wortsinn in Bild und Bild in Sinn ist der Motor des Kinos. Damit beschreibt Blue Velvet die grundlegende Funktion des Ohrs im Film als die einer Trennung von Bild und Wort und deren anschließende Zusammenfügung in einer phantasmatischen Szene. |
||||
Die Methode ist dabei außerordentlich komplex und vielschichtig. Ein kurze Szene zu Anfang des Films kann das Verfahren erläutern: Der Gerichtsmediziner, dem Jeffreys Fundstück vorgelegt wird, erklärt, daß das Ohr von einem lebenden Menschen stammt und "mit einer Schere" abgeschnitten wurde. Nach einem harten Schnitt sehen wir eine Schere in Großaufnahme, die ein Plastikband durchschneidet, von entsprechendem, überlautem Schnittgeräusch begleitet. Das Band dient der Polizei zur Absperrung. "DON'T CROSS" lesen wir und die Schere trennt das "DON" ab. Zu Don gehörte einmal das Ohr, und 'Don' ist ein Name, den wir noch oft im Film hören werden, vor allem, da der Akzent der Hauptdarstellerin es oft schwierig macht, zwischen 'Don' und 'don't' zu unterscheiden. Die Assoziation der brutalen Information ("ein Mensch, dem das Ohr mit einer Schere abgeschnitten wurde") verweist auf eine Kastration; mit dem Filmschnitt und dem Scherengeräusch ergiebt sich fast zeitgleich ihre Dissoziation, da auf die Struktur des Texts selbst hingewiesen wird -- filmische Assoziation funktioniert schließlich durch Montage. Und die ständige Kastrationsdrohung, die die imaginäre Herrschaft des Zuschauers über den Film bedroht, sorgt wiederum für die emotionale Einbindung in den Film. Diese komplexe emblematische Dissoziation findet ihre Umkehrung in der Echolalie. Das Wort 'Fuck' zum Beispiel verliert durch die andauernde, sinnlose Wiederholung seine Schockwirkung: "Fuck you, you fucking fuck," erklärt der Gangster. Hier wird der Sinn quasi erschöpft, ausgelaugt, bis nur noch die entleerte Worthülse übrig bleibt. |
||||
Es ist an dieser Stelle nun nötig, kurz die Geschichte von Blue Velvet ins Gedächtnis zurückzurufen. Der Prolog definiert die Atmosphäre für den gesamten Film und hat David Lynch den Ruf eines postmodernen Regisseurs eingebracht. Nach einer Montage von hyperrealen Bildern (Rosen, so rot wie ein Feuerwehrwagen, knallgelbe Tulpen vor einem weißen Zaun und einem tiefblauen Himmel) sehen wir einen Mann -- Jeffreys Vater, wie sich herausstellen wird -- beim Gießen. In einer schnellen Montage folgen nun Großaufnahmen des Gartenschlauchs, der sich im Gebüsch verfangen hat und des Mannes, der am Schlauch zerrt. Der folgende 'Unfall' bleibt rätselhaft: Ist es ein Schlaganfall, eine Herzattacke, ein Insektenstich oder gar ein Trauma? Während Jeffreys Vater hilflos am Boden liegt, eröffnet sich uns ein grausam-komisches Bild der Verkennung. Ein kleines Kind schaut fasziniert zu wie ein Hund mit dem Wasserstrahl spielt. Die Kamera nährert sich nun dem Gras und enthüllt in extremer Großaufnahme, was unter dem wohlgepflegten Vorstadtrasen vorgeht: Begleitet von Rascheln und Schmatzen, sehen wir schwarze Käfer, die sich anscheinend bekämpfen. Mag auch diese Metapher für den moralischen Zustand der Stadt etwas plakativ erscheinen, so ist doch die Betonung von "Ohr/(Zu-/Ver-)Hören" mehr als nur ein Gag: Jeffrey's Abstieg in die Unterwelt wird von einer Kamerafahrt in die abgeschnittene Ohrmuschel buchstäblich eingeläutet -- auf der Tonspur hören wir seltsam dumpfe Geräusche, die an die Maschinengeräusche der monströsen Morlocks in H.G. Wells' The Time Machine erinnern. |
||||
Wie Jeffrey später herzusfinden wird, gehört das Ohr Don Valens, dessen Ehefrau Dorothy (Isabella Rossellini ) von Frank Booth (Dennis Hopper) erpreßt wird. Frank hat nicht nur Don, sondern auch Donnie, Dorothys Sohn, in seiner Gewalt. Die Tochter des Detektivs, Sandy (Laura Dern), hat bei ihrem Vater gelauscht und Jeffrey (Kyle MacLachlan) auf die richtige Spur gebracht. Als Kammerjäger verkleidet, verschafft sich Jeffrey bei Dorothy, einer Nachtclubsängerin, Eintritt und entwendet einen Zweitschlüssel. Als er nachts Dorothys Apartment durchsucht, wird er von dieser überrascht und gezwungen, sich auszuziehen. Dorothy gibt der Situation schnell eine sadomasochistische Wendung. Als die beiden plötzlich von Frank überrascht werden, kann Jeffrey gerade noch in den Wandschrank fliehen. Er wird nun Zeuge der Szene, die sich den meisten Zuschauern ins Gedächtnis eingegraben hat: Frank, der erst ein geheimnisvolles Gas aus einem mitgebrachten Behälter inhaliert hat, regrediert sichtlich ("Baby wants to fuck! Baby wants to fuck Blue Velvet!!"). Mit einem Stück blauem Samt als Nabelschnur inszeniert er eine lautstarke Kopulation, wobei Frank weder seinen Gürtel öffnet, noch die Hosen herunterläßt. Jeffrey als hilfloser Voyeur ist sichtlich fasziniert von dieser Urszene. Während sich zwischen Jeffrey und Sandy eine zarte Romanze entwickelt, hat die mysteriöse Dorothy eine dunkle Leidenschaft in Jeffrey entfacht. Bei seinem zweiten Besuch bei Dorothy (sie wohnt -- nomen est omen -- im Apartmentkomplex Deep River) schlafen die beiden miteinander und Dorothy muß Jeffrey nicht lange verführen, sie beim Sex auch zu schlagen. |
||||
Frank und seine Gang passen Jeffrey ab, als dieser Dorothys Apartment verläßt. Nach einem Zwischenstop bei Ben, der Dorothys Sohn gefangen hält und ein Bordell mit übergewichtigen und überreifen Damen führt, erklärt Frank, daß Jeffrey sein Doppelgänger sei, bevor er ihn unter den Klängen von In Dreams von Roy Orbison zusammenschlägt. Erst jetzt übergibt Jeffrey seine gesammelten Indizen an Detective Williams: Das wichtigste Mitglied von Franks Bande, der Mann in der gelben Jacke, ist ebenfalls Polizist und Detective Williams' Partner. |
||||
Dorothy erscheint nun verwirrt und blutig bei Jeffrey und bittet ihn um Hilfe. Was Jeffrey in Dorothys Apartment vorfindet, gleicht einem Alptraum. Der Mann in der gelben Jacke hat zwar eine Kopfwunde, steht jedoch noch auf seinen Beinen. Ein weiterer Mann, dem ein Ohr fehlt und von dem wir daher annehmen müssen, daß es Don ist, ist tot. Als Jeffrey das Apartment verlassen will, sieht er sich in einer Falle. Frank konnte der Polizei entkommen und ist auf dem Weg ins Apartment. Mit einem Trick gelingt es Jeffrey, sich Zeit zu verschaffen. Mit dem Funkgerät des Polizisten alarmiert er Detective Williams und teilt ihm mit, wo er sich versteckt, wohl wissend, daß Frank mithören kann. Die falsche Fährte lenkt Frank lange genug ab. Jeffrey kann den Revolver des Polizisten an sich bringen und Frank damit erschießen. |
||||
Der Epilog beginnt mit einer Fahrt aus Jeffreys Ohr heraus. Wir sehen ihn in seinem kleinbürgerlichen Idyll auf einem Liegestuhl im Garten liegen. Sandys und Jeffreys Eltern verstehen sich großartig. Die letzte Einstellung zeigt ein Rotkehlchen, augenscheinlich mechanisch, das einen noch zappelnden, schwarzen Käfer im Schnabel hält. |
||||
Die Detailaufnahmen der Ohren -- erst des schimmligen, abgetrennten Ohrs, dann, am Ende des Ohres von Jeffrey -- klammern die Handlung ein. Diese Kamerafahrten könnten natürlich bedeuten, daß wir es hier mit einem Alptraum zu tun haben, das alles nur "im Kopf" stattfindet. Roy Orbisons Ohrwurm scheint zunächst auch dafür zu sprechen -- In Dreams, Franks Lieblingslied, das dieser jedoch nach der ersten Zeile "Candy-Colored Clown" nennt: |
||||
"A candy-colored clown they call the sandman |
||||
Der Satz "In dreams I walk with you, in dreams I talk to you" bekommt hier eine sinistre Bedeutung alleine dadurch, daß die Szenen uns zwingen, genauer zu lauschen und die süßliche Melodie als ironischen Bruch zu verstehen. Mit dem Ohr ist die Trennung zwischen Traum und Wirklichkeit abhanden gekommen. Der Alptraum kann ungehindert in die Welt entweichen. |
||||
Auch die Verweise auf andere Filme stellen einen intertextuellen Bezug zum Ohr her. Der erste Spaziergang von Jeffrey und Sandy verweist auf den Spaziergang von George und Mary in It's a Wonderful Life von Frank Capra (1946). Der Held dieser berühmten Weihnachtsschnulze ist auf einem Ohr taub, da er einst seinen Bruder vor dem Ertrinken gerettet hatte. Als George und Mary noch fast Kinder sind, fragt Mary einmal: "Is this the ear you can't hear on?" Danach flüstert sie in das taube Ohr: "George Bailey, I'll love you 'til the day I die." In der virtuellen Welt ohne die Tat, die zum Verlust des Hörsinns führt, ist die uramerikanische Kleinstadt zu einem Sündenpfuhl heruntergekommen. In It's a Wonderful Life trennt das Ohr die Welten säuberlich in eine aktuelle und eine virtuelle, während in Blue Velvet das Böse direkt unter der Oberfläche lauert. Der intertextuelle Dialog mit It's a Wonderful Life beweist jedoch, daß Blue Velvet das Vorbild nicht unterschätzt. Das virtuelle Bedford Falls, die heruntergekommene Stadt der Betrüger und Trinker, spiegelt natürlich das real existierende Amerika wider, während die heile Welt mit George Bailey in ihr die amerikanische Kleinstadt, eine filmische Phantasie, darstellt. |
||||
Wie bereits eingangs erwähnt wurde, trennt Blue Velvet das Ohr buchstäblich vom Hören, genauer gesagt vom Hörsinn, wie in der Doppeldeutigkeit von 'Don' und 'don't', oder der Betonung des Wortes Blau: "Heineken? Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon!", erklärt Frank. Etwas eleganter als dieses Bekenntnis zum proletarischen Geschmack ist da zum Beispiel Sandys erster Auftritt, der eher eine Erscheinung als ein Erscheinen ist. Zuerst hören wir ihre Stimme, dann erfolgt ein point-of-view-shot aus der Perspektive Jeffreys. Wir sehen allerdings zuerst nur die schwarz-blaue Nacht, aus der Sandy dann hervortritt. Sie kommt buchstäblich 'out of the blue' (eine idiomatische Redewendung für 'aus heiterem Himmel'). Eine ähnliche lautmalerische Konstruktion liegt Franks blutigem Ende zugrunde: "I'll blow his fuckin' brains out!" -- diesen Satz hört man oft in amerikanischen Filmen. Wir sehen Frank dann in der Tat erschossen daliegen, sein Gehirn über dem Boden verteilt. Ein weiterer 'sight gag' bedarf vielleicht der Erklärung: Der Mann in Gelb trägt eine gelbe Jacke (engl.: 'a yellow jacket'). 'Yellow Jacket' aber ist die umgangssprachliche Bezeichung für eine Hornisse. Blue Velvet inszeniert noch mehr solcher Scharaden. Die genannten Beispiele sollten jedoch genügen, das Verfahren klarzumachen: Ein Homonym oder eine ideomatische Redewendung werden als Rebus inszeniert. Die Interpretation dieser Übersetzungsleistung kann natürlich immer nur nachträglich geschehen, nach dem Film, beim zweiten oder dritten Sehen -- eine Dissoziation, die verhindert, daß der Film unreflektiert konsumiert wird. |
||||
Überhaupt ist das Hören und das Miß- und Nichtverstehen wichtig für Blue Velvet. Wenn Sandy, die vor Dorothys Apartmenthaus Schmiere steht, das verabredete Signal gibt (sie hupt), betätigt Jeffrey gerade die Toilettenspülung, da er zuvor zuviel Heineken getrunken hatte. Im Rauschen der Toilettenspülung geht die Warnung unter ("the signal is drowned out") und Jeffrey muß sich im Wandschrank verstecken. Während dieses Überhören die Geschichte erst so richtig ins Rollen bringt, wäre der Amateurdetektiv Jeffrey schon zu Anfang gescheitert, hätte Sandy nicht ihren Vater belauscht. Zu Franks sadistischen Tricks schließlich gehört das absichtliche Mißverstehen: |
||||
"Frank: You wanna go for a ride? |
||||
Da Frank hier und in vielen anderen Szenen das richtige Verstehen für sich selbst in Anspruch nimmt, ist es bezeichnend, daß er den simplen Trick Jeffreys am Ende nicht durchschaut, wenn dieser per Funkgerät verkündet, daß er sich im hinteren Zimmer verstecken werde. Ganz wie in Lacans berühmter Interpretation von "The Purloined Letter" geht es hier um wechselnde Positionen. Der Große Andere ist wie immer ahnungslos, während Frank mit Jeffrey die Position wechselt. Letzterer ist nun buchstäblich am Drücker, während Frank hört, aber nicht sieht: "I can hear your fucking radio, you stupid shit!" |
||||
Was an Blue Velvet besticht, ist, daß -- allen Dekonstruktionen zum Trotz -- der Film als Film faszinierend bleibt und nicht in intellektuelle Rätselspielchen zerfällt. Der Schlüssel hierzu ist die Urszene mit Jeffrey, Frank und Dorothy. Auch hier scheint die Symbolik zunächst allzu offensichtlich: Jeffrey fungiert als Platzhalter für die voyeuristischen Gelüste der Zuschauer. Statt 'echtem' Sex bekommen wir dann allerdings nur eine Travestie zu sehen. Daß uns diese -- allerdings faszinierende -- Travestie unverständlich bleibt und bedrohlich erscheint, verweist auf die Freudsche Urszene, denn aus der Perspektive des vorpubertären Kindes muß der elterliche Sex als unverständliche Handlung traumatisieren. Im Falle von Blue Velvet drängt sich die vorschnelle symbolische Interpretation nun geradezu auf: "Aha! Hier liegt der Ursprung der Neurose!" An diesem Punkt zeigt sich jedoch die wahre Brillianz des Films: Wie viele andere Symbole in Blue Velvet führt auch dieser hastige Schluß in die Irre. Denn was die Trennung von Ohr und (Hör-)Sinn auseinanderreißt, kann man nicht so einfach wieder zusammenfügen (Symbol, von symballein (gr.: zusammenfügen). Die Neurose hat nun mal keinen Ursprung, sondern setzt sich diesen paradoxerweise retrospektiv selbst. Nur aus der radikal eingeschränkten Perspektive der Neurose macht dann nachträglich alles Sinn. Freuds 'Nachträglichkeit' muß man in diesem Sinne verstehen. |
||||
In der Ambivalenz der Geräusche (Ist es Lust? Ist es Schmerz?) liegt der Schlüssel zu Blue Velvet. Es sind natürlich die ambivalenten Geräusche aus dem elterlichen Schlafzimmer, die das Kind neugierig machen. Der springende Punkt ist jedoch, die Urszene nicht als Zuschauer, quasi von außen, mißzuverstehen, sondern die Szene als Urszene aller folgenden Szenarien zu begreifen. Denn bei Freud illustriert die Urszene nicht das traumatisierende Nichtverstehen des unaufgeklärten Kindes, sondern ein grundlegendes Phantasma: Die Urszene beschreibt das unstillbare Verlangen, der eigenen Zeugung beizuwohnen. Wie auch die kindliche Rachephantasie, Zeuge der eigenen Beerdigung zu sein, leugnet das Phantasma der Urszene unsere Sterblichkeit. In Mark Twains The Adventures of Tom Sawyer finden wir ein schönes Beispiel für dieses 'Wenn ich tot bin, werdet ihr schon sehen ...' - die beiden totgeglaubten Helden werden hier Zeuge ihrer eigenen Beerdigung. Die Perspektive dieses Phantasmas ist die des gottgleichen Beobachters im Hollywoodkino, der stets seine Eingebundenheit in die Szene verkennt. Die Urszene in Blue Velvet ist damit zugleich die Urszene des Kinos und diese ist nicht der Voyeur, sondern der neugierige Lauscher, der das eindeutige Bild und den undeutlichen Ton zusammenbringen will. Das Emblem dieser nachträglichen Zusammenfügung ist das abgeschnittene Ohr, das weiterhin hört, das Ohrgan. Die Mehrdeutigkeiten in Blue Velvet (der rätselhafte Unfall des Vaters, der lebende Tote am Ende, etc.) sind daher tatsächlich postmodern, wenn wir die Postmoderne als Abkehr von einer modernen Rekonstruktion eines mythischen Ursprungs verstehen. |
||||
Das Emblem des abgeschnittenen Ohrs erlaubt uns, das komplexe Programm von Blue Velvet zu erfassen. Die Dissoziierung von Ohr und Körper trennt Sinn von Organ. Zuerst muß das Glied vom Leben abgetrennt werden, damit wir es lesen können, denn, wie Walter Benjamin es im Trauerspielbuch ausführt, "die Allegorisierung der Physis kann nur an der Leiche sich energisch durchsetzen." Dieses Trauma der Dissoziierung impliziert nachträglich, daß Sinn und Wort im Organ ursprünglich ihre Einheit fanden. Das klassische Hollywoodkino macht sich dies zu Nutze, wenn es eine Heilung dieses Traumas im Symbol verspricht. Der Effekt des Ohr-Emblems, des Ohrgans, in Blue Velvet ist aber, daß der paradoxe Charakter dieser Zusammenfügung, die ihre ursprüngliche Trennung nachträglich setzt, nun offensichtlich wird. Es ist die Allegorie des Kinos selbst: Dem Zuschauer von Blue Velvet wird klar, daß er stets (Wort-)Sinn in Bild und Bild in (Wort-)Sinn übersetzen muß und daß diese Über/setzung nie ganz aufgehen kann. Walter Benjamin stellt anläßlich dieser Diskrepanz zwischen "bildlichem Sein und Bedeuten" fest, daß im "Abgrund der Allegorie die dialektische Bewegung braust". |
||||
Die Trennung von Wort und Sinn in Blue Velvet verkündet damit nichts weniger als eine Überlegenheit der Allegorie über das Symbol. Die gesamte Symbolik in Blue Velvet kann daher auch zu nichts anderem führen als zu vorschnellen Schlüssen. Das Rotkehlchen zum Beispiel symbolisiert für Sandy eine Welt der Liebe und des Lichts; wenn das Rotkehlchen dann am Ende des Films mit dem schwarzen Käfer im Schnabel als unheimliche Maschine auftaucht, ist dieses Symbol genauso eindimensional wie die Doppelgänger, die der Film manichäisch inszeniert (Jeffrey und Frank, Dorothy und Sandy, Detecive Williams und sein Partner). Interessanterweise aber zerstört diese Allegorisierung nicht den Spaß am Film, im Gegenteil, Blue Velvet bleibt trotz der ständigen Selbstreferenzen faszinierend. Unter diesem Gesichtspunkt ist Blue Velvet zum Beispiel Godards Notre Musique (2004) überlegen. Godards filmischer Essay über den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien, die westliche Kultur, ihre Bilder und Musik läßt verschiedenste Allegorien im Text selbst erscheinen. Der Regisseur zum Beispiel tritt unter seinem eigenen Namen auf als alternder Voltaire, der hilflos seinen Garten pflegt und der Jugend nichts mehr beibringen kann. Indianer in voller Tracht laufen durch das zerstörte Sarajevo, eine Allegorie der Völker, die der Westen zerstört hat. Das Paradies schließlich ist ein Strand, von amerikanischen GIs bewacht, an dem sich die Jugend in narzißtischen Spielen ergeht. Im Fall von Blue Velvet dagegen inszeniert der Text selbst die Allegorie des Ohrs im Film. Während Godard auf eine Wahrheit hinter den Bildern verweist, auch wenn diese Wahrheit verkündet "Es gibt keine Wahrheit", bleibt Blue Velvet einem viel radikaleren Modell verhaftet. Wie das Rebus des Traums, der bei Freud nicht beliebig interpretierbar ist, oder die strukturelle Position des Analytikers als "Subjekt supponiert zu wissen", bleibt der Film eine geradezu götzenhafte Instanz, die dogmatisch den Platz der Wahrheit einnimmt: In einem Film hat alles Bedeutung. |
||||
|
autoreninfo

Dr. Oliver C. Speck promovierte an der Universität Mannheim in Germanistik zum filmtheoretischen Problem der Subjektivität. Seitdem lebt er in den Vereinigten Staaten, zuletzt in Wilmington (North Carolina), wo er als Assistant Professor of German Deutsch, Filmgeschichte und Filmtheorie unterrichtet.
Homepage: http://www.uncw.edu/people/specko |
||||
|
|