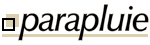
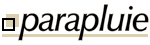 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 20: ohr
|
Hören -- Hörverlust -- Hörgerät? |
||
von Susanne Bisgaard |
|
Das Erkennen eines Hörverlusts ist häufig eine langwierige Angelegenheit. Vielen kann durch den Einsatz von Hörgeräten geholfen werden. Einige erleben die Anpassung eines solchen Geräts wie jede andere mehr oder weniger problemlose Anschaffung einer neuen Technologie. Andere wiederum erfahren es als einen deutlichen Konflikt zwischen dem, was sie als vertraut und normal und dem, was sie als künstlich, laut und fremd empfinden. Dies bezieht sich dabei oft auf die nach wie vor eingeschränkten Möglichkeiten der Technologie, das Hörproblem zu lösen. Daneben gibt es jedoch noch weitere Parteien in diesem Konflikt: auf der einen Seite das Individuum und auf der anderen die Nahestehenden und die Gesellschaft, die sich aktive und teilnehmende Mitglieder wünschen. Als Ergebnis schwanken die Betroffenen zwischen zwei Gegenpolen: Isolation oder Partizipation. |
||||
"Im Grunde genommen höre ich ausgezeichnet. Wenn ich nur meine Frau dazu überreden könnte, deutlicher zu sprechen, dann wäre alles in Ordnung." Aussagen dieser Art spiegeln eine Konstruktion der auditiven Wirklichkeit wider, die von einer zunehmenden Hörschwäche durchsetzt wird. Oft wird hinzugefügt: "Na ja, junge Menschen sind eben schwierig zu verstehen -- sie nuscheln!" Oder: "Wer sagt eigentlich, daß ich Lust habe, alles zu hören, was gesagt wird? Es wird so viel Unnötiges geschwätzt!" Wiederum andere nehmen die Hörschwäche als eine persönliche Verantwortung wahr: "Wenn ich mich nur besser konzentrieren könnte, würde das Problem nicht existieren!" |
||||
Der unterschiedliche Umgang mit einer Hörschwäche reflektiert die Vielfältigkeit unserer menschlichen Existenz und ist eng mit der persönlichen Weltsicht und dem eigenen Selbstverständnis verbunden. Aber auch die Art der Hörschwäche und die individuelle Relevanz des Hörens im Leben der Betroffenen spielen ganz wichtige Rollen. |
||||
Seit Sommer 2003 forsche ich in Dänemark über Erwartungen an und Erfahrungen mit Hörgeräten von neuen Hörgerätträgern. Es handelt sich um eine study in progress, bei der ich mit 38 erwachsenen Personen zusammenarbeite, die an einem graduellen Hörverlust leiden. Ich begleite jeweils 19 Männer und Frauen im Alter von 42-92 Jahren durch den Prozeß, Anwender eines Hörgeräts zu werden. Dabei frage ich, welche Faktoren die Anschaffung des Geräts ausgelöst haben, welche Probleme mit der Schwerhörigkeit verbunden sind, welche gesellschaftliche Einrichtungen die Probleme zu beseitigen versuchen, und wie die Betroffenen die Technologie in ihren Alltag integrieren. |
||||
Bei meiner Forschung wird deutlich, daß die Hörschwäche sehr unterschiedlich bewertet wird. Hinter dem Hörproblem mag eine meßbare Hörschwäche stecken, aber durch die äußerliche Unsichtbarkeit ist seine Repräsentation ausschließlich sozial, kulturell und existentiell. Eine Schwäche zu offenbaren, wird oft als unvereinbar mit gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten, Fortschritt, persönlicher Entwicklung und körperlicher Schönheit betrachtet. Im Alltag kostet es die meisten Menschen viel Energie, sich so perfekt wie möglich zu inszenieren, und in diesem Zusammenhang wird die Sichtbarmachung einer Schwäche durch ein Hörgerät nicht als förderlich angesehen. Das Nichttragen eines Hörgeräts im tatsächlichen Kontakt kann einem zugleich eine ebenso abqualifizierende Bewertung eintragen: Um fit, selbständig und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein Hörgerät unumgänglich. |
||||
Laut der 'International Classification of Functioning, Disability and Health' der Weltgesundheitsorganisation wird eine Funktionsbeeinträchtigung erst in der Begegnung mit der Gesellschaft eine Behinderung. Bei einer Hörschwäche heißt das, daß der Schwerhörige mit der gesellschaftlichen Konstruktion "schwerhörig" versehen wird. Der Grund, weshalb das Hörgerät diese Konstruktion nicht beseitigt, liegt zum einen darin, daß die Hörschwäche z.B. unter schlechten akustischen Verhältnissen weiterhin bestehen bleibt, zum anderen darin, daß -- wie unsichtbar auch immer -- das Hörgerät als Emblem eines körperlichen Defizits gilt. |
||||
Genaue Angaben über die Zahl der Betroffenen sind schwer zu bekommen. Laut Hear-it, einer Organisation, die sich für Hörgeschädigte einsetzt, betrug die Zahl der von Hörverlust Betroffenen in Europa 1995 ungefähr 70 Millionen Personen. Schätzungsweise wird die Zahl bis 2005 auf 80 Millionen bei einer Bevölkerung von über 700 Millionen steigen. Innerhalb der EU leben ungefähr 37 Millionen Hörgeschädigte, 13,3 Millionen davon in Deutschland. Jeder 20. Erstklässler in Baden-Württemberg leidet mittlerweile an Hörverlust (Hear-it 2002). Wir reden also von einer beträchtlichen Anzahl von Menschen, die aktuell oder potentiell nur durch Hörgeräte in einen sinnvollen Kontakt mit der Umwelt treten können. |
||||
Das Verschwinden der Geräuschkulisse | ||||
Der Hörverlust kann sehr plötzlich eintreten. Dies kann Panik und einen Krisenzustand für die betroffene Person auslösen, die vermutlich ärztlichen Rat mit der Hoffnung auf Heilung einholen wird. Viel üblicher ist jedoch ein allmähliches Schwinden der Hörleistung, bei dem die Person langsam in eine leisere Welt gleitet, in der sie zu vergessen scheint, wie scharf, laut, nuanciert oder klangvoll das Leben tönen kann. |
||||
Wenn das Gehör nachläßt, verschwinden mehr und mehr Laute, und die Betroffenen lernen, stärker auf das gesprochene Wort zu achten. Sie nehmen häufig Lücken in Sätzen wahr, weil Konsonanten (wie f, k, und s) verschwinden, so daß es schwierig wird, zwischen Wörtern wie 'fahl', 'kahl' und 'Saal' zu unterscheiden. Sie müssen ständig kombinieren, was in einem bestimmten Zusammenhang wohl gesagt wird und eine deutlich höhere Konzentrationsleistung in einer Gruppensituation aufbringen als jemand mit gesunden Ohren. |
||||
Viele Menschen verlieren mit der einsetzenden Schwerhörigkeit mehr als ihr Gehör -- sie verlieren ihre Selbstachtung, schämen sich eventuell sogar und fühlen sich schuldig. Dies mag zunächst überraschen; mit der Fähigkeit zu hören ist jedoch weit mehr verbunden als die Signale, welche das Ohr erreichen, wahrzunehmen und zu verstehen. Es bedeutet zugleich, 'schlau' genug zu sein, auf das Gesagte zu reagieren. Unsere Eltern und Lehrer sagen uns als Kind, daß wir Ärger bekommen, wenn wir nicht hören. So fühlen wir uns schuldig, wenn wir Dinge mißverstehen. |
||||
Ein Hörverlust zwingt die Betroffenen nicht nur dazu, sich mehr auf das Gespräch zu konzentrieren. Er zwingt sie zugleich dazu, ihre eigene sowie die Annahme ihrer Gesprächspartner zu hinterfragen, daß sie nicht verstanden haben, weil sie nicht genug aufgepaßt haben. Es ist ein zweifach frustrierendes Szenario, in dem die Betroffenen sich nicht nur für ihre Hörschwäche schämen, sondern zugleich noch mit der Verärgerung ihrer Gesprächspartner umgehen können müssen, daß sie 'nicht richtig zuhören'. |
||||
Hören = Zu- und Angehören | ||||
Die Sinne sind die Mittel zur Erkenntnis der anderen. Was wir von den anderen sehen, hören, fühlen und riechen ist die Brücke, über die wir die anderen erkennen(Simmel 1908). Was vermittelt wird, ist aber keine objektive, präkulturelle Größe. Die Sinne sind höchst kodierte Werkzeuge, die körperliche Wahrnehmung in kulturell wiedererkennbare Formen umsetzen. Sie umfassen und verhandeln sinnliche Erfahrungen in einer Wechselwirkung von kulturell vorgeschriebenen persönlichen Idiosynkrasien und Normen (Herzfeld 2001). |
||||
Über den Hörsinn können uns Informationen zugänglich gemacht oder vorenthalten werden. Wir können flüstern und ein Geheimnis mit ganz wenigen Menschen teilen und andere ausschließen. Oder wir können in einem Auditorium oder am Bahnhof mit vielen anderen Menschen zusammen Informationen aufnehmen, die für alle zugänglich sind. Die von Schwerhörigkeit Betroffenen haben nur noch reduzierte Möglichkeiten, die allgemeine Geräuschkulisse wahrzunehmen. Sie werden oft später als andere vor Gefahren in ihrem Umfeld gewarnt, im Verkehr müssen sie sich eher auf ihre Augen als ihre Ohren verlassen. |
||||
Durch das Gehörte sind wir weitgehend sozialisiert worden, es verleiht unserer Existenz den Sinn, der uns zu Mitgliedern einer hörenden Kultur macht. Versteht man unter Kultur all die Praktiken, Artefakte und Werte, die in einer sozialen Gruppe entwickelt und weitergegeben werden, so impliziert Kultur die von allen Menschen geteilte Fähigkeit, mit der sozialen Welt wie auch mit der natürlichen Umwelt produktiv und sinnhaft in Auseinandersetzung zu treten. Bei Schwerhörigkeit wird die Entwicklung von Werten und Ideen -- oft im Dialog mit anderen -- und ihre Weitergabe an andere betroffen. In einem Dialog wird Sinnzuschreibung in verschiedenen Kontexten unterschiedlich ausgelegt und verhandelt -- dabei geht es oft um Nuancen. Aber wenn man Schwierigkeiten hat, einem Gespräch zu folgen, wenn man Auseinandersetzungen häufig falsch versteht, können sich die Relationen zu der eigenen Bezugsgruppe ändern. |
||||
Schwerhörigkeit als Normverletzung | ||||
Es gibt keine zwei Menschen, die ihre Hörschwäche gleich empfinden -- auch gehen sie sehr unterschiedlich mit den dadurch entstehenden Herausforderungen um. Deswegen gelten die folgenden Beobachtungen nicht für alle Schwerhörigen, aber es sind Themen, die bei vielen meiner Gesprächspartner immer wieder auftauchen. |
||||
Hörverlust ist eine Kommunikationsbarriere, die beide Parteien in einem Gespräch zu spüren bekommen können. Um die Botschaft an ihr Ziel zu bringen, müssen sich sowohl die schwerhörige als auch die normalhörende Person besonders einsetzen. Da die Hörschwäche nicht äußerlich erkennbar ist, stellt sich auch nicht automatisch Fürsorge und Rücksicht ein. Die hörbehinderte Person ist entsprechend diejenige, die die Initiative ergreifen, offen und hartnäckig sein muß, um die anderen dazu zu ermuntern, deutlicher zu sprechen. |
||||
Betroffen von der Hörschwäche sind somit auch die Menschen, mit denen die Schwerhörigen in ihrem unmittelbaren Umfeld im Kontakt stehen. Seien es tiefe, bedeutungsvolle Gespräche oder spielerische Neckereien -- der Gedankenaustausch kann langsamer und schwerfälliger werden. Von der Familie und den Freunden wird Mitgefühl und Rücksicht erwartet -- diese mögen jedoch nicht immer die nötige Energie dafür besitzen. |
||||
Viele Schwerhörige empfinden es als belastend, daß sie wiederholt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und andere ständig bitten müssen, deutlicher zu sprechen. Die meisten haben es versucht, mit dem Resultat, daß die Gesprächspartner vielleicht fünf Minuten deutlicher sprechen, um dann wieder in die alte Sprechweise zurückzufallen. Dies geschieht weniger aus Mangel an Rücksicht, als vielmehr weil es anstrengend ist, für lange Zeit lauter und artikulierter zu sprechen. |
||||
Es ist eine ganz normale menschliche Eigenschaft, zwischendurch vorzutäuschen, daß man verstanden hat, was gesagt wird. Schwerhörige Menschen tun dies jedoch viel häufiger. Sie raten, lächeln und nicken -- und hoffen, daß es an der richtigen Stelle war. Oft gelingt es, -- sie wollen rücksichtsvoll sein und nicht dauernd nachfragen -- aber manchmal kann es auch vollkommen falsch laufen. Eine meiner Informantinnen erzählte, daß sie bei einem Fest einem traurigen Bericht einer Frau beiwohnte. Als sie sich später wiedertrafen, war die andere überrascht, daß sie nichts von dem schrecklichen Ereignis wußte. (Sie hatte damals offensichtlich von einem Selbstmord im Bekanntenkreis berichtet.) Von der Vortäuschung zu erzählen, schien für meine Informantin fast schlimmer zu sein, als sich wenig einfühlsam zu zeigen. |
||||
'Konzentration' ist ein oft fallender Begriff bei der Befragung von Hörbehinderten. Sie lesen zur Unterstützung häufig die Lippen ihres Gegenübers, wobei sie Blickkontakt mit dem Sprecher brauchen, um sich völlig konzentrieren und alle Einzelheiten des Gesprächs aufnehmen zu können. Ein Mensch mit normalem Hörvermögen mag es befremdlich finden, daß die hörbehinderte Person ihn die ganze Zeit anzustarren scheint. Ein solches Verhalten gilt normalerweise als unhöflich und wirkt sich belastend auf das Gespräch aus. |
||||
Manche Betroffene sprechen selbst die ganze Zeit, um andere daran zu hindern zu sprechen oder Fragen zu stellen, die sie vielleicht nicht zu beantworten vermögen. Andere bleiben still und ziehen sich aus dem Gespräch zurück. Auch kommt es häufig vor, daß jemand aufgrund seiner Hörschwäche lauter spricht als er sollte, da es schwierig wird, die Lautstärke richtig zu beurteilen. Neue Hörgerätträger dagegen sprechen oft zu leise, weil ihre eigene Stimme ihnen oft sehr laut vorkommt. Bei manchen scheint es eine Sache der Gewohnheit zu sein -- für andere bleibt es ein Dauerproblem. |
||||
Schwerhörige Menschen reagieren nicht immer, wenn sie angesprochen werden, was dazu führen kann, daß sie als arrogant betrachtet werden. Wir möchten alle gerne verstanden werden und unterhalten uns am liebsten mit anderen, die uns verstehen, und mit denen wir Ideen austauschen können. Wir sprechen von der 'gleichen Wellenlänge', ohne diesen Begriff näher zu definieren. Schwerhörigkeit ist aber eine Barriere, die den Gleichklang stören und für beide Gesprächspartner zum Problem werden kann -- ohne daß die Hörschwäche als eigentliche Ursache dabei den beiden Parteien bewußt ist. Zwischendrin z.B. vorzutäuschen, man habe verstanden, was gerade gesagt wurde, wird der erwarteten und erhofften Reaktion auf eine Aussage oder Bitte seitens des Normalhörenden nicht gerecht. Dieser Umstand gilt als Erklärung dafür, warum Schwerhörige oft isoliert werden: das magische Moment des 'Sich-Verstehens' ist mit ihnen schwieriger zu erlangen. Die Normalhörenden fangen entweder an, an den eigenen Argumenten zu zweifeln, oder sie empfinden den Schwerhörigen als wenig verständnisvoll. In beiden Fällen kann das Ergebnis sein, daß die Normalhörenden sich lieber mit anderen unterhalten. |
||||
Als Gesamtphänomen führt dies häufig dazu, daß Schwerhörige als normverletzend gesehen werden. In dem englischen Ausdruck 'deaf and dumb' (taubstumm) bedeutet 'dumb' auch dumm. Die Zuschreibung von Eigenschaften in Verbindung mit einer Behinderung scheint weder kulturspezifisch noch an eine besondere Epoche geknüpft zu sein. Schon in der Antike wurde der Blinde in der Tragödie dargestellt, der Taube in der Farce oder der Komödie. Wer tatsächlich am meisten leidet, der Blinde oder der Taube, ist eine oft diskutierte Frage. Die meisten fürchten die Abhängigkeit der Blinden und sagen: "Lieber taub als blind!" Helen Keller aber bemerkte dazu: "Nicht sehen trennt den Menschen von den Dingen. Nicht hören trennt den Menschen vom Menschen." |
||||
Strategien im Umgang mit der eigenen Behinderung | ||||
Während der Durchführung einer Audiometrie (dem audiologischen Meßverfahren) bei einem meiner Informanten sagte mir die Hörgerätakustikerin: "Es ist unglaublich, daß er sich mit einem solchen Audiogramm mit uns unterhalten kann. Er bekommt fast nichts von den hohen Frequenzen mit!" Hier spielt das, was ich die 'kulturelle Überbestimmtheit der Sprache' nennen möchte, eine große Rolle. Die Sprache bewegt sich innerhalb gewisser Strukturen, die kulturell festgelegt und erlernt werden, und die dem Betroffenen in vielen Fällen ermöglichen, die fehlenden Frequenzen aus dem Gedächtnis zu ersetzen. Oft macht man sich über Schwerhörige lustig und sagt: "Sie verstehen schon, wenn sie verstehen wollen!" Von einigen wird die Hörschwäche sicher manchmal als Vorwand benutzt, nicht zu verstehen. Aber häufig geht es eher darum, ob man eine Ahnung vom Thema hat, um auf die kulturelle Überbestimmtheit der Sprache aufbauen zu können. |
||||
Unabhängig von diesen, vielen Betroffenen zuwachsenden Kompensationsfähigkeiten wählen Schwerhörige unterschiedliche Strategien zur täglichen Bewältigung ihres Defizits. Extrovertiertere Personen gehen offensiver mit dem Problem um, wie in verschiedenen Interviews deutlich wurde. Bei ausreichendem Selbstvertrauen müssen Mißverständnisse kein Anlaß zur Scham sein, sondern können stattdessen gemeinsames Lachen provozieren. So erzählt ein Gesprächspartner von humorvollen Auseinandersetzungen mit seinen erwachsenen Söhnen, eben weil er sie so oft falsch verstehen würde. Für ihn war Humor ganz deutlich eine wesentliche Strategie, um seinen Verlust zu meistern und sich seiner Bezugsgruppe weiter zugehörig zu führen. |
||||
Die Bedeutung des Humors unterstreichen weitere Beispiele meiner Gesprächspartner. Es sieht so aus, als könnte Humor in einigen Fällen die Normverletzung wiedergutmachen. Einer ist Lehrer und bekommt demnächst seine Hörgeräte angepaßt. Er erzählte von dem herzlichen und etwas rauhen Ton, der im Kollegium herrscht. Er ist überzeugt, daß er, sobald er mit den Hörgeräten auftaucht, gehänselt werden wird. Ich fragte ihn: "Wäre es schlimmer, wenn sie [die Hörgeräte] totgeschwiegen würden?" Zuerst sah er etwas verblüfft aus: "Nein, ich bin nicht der Typ, der sagt: 'Habt Ihr mich alle gesehen?' und der nach Aufmerksamkeit sucht!" Aber schließlich fügte er hinzu: "Ich weiß, worauf du hinauswillst. Wenn einer mit einem gebrochenen Bein aus dem Skiurlaub zurückkehrt, dann wird er gehänselt. Aber wenn einer kommt und sagt: 'Ich war 14 Tage nicht da, weil ich einen Nervenzusammenbruch hatte, und ich nehme jetzt Psychopharmaka.' -- das wird totgeschwiegen". Eine andere Informantin, eine Krankenschwester, hat sehr lange gebraucht, um sich mit ihrer Schwerhörigkeit abzufinden. An dem Tag, an dem sie ihre Hörgeräte bekommt, ist sie zufällig mit ihren Kolleginnen abends zum Essen verabredet. Sie erzählt scherzhaft: "Ich habe ihnen gesagt, sie müssen an dem Abend aufpassen, was sie sagen, weil ich alles mitkriegen werde!" |
||||
Vom Wunsch nach Teilhabe zum Hörgerätanwender | ||||
Hörgeräte symbolisieren nicht nur das Hören, sondern auch und gerade das Nicht-Hören und drücken ein Defizit aus. Es gibt zwar Menschen, für die Hörgeräte keine besondere Rolle spielen. Aber in der Regel sieht es anders aus. Hörgeräte wirken durch die Kultur und die Technologie, und sie sind der materielle Ausdruck der menschlichen Konstruktion physischer und sozialer Unterschiede. Sie werden von vielen verschiedenen Gruppen angenommen, verwendet, angepaßt, toleriert oder abgelehnt. Die Vielfältigkeit, mit der sie gesehen werden, die konstante Wandelbarkeit ihrer Bedeutung, ist Ausdruck ihrer Wichtigkeit (Stratton 1999). |
||||
Das Zögern vieler Betroffener zeigt, wie schwer es ist, sich für das Tragen eines Hörgerätes zu entscheiden. In Dänemark machen z.B. nur ca. 50% der Menschen, denen mit einem Hörgerät rein formal geholfen werden könnte, diesen Schritt. Zugleich ist es erstaunlich, wie wenig anthropologische Forschung es in diesem Bereich gibt, und wie gering der Erfahrungsaustausch von Hörgerätanwendern untereinander zu sein scheint. Anders als bei Gehörlosen, die sich stark untereinander vernetzen, eigenständige Kulturen bilden und eine Vielzahl an Selbsthilfeorganisationen gegründet haben, gibt es unter Schwerhörigen wenig Identifikation mit anderen in der gleichen Situation. Es fällt schwer, sich mit einer Gruppe zu identifizieren, zu der man nie gehören wollte und deren Mitglieder zugleich als weniger attraktiv oder weniger intelligent angesehen werden. |
||||
Wie schon erwähnt, sind die individuellen Unterschiede meiner Gesprächspartner allerdings auch besonders deutlich. Einige gehen sehr offensiv mit ihrer Behinderung um: sie wollen Teil der Gemeinschaft bleiben, und sie haben keine Hemmungen, wenn es darum geht, in einem Gespräch die anderen festzunageln. Auch werden sie sich der Hörschwäche früh bewußt und schaffen sich baldigst ein Hörgerät an. |
||||
Andere zögern, ihre Hörschwäche überhaupt mitzuteilen, vielleicht weil sie befürchten, dadurch herabgewertet zu werden -- nicht nur in ihren eigenen Augen, sondern auch in denen ihres Gegenübers. Bei wiederum anderen liegt die Ursache nicht in Minderwertigkeitsgefühlen, sondern eher in einem fehlenden Bedürfnis nach Teilnahme in einer Gruppe. Nicht umsonst ist ein ganz wichtiger Faktor für das jeweilige Verhalten die empfundene Relevanz des Hörens. Hinsichtlicht der Geschlechtspezifik läßt sich diesbezüglich grob verallgemeinern: Männer besorgen sich Hörgeräte, um sich weiterhin in öffentlichen Zusammenhängen behaupten zu können -- Frauen, um Teil ihrer sozialen Netzwerke zu bleiben. |
||||
Mit der heutigen Technologie können Hörgeschädigte in den meisten Fällen ihre Lebensqualität deutlich verbessern. Ausdauer, Experimentierfreude, Neugier, Mobilität und Gesundheit sind manchmal erforderlich, um ein zufriedener Hörgerätanwender zu werden. Eine Anpassung seitens der Technologie und seitens des Anwenders ist notwendig. Das Hörgerät muß je nach Hörschaden, Motorik und Preis gewählt werden, und der Träger muß mit der nicht ganz naturgetreuen Wiedergabe der Laute durch die Hörgeräte leben. Die Verarbeitung der neuen Sinneseindrücke bedeutet nicht nur kognitiv eine Herausforderung, sondern auch emotional, denn die vertrauten Stimmen der eigenen Liebsten mögen schwer wiederzuerkennen sein. Die Tragweite dieses Zusammenhangs läßt sich in einem Satz ausdrücken, den Voltaire geprägt hat: "Das Ohr ist die Straße zum Herzen." |
||||
Die Anwender müssen mit anderen Worten lernen, wieder zu hören, sie müssen lernen, anders zu hören, und sie müssen damit leben, daß Hörgeräte nicht unter allen Umständen hilfreich sind, z.B. nicht immer, wenn viele Menschen in einem Raum versammelt sind und gleichzeitig sprechen. Nicht nur müssen sie selber diese Erfahrung machen, sie müssen auch ihrer Familie und ihren Freunden klarmachen, warum sie ihre Hörgeräte beim großen Familienfest nicht tragen. Manchmal müssen die neuen Anwender auch zu vielen Justierungsterminen und Nachkontrollen, um die richtige Lautstärke und Otoplastik zu finden. |
||||
Es gibt viele Variationen, wie die Anwender mit den Hörgeräten leben und wieviel Zeit, Mühe und Geld sie investieren, um ihre Hörgeräte zum Funktionieren zu bringen. Vielleicht landen sie in der legendären Schublade, oder vielleicht wird ihr Gebrauch wie bei meiner 92jährigen Lieblingsgesprächspartnerin zum Symbol eines aktiv betriebenen Lebens. Sie abends abzulegen, bedeutet das Tagewerk zu beenden und die damit verbundene Stille zu genießen, und sie morgens einzusetzen, das Gefühl in Bewegung zu sein: "Meine Hörgeräte bestätigen meine Existenz." Nachdem sie ihre Hörgeräte bekommen hatte, wagte sie es, im Altersheim das Wort zu ergreifen, weil sie endlich wußte, worum es ging. |
||||
Die Erfahrung, Hörgerätträger zu werden, ist eine Grenzüberschreitung. Erst wenn man diese Entwicklung selbst durchlaufen hat, weiß man wirklich, was sie bedeutet. |
||||
|
autoreninfo

Susanne Bisgaard lebt in Kopenhagen und arbeitet als Redakteurin von MTF nyt, der Zeitschrift des Menière und Tinnitus Vereins in Dänemark. Sie ist Doktorandin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Frankfurt am Main und promoviert über die Anwendung von Hörgeräten.
E-Mail: Bisgaard@tdc-broadband.dk |
||||
|
|