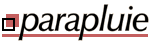
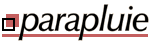 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 21: warschauer pakt
|
Rumänische IntellektuelleMit Gedichten und Karikaturen gegen die Staatsmacht |
||
von Alina Müller |
|
Der Kampf gegen die Geschichtsmythen der eigenen Kultur gleicht im rumänischen Fall dem Höhlengleichnis Platons: Um die Geschichtsmythen als trügerische Schatten auf der Höhlenwand ihres Werdens erkennen zu können, braucht die rumänische Gesellschaft die Arbeit einer aufgeklärten intellektuellen Elite, damit sie das Wissen um ihre objektive Geschichte erlangen kann. Im Verlauf der langsamen Demokratisierung und Privatisierung Rumäniens seit dem Zusammenbruch des Kommunismus erlebt auch die rumänische Kultur einen schmerzhaften Prozeß der Reform ihrer Wahrnehmung. Noch braucht Rumänien eine weitgehendere Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen, der faschistischen und der kommunistischen. |
||||
Rumänien hat öfters einen "Sonderweg" in der Geschichte beschritten. Selbst innerhalb des Warschauer Paktes unterlag Rumänien, anders als die übrigen Staaten Osteuropas, einem geschichtlichen Paradox. Ceausescu war der einzige Staatspräsident eines Mitgliedslandes des Warschauer Paktes, der sich 1968 öffentlich gegen den Einmarsch der Roten Armee in Prag äußerte und ihr die militärische Unterstützung seines Landes verweigerte. Der Westen sah deshalb in dem neuen rumänischen Präsidenten kurzzeitig einen hoffnungsvollen Träger demokratischer Ideen. Dabei hat man übersehen, daß Ceausescus Kritik gegenüber den Sowjets sich nicht gegen deren Ideologie, sondern lediglich gegen das Einmischen in die Angelegenheiten eines 'Bruderstaates' richtete. Seine Innenpolitik entsprach ebensowenig den Verheißungen seiner nach Westen hin vertretenen Liberalisierungspolitik. Im Inneren des Landes wuchs im Laufe der Jahre das Ausmaß des Terrors leise an: Die Geheimpolizei Securitate war allgegenwärtig, selbst Durchschnittsbürger bespitzelten einander. Zudem war die Bevölkerung mit Alltagssorgen konfrontiert, die der rumänische Schriftsteller Patapievici als "falsche Probleme" bezeichnet: Vor dem Sturz Ceausescus "bestanden unsere Probleme darin, wie wir uns am besten vor den anderen verbergen, wie wir eine möglichst wirksame Doppelsprache entwickeln, wie wir schwänzen können, ohne daß man es sah, wie wir uns durch Betrug eine größere Ration Zucker, Öl oder Wurst ergattern als die, auf die wir gemäß des Plan zur sogenannten 'rationalen Ernährung' offiziell ein Anrecht hatten". Rumänien entwickelte sich seit Ende der 70er Jahre immer mehr zu einer totalitären, sprich entpolitisierten Gesellschaft. Widerstandsbewegungen gegen das kommunistische Regime gab es zeitversetzt in Ungarn, in der Tschechoslowakei und in Polen. In den restlichen Satellitenstaaten machte sich eine Auflockerung der Regime spätestens infolge der Perestrojka-Politik bemerkbar. Eine unerbittliche Zensur behinderte dagegen in Rumänien in allen Kunst- und Kommunikationsformen den freien Meinungsaustausch. Selbst die Lektüre politischer Denker wie Platon, Spinoza oder Hegel konnte als politischer Widerstand mißdeutet werden. |
||||
In einem solchen autoritären und rigiden Umfeld konnte sich Kultur nicht anders als politisiert darstellen, so der Philosophieprofessor Gabriel Liiceanu, Herausgeber des 1983 erschienenen "Tagebuchs von Pãltinis". Dieses Buch beinhaltet Gespräche seines Mentors Constantin Noica mit "ausgewählten Studenten" über (politische) Philosophen. Pãltinis, ein Kurort in den Karpaten, war damals der Treffpunkt der Gruppe. Während Noica in der Zwischenkriegszeit keine unbekannte Größe in Rumänien war, sollte er später aufgrund der scharfen kommunistischen Zensur zumindest für eine gewisse Zeit in Vergessenheit geraten. Seine Freundschaft mit Mircea Eliade und Emil Cioran in der Zwischenkriegszeit mißfiel den Kommunisten nach ihrer Machtübernahme 1945 so sehr, daß sie ihn mit größerer Intensität überwachten. |
||||
Die jungen Journalisten Cioran und Eliade gehörten in den dreißiger Jahren zum antisemitischen elitären Kreis Junimea unter der Leitung des Philosophieprofessors Nae Ionescu. Das bei der Junimea institutionalisierte Modell der Gesprächsrunde über philosophische Texte entsprach dem platonischen Diskussionskonzept: Der Philosoph ist nach Platon nicht im Besitz der Weisheit, er ist sich vielmehr seines Mangels an Weisheit bewußt und erlangt diese erst im offenen, fragenden Streitgespräch und Dialog. Obwohl die Mitglieder der Junimea mit der Ideologie der Eisernen Garde, einer antisemitischen gewaltverherrlichenden Bewegung der dreißiger Jahre, kokettierten, gehörte ihr auch der rumänische Schriftsteller jüdischer Abstammung Mihail Sebastian an. Während Cioran und Eliade ins französische Exil gingen, wo sie zu unbestrittenen Größen der französischen Literatur aufstiegen, blieben Noica und Sebastian in Rumänien und sollten auf unterschiedliche Weise das Rumänien von heute beeinflussen. |
||||
Der gescheiterte Versuch, seine Interpretation eines Textes von Hegel nach Frankreich zu verschicken, brachte Noica in den Fünfzigern sechs Jahre Gefängnisaufenthalt ein. Dabei fiel das Urteil ursprünglich nicht gerade milde aus: eigentlich sollte er 20 Jahre lang eingesperrt werden. Wieder in Freiheit, schuf sich der Philosoph eine neue Identität. Er betrachtete sich als "kulturellen Trainer" junger rumänischer Studenten und beabsichtigte deren Urteilsvermögen von kommunistischen Dogmen zu befreien. Seine Philosophie, die sich im "Tagebuch von Pãltinis" wiederfinden läßt, wurde unter dem Namen 'Schule von Pãltinis' bekannt. Das Buch schaffte es, die Zensur zu umgehen und in die Hände möglichst vieler wissenshungriger Leser zu gelangen. Noicas Ziel war es, den jungen Leuten die Fähigkeit zur Kritik und zu selbständigem Urteilsvermögen beizubringen. Seine kritische Schule erreichte jedoch nicht eine ganze Generation, sondern lediglich eine kleine Elite, der nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eine besondere Aufgabe zukam. In einem Land, in dem beinahe jeder vierte Bürger Mitglied der Rumänischen Kommunistischen Partei (PCR) war, sollten gerade diese Dissidenten und Intellektuelle Hoffnungsträger eines demokratischen Neubeginns werden. |
||||
Für den Historiker Holm Sundhausen ist das wesentliche Kriterium für die Identifizierung von Eliten "der Besitz und die Verfügung über gesellschaftliche Ressourcen". Diese Definition trifft auf alle Eliten Südosteuropas zu. Die Elite zu enteignen war fester Bestandteil der kommunistischen Ideologie. In Rumänien aber wurde diese Elite nicht enteignet, sondern schlicht und einfach vernichtet. Ihre Vernichtung begann mit der ersten Stalinisierungswelle Ende der vierziger Jahre: deutschstämmige Bürger wurden in die UdSSR deportiert, sämtliche Führungspersönlichkeiten der politischen Parteien wurden inhaftiert. Die meisten davon starben im Gefängnis von Sighet, in dem vorwiegend politische Gefangene saßen. Als nächstes kamen Intellektuelle und Bauern, die sich gegen die Kollektivisierung stellten, ins Gefängnis. Es ist nicht die Anzahl der Opfer der Securitate, welche bis heute nicht zutreffend geschätzt werden kann, die die Härte des rumänischen Kommunismus so berüchtigt machte, sondern die Strenge der Methoden der Securitate, sowie die breitgefächerte Zerstörung von Schichten, die sich als gefährlich hätten erweisen können. Bestes Beispiel dafür ist das 'Experiment von Pitesti' (1949-1952). In der Nähe von Pitesti befand sich ein Gefängnis, in dem politische Gefangene sich gegenseitig foltern und sich zu 'neuen Menschen umerziehen' mußten. Unter Ceausescu behielt die Securitate ihren Einflußbereich und verschärfte nach Jahren scheinbarer Entspannung ab den Siebzigern erneut ihre Methoden. Jegliche Art von politischem Widerstand wurde bekämpft. Gesellschaftliche Gruppen, die Widerstand hätten leisten können, wurden konsequent 'gesäubert'. |
||||
Bildung hätte sich in einem solchen entpolitisierten Alltag als gesellschaftliche Ressource erweisen können. Das kommunistische Rumänien konnte keine politische Widerstandsbewegung hervorbringen. Noicas Jünger gehörten zu den wenigen, die zu einer solchen Rebellion imstande gewesen wären. Doch waren diese eher auf die kritische Auseinandersetzung mit politischen Schriften bedacht als auf die aktive Teilnahme am politischen Geschehen. Unter dem wachsamen Auge der Securitate, die jeglichen Gedanken an Widerstand im Keim erstickte, hätten solche Aktionen ihnen im glücklichsten Fall Freiheitsstrafen eingebracht. Politischer Widerstand konnte also nur kultureller Art sein. Der Schriftsteller Paul Goma hat aufgrund dieser Erkenntnis in den Siebzigern versucht, nach dem Vorbild der tschechischen Charta '77 eine Dissidentenbewegung ins Leben zu rufen. Resultat seines Vorhabens war das erzwungene Exil Gomas und die Verhaftung seiner Sympathisanten. |
||||
Regimekritische Gedichte zu verfassen wurde als Widerstand gegen das kommunistische System gedeutet. Die Dichterin Ana Blandiana, die sich für diese Form von Widerstand entschied, mußte mit den bitteren Konsequenzen leben. Ihre Gedichte fielen der Zensur zum Opfer. In den achtziger Jahren mußte Blandiana ihre Teilnahme an literarischen Symposien im Westen absagen, da ihr das Regime den Stempel im Reisepaß verweigerte. Als Reaktion auf ihre Abwesenheit verlasen die Organisatoren eines Londoner Lyriksymposiums 1983 anstelle ihrer Gedichte einen Protestbrief an die rumänische Regierung. Ana Blandiana lebte nach diesem Vorfall unter ständiger Beobachtung durch Securitate-Offiziere. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr auch dem Dichter und Journalisten Mircea Dinescu. Dieser wurde nicht nur unter Hausarrest gestellt, sondern erhielt sogar Berufsverbot. |
||||
Der Abschied von der kommunistischen Gesellschaft verlief in Rumänien gewalttätig. Um die tausend Menschen starben im Dezember 1989 auf den Straßen der Großstädte im Kampf um die Freiheit. Darunter waren meist Jugendliche, Soldaten und Securitate-Offiziere. Der Durchschnittsbürger konsumierte dagegen im Nationalfernsehen die inszenierte "Tele-Revolution". Sympathieträger wie die Dissidenten Mircea Dinescu und Ana Blandiana ließen sich zu hoffnungsvollen Reden im Fernsehen mitreißen und unwissentlich von politischen Vertretern manipulieren. Scheinbar spontan gründete der künftige Präsident Ion Iliescu die Partei der Front der Nationalen Rettung (FSN) im Scheinwerferlicht und kündigte den Eintritt der beiden Dissidenten in die neu gegründete Partei an, ohne diese aber vorher zu fragen. Vor der Kamera erklärte der künftige Präsident auch die Kommunistische Partei (PCR) für aufgelöst. Die Dissidenten, die der FSN gewollt oder ungewollt beigetreten waren, gaben dem Altkommunisten Iliescu und seinem Beziehungsnetzwerk aus der PCR anfänglich einen politisch sauberen Anstrich. Jahre später sollte die Dichterin Ana Blandiana der demokratischen Oppositionspartei Alianta Civicã beitreten, um demonstrativ die Nachfolger der Kommunisten bloßzustellen. Auch Dinescu gehörte der Partei nur bis 1990 an. Im Sommer 1990 protestierten Intellektuelle, Studenten und liberale Bürger auf dem Bukarester Universitätsplatz monatelang gegen die Kontinuität der Politik der neuen Machteliten aus der FSN mit dem kommunistischen Regime. Dem Aufruf Iliescus folgend, strömten Bergarbeiter auf die Straßen Bukarests, um die Nation von den demonstrierenden Studenten zu befreien, die Iliescu als "hooligans" bezeichnete. "Solidarisch" mit ihrem Präsidenten haben die Bergarbeiter zwischen 1990 und 1991 mehrmals die demokratischen Kräfte vom Universitätsplatz mit Gewalt verdrängt und die 'Ordnung' im Land wiederhergestellt. |
||||
In den ersten sieben Transformationsjahren fanden weder eine tiefgreifende Demokratisierung noch eine sorgfältige Reform des rumänischen Staates statt. Rumänien suchte 1990 als einziges osteuropäisches Land noch den Kontakt zur Sowjetunion und erkannte den Warschauer Pakt weiterhin an. Die Intellektuellen gingen resigniert in die Opposition und bildeten eine "Gegenelite" zu den Nachfolgern kommunistischer Eliten, die sich in der FSN versammelten. Die Ereignisse jener Zeit deuten darauf hin, daß die postkommuninistische rumänische Gesellschaft sich in zwei Lager spaltete -- Sympatisanten der Postkommunisten einerseits und Modernisierer andererseits. Erst 1996 wurden die um Modernisierung bemühten Kräfte in die Regierung gewählt. Das ehemalige Oppositionsbündnis bemühte sich zum ersten Mal nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Rumänien, einen echten demokratischen Wandel einzuleiten. In dieser Regierung befand sich eine auffällig hohe Anzahl von Akademikern. Alle Mitglieder der Regierung von 1996 hatten einen Hochschulabschluß, neun davon besaßen Doktortitel. Auch der Staatspräsident Emil Constantinescu war bis zu seiner Wahl Universitätsprofessor und Rektor. Doch die Regierung der demokratischen Eliten erwies sich als schwach, ihr Präsident als zögerlich. Die versprochenen Reformen wurden nicht angepackt, die soziale Misere der rumänischen Bevölkerung vertiefte sich. Vielleicht unterlag Constantinescu dem Anspruch der Gleichzeitigkeit seiner Rollen als Intellektueller und Politiker, die nach Meinung des rumänischen Philosophen und Kunsthistorikers Andrei Plesu unvereinbar sind. Als rumänisches Pendant zu Vaclav Havel und György Konrad übernahm Plesu das Außenministerium. Zu Zeiten Ceausescus gehörte er zusammen mit Gabriel Liiceanu, zum engen elitären Kreis der Studenten Noicas. Im Frühjahr 1989 ging er ins Exil, kehrte nach der Revolution zurück und leitete 1990 für kurze Zeit das Kulturressort. Auch er verzichtete 1990 aus Protest gegen die Machenschaften Iliescus und der FSN auf sein Ministeramt: Iliescu machte bereits am 22. Dezember 1989 deutlich, daß er kein verwestlichtes Demokratiemodell in Rumänien einführen wollte, sondern eine "originelle, eigene Demokratie". Wie sich in den nachfolgenden Jahren herausstellte, meinte er damit ein autoritäres halbdemokratisches Führungssystem, das nicht ganz mit dem kommunistischen System brach. 1996 kehrte Plesu als unterstützende Kraft der Regierung zu den Eliten zurück, die um eine echte Modernisierung des Landes bemüht waren. Entgegen Platons Vorstellungen erwies sich das Herrschaftsmodell eines Philosophenkönigs in der Realität eines Staates in der Übergangsphase zur Demokratie als nicht erreichbar. Nach der politischen Erfahrung Plesus erschien es sogar als ein törichtes Ideal. Der neue Staatspräsident Constantinescu machte bereits kurz nach seinem Amtsantritt seine Ohnmacht deutlich: "Wir haben die Wahl aber nicht die Macht gewonnen". In Rumänien ließen zusätzlich die Machkämpfe zwischen dem Staatspräsidenten und seinem promovierten Premierminister Radu Vasile auf der einen Seite und einer schwachen Regierung auf der anderen Seite eine enttäuschte Wählerschaft zurück, die sich erneut im Jahre 2000 Iliescus Partei zuwandte. In der neuen Legislaturperiode zeigte sich der bekannte Altkommunist Iliescu demokratisch, seine Partei nannte sich sozialdemokratisch (PSD). Die Staatsunternehmen wurden privatisiert, die Zahl der ausländischen Investoren nahm stetig zu. Die rumänische Wirtschaft verzeichnete in den letzten Jahren stabile Wachstumswerte. 2004 erwarb Rumänien die NATO-Mitgliedschaft und unterzeichnete zudem den Vertrag zum Beitritt zur Europäischen Union. Doch trotz aller scheinbaren Stabilität erschütterten die Präsidentschaftswahlen im Jahre 2004 erneut das Land. Der Präsidentschaftskandidat der "Neokommunisten" um Iliescu verlor überraschend das politische Amt zugunsten des Oppositionskandidaten Traian Bãsescu von Alianta DA (Allianz Gerechtigkeit und Wahrheit). Die 'Neokommunisten' (PSD) stellen jedoch im Parlament immer noch die stärkste Fraktion dar. Die Mehrheitskoalition wurde dank der Unterstützung ehemaliger Koalitionsparteien der PSD gebildet. Die Fraktionen der PSD und der rechtsextremen PRM bilden eine starke Opposition. |
||||
Die konservativen Kräfte in Gestalt der Postkommunisten genießen weiterhin einen bedeutenden Einfluß. Während sich die Kommunistische Partei quasi in Luft auflöste, übernahmen die Träger ihrer Ideologie demokratische Ämter. Die 'Gegenelite' der aufgeklärten Intellektuellen wirkte diesen konservativen Kräften entgegen, zeigte sich aber in den Anfangsjahren noch recht zögerlich und desorganisiert. Dieses Phänomen führte zu einer verhinderten Vergangenheitsbewältigung der rumänischen Gesellschaft. Der Geschichtsprofessor Lucian Boia machte in seinem Buch Geschichte und Mythos auf die Manipulation der Geschichte durch die Machthaber der postkommunistischen Gesellschaft aufmerksam. Geschichtsmythen, so Boia, wurden in der postkommunistischen Gesellschaft von den alten Eliten instrumentalisiert. Der seit langer Zeit währende Komplex der Rumänen, sich als Opfer der Geschichte zu sehen, fand wiederholte Verwendung. In einem Land, in dem es praktisch kaum einen politischen Widerstand gab, hat man nachträglich zahlreiche heldenhafte Gestalten des politischen Widerstands unter den Kommunisten erfunden. Auch die Zwischenkriegszeit als eine Zeit echter rumänischer Demokratie wurde verstärkt idealisiert. |
||||
Nach so vielen sozialen Umwälzungen braucht ein Land feste Größen, um an sich selbst zu glauben. So wurden die bekanntesten Schriftsteller rumänischer Abstammung Cioran, Eliade und Ionescu nach 1989 als Ikonen rumänischer Literatur neu entdeckt. Ein literarisches Ereignis des Jahres 1996 brachte die rumänische Öffentlichkeit dazu, nicht nur ihre Geschichte, sondern auch ihre Literatur aus jener Zeit zu hinterfragen: Die Tagebücher des Schriftstellers und Literaturkritikers der vierziger Jahre, Mihail Sebastian, wurden veröffentlicht. Diese Tagebücher sind dieses Jahr auch in Deutschland unter dem Titel: Voller Entsetzen, aber nicht verzweifelt erschienen und bieten Auszüge aus dem Leben eines jüdischen Intellektuellen, der zur Elite des Landes gehörte -- zu einer Zeit, in der Osteuropa Hitlers Ideologie verfallen war. In seinem Buch schildert Sebastian die gefühlte Isolation und verbale Demütigung, mit denen er im faschistisch angehauchten Literatenkreis Junimea konfrontiert wurde. Das Buch wird als wertvolles "Zeitdokument" angesehen und wurde als geschichtliche "Sensation" gedeutet. "Dieses Buch führte zu einer Katharsis in einer Gesellschaft, die die eigene Vergangenheit und den Beitrag zum Holocaust nur ungern untersucht, einer Gesellschaft, in der den Nationalismus zu kritisieren eine unpatriotische Handlung, wenn nicht geradezu etwas Blasphemisches ist", so der New Yorker Schriftsteller (rumänisch-jüdischer Abstammung) Norman Manea. |
||||
Im Sinne dieser Aufarbeitung der eigenen Kultur folgte 1998 eine weitere Diskussion in der Wochenzeitung 22 (22. Dezember 1989: der Tag, an dem die Revolution in Bukarest ihren Höhepunkt erreichte) über die nationalistische Ideologie des größten rumänischen Dichters Mihai Eminescu. Die Lyrik Eminescus war nicht Gegenstand des politischen Streitgesprächs, wohl aber seine publizistischen Schriften, die vom antisemitischen Geist seiner Zeit infiziert waren. Eminescu wird in der rumänischen Öffentlichkeit als autochtones Pendant zu Goethe angesehen. Der Versuch, Eminescus Persönlichkeit zu hinterfragen, würde die Befürchtung aufkommen lassen, man wolle das Selbstverständnis der rumänischen Nation in Frage stellen. |
||||
Das 2004 in den USA erschienene Buch Die Bojaren des Intellekts sorgte seinerseits für den jüngsten Skandal in der rumänischen Öffentlichkeit in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung. Darin analysiert der emigrierte rumänische Soziologe Adam Sorin Matei die rumänischen Intellektuellen von heute und stellt die Verbindung zum Rumänien vor dem Kommunismus her. Während die Mehrheit der Bevölkerung im 19. Jahrhundert einfache Bauern bildeten, stellte die reiche aber dünne Schicht wohlhabender Bauern, der sogenannten Bojaren, die Elite des Landes. Parallel dazu bezeichnet der Autor die Elite Rumäniens als Bojaren des Intellekts und verleiht ihr damit einen Beigeschmack des Rustikalen. Der Soziologe weist zudem auf eine Eigenart der rumänischen Kultur hin: Die Rumänen teilten sich in "Untermenschen und Helden" ("subumani si eroi"). Sie haben den Hang, die Bedeutung ihrer öffentlichen Personen überzubewerten -- bei gleichzeitiger Geringschätzung des durchschnittlichen Bürgers. Der kleine Bürger könne eh' nichts bewirken, so das Selbstverständnis der Rumänen nach Matei. Das Buch löste einen öffentlichen Streit zwischen den ausgewanderten Intellektuellen und den Eliten des Heimatlandes aus, die empört über diese Entmythifizierung waren. Auf Provokationen aus dem Heimatland reagierte die intellektuelle Diaspora im Ausland ebenso streitsüchtig. Diese Debatte verweist auf ein weiteres soziales Phänomen des postkommunistischen Rumäniens: die Auswanderung der Intellektuellen ins materiell sichere Ausland. Früher wurden hauptsächlich die Andersdenkenden ins Exil gezwungen, heute wandern für kurze Zeit ganze Dörfer ins Ausland, um der sozialen Misere zu entfliehen. |
||||
Doch hinter den selbstkritischen Debatten der letzten Jahre verbirgt sich auch die Konfrontation mit den Minderwertigkeitskomplexen einer Nation. Emil Cioran behauptete einmal: "Der Stolz eines Bürgers, der aus einer kleinen Nation stammt, ist immer verletzt".[Anm. 1] Sätze wie: "Heute schämt man sich ein bißchen [...] Wir Rumänen hatten keinen Aleksandr Solschenizyn und keinen Vaclav Havel!" stoßen immer noch auf verletzte Gegenreaktionen in Rumänien. Die Existenz von Minderwertigkeitskomplexen läßt sich auch am Fortbestehen nationalistischer Ideen ablesen. Rumänien ist ein Vielvölkerstaat mit einer belasteten Minderheitenpolitik. Nationalismus und Rechtsextremismus sind schwerwiegende Begleiterscheinungen der postkommunistischen Gesellschaft. Doch auch die Rechtsextremen haben ihre Intellektuellen, wenn wir von der schlichten Definition der Intellektuellen als Personen mit einem akademischen Titel ausgehen. Adrian Pãunescu (PSD) ist ein ehemaliger Hofdichter Ceausescus. Zusammen mit Corneliu Vadim Tudor, dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Großrumäniens (PRM), versorgte er die Nostalgiker der kommunistischen Ära mit verbitterten und aggressiven Schlagwörtern, die eine Verdrängungspropaganda in der rumänischen Öffentlichkeit förderte und der Partei viele Wählerstimmen einbrachte. C.V. Tudor schaffte es im Jahr 2000 sogar in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl -- ein Tiefpunkt der jungen rumänischen Demokratie. |
||||
In seinem Werk Die Erben der Securitate beschreibt der Soziologe Marius Oprea ein weiteres einzigartiges rumänisches Phänomen der Transformation: Nicht nur die staatlichen Unternehmen, sondern auch die Securitate privatisierte sich! Die ehemaligen Securitate-Offiziere wurden erfolgreiche Politiker und Unternehmer, da sie über nützliche Fertigkeiten, das Kapital und die Netzwerke ihrer alten Ämtern verfügten -- zu Zeiten, wo andere sich diese erst erwerben mußten. |
||||
In einer Transformationsgesellschaft, in der Aufklärung zum Grundstein der Erneuerungen wird, erlangt die Rolle der Intellektuellen eine wichtige politische Bedeutung. Die gesellschaftlichen Ressourcen dieser Eliten bestehen in ihrer Bildung. Adrian Plesu wandte sich selbst der Gegenüberstellung der politischen Theorie und der politischen Erfahrung zu. Er betonte die Unvereinbarkeit der Natur des Intellektuellen und jener des Politikers und deutete auf die verschiedenen Möglichkeiten der Funktionen von Intellektuellen von heute hin: zurückhaltende Kontemplation, Partizipation und kritische Betrachtung der Öffentlichkeit und der Regierung. Diesen drei Funktionen entsprechen in der rumänischen Gesellschaft drei Gruppen von Intellektuellen. Es gibt eine apolitische Gruppe, die allein ihrer intellektuellen Arbeit nachgeht, ohne diese zu politisieren. Andere Intellektuelle können aber gleichzeitig politisch aktiv sein, wie beispielsweise Andrei Plesu, der bis Mai 2005 erneut als Berater im Präsidentenamt ein politisches Amt bekleidete. Zur dritten Gruppe gehören Intellektuelle wie der Schriftsteller Horia Patapievici, die im Sinne Bourdieus Kritik ausüben. Diese sind in Zeitschriftenredaktionen wie 22 oder Dilema anzutreffen, in denen sich die Schüler Noicas nach der Revolution versammelten. Patapievici ist gleichzeitig auch Mitglied des Kollegs zur Untersuchung der Archive der Securitate. Sein politischer Widerstand im kommunistischen Regime bestand in der konsequenten politischen Zurückhaltung sowie Nichtausübung seines literarischen Talents. Patapievici profilierte sich erst in den Transformationsjahren als öffentliche Persönlichkeit. Auch die Karikaturzeitung Academia Catavencu, deren Gründer der Dichter und Dissident Mircea Dinescu ist und die in Rumänien Kultstatus genießt, wurde von der 2004 abgewählten Regierung Iliescus wegen ihrer schonungslosen Berichterstattung im Wahlkampf gefürchtet. In manchen Orten wurde die Ausgabe der Zeitung, die sich mit den Lebensläufen gegenwärtiger politischer Figuren während der Diktatur Ceausescus befaßte, in hohem Maße von Unbekannten aufgekauft. Damit sollte verhindert werden, daß sie einen breiten Teil der Bevölkerung erreicht. Diese dritte Gruppe von Intellektuellen genoß auch die Unterstützung zahlreicher Geldgeberorganisationen, die den Wiederaufbau förderten. Sie übten politischen Einfluß über NGOs aus, die ein besonderes Augenmerk auf die Regierungsarbeit legen. Bestes Beispiel dafür ist die Gesellschaft Rumänischer Akademiker (Societatea Academicã Românã), deren Hauptmotivation das Durchleuchten sozialer und politischer Entwicklungen im postkommunistischen Rumänien ist. Die heutige Justizministerin Maria Macoviei stammt aus diesem Umfeld und ist die erste Amtsträgerin, die ernsthafte Absichten zur Korruptionsbekämpfung an den Tag legt. |
||||
Im Verlauf der langsamen Demokratisierung und Privatisierung Rumäniens seit dem Zusammenbruch des Kommunismus erlebt auch die rumänische Kultur einen schmerzhaften Prozeß der Reform ihrer Wahrnehmung. Noch braucht Rumänien eine weitgehendere Auseinandersetzung mit den beiden Diktaturen, der faschistischen und der kommunistischen. Ebenso muß die Reform der Geschichtsschreibung vorangetrieben werden, um die Mittel der Geschichtsmanipulation als Wahlkampfsinstrument außer Kraft zu setzen. Dort, wo Aufklärung herrscht, können Geschichte und Mythen auseinandergehalten werden. Nur wer die Konfrontation mit der eigenen Geschichte nicht scheut, kann sich der eigenen Zukunft tatsächlich stellen. Der Kampf gegen die Geschichtsmythen der eigenen Kultur gleicht im rumänischen Fall dem Höhlengleichnis Platons: Um die Geschichtsmythen als trügerische Schatten auf der Höhlenwand ihres Werdens erkennen zu können, braucht die rumänische Gesellschaft die Arbeit einer aufgeklärten intellektuellen Elite, damit sie das Wissen um ihre objektive Geschichte erlangen kann. |
||||
|
autoreninfo

Alina Müller geboren 1978 in Deva, Rumänien, machte ihr Abitur 1998 in Bergneustadt, Deutschland. Nach einem Arbeitsaufenthalt in London schrieb sich Alina 1999 für Politische Wissenschaften, Anglistik und Soziologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn ein. Das Studienjahr 2002/3 verbrachte sie am Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg. Das Thema ihrer Magisterarbeit ist "Rumänien und die EU".
E-Mail: mueller_alina@gmx.de |
||||
|
|