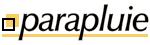
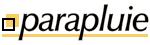 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 26: visuelle kultur
|
Fernsehen -- eine Frage des Geschmacks? |
||
von Frank Illing |
|
Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel, Dschungel-Camp: welche Art von Vergnügen empfinden die Zuschauer, wenn sie selbst diese und weitere 'neue Fernsehformate' als "geschmacklos" bewerten? Offenbar lassen sich an ihnen ironische Rezeptionsweisen erproben, die sich nicht an den Idealen des 'Guten, Schönen, Wahren' orientieren, sich aber auch nicht einfach auf einen Nenner bringen lassen. |
||||
Viel diskutiert wurde in den letzten Jahren über die 'neuen Fernsehformate' (Big Brother, Talk-Shows, Gerichtsshows, Casting-Shows wie Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel und Shows wie Dschungel-Camp/Ich bin ein Star -- Holt mich hier raus!); auch in Medienwissenschaft und Soziologie fanden sie schnell Beachtung, zu Big Brother erschienen schon bald nach Beginn der Sendung mehrere Sammelbände. Nicht nur fanden die Umwälzungen in der Welt des Fernsehens seit der Zulassung des Privatfernsehens Mitte der 1980er Jahre in jenen Sendungen besonders sinnfälligen Ausdruck; auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, etwa hinsichtlich des Verhältnisses von Öffentlichem und Privatem, ließen sich beispielhaft erörtern. Unabhängig von der akademischen Beschäftigung bescheinigten Kritiker jenen Sendungen, z.B. dem Dschungel-Camp, oft "Geschmacklosigkeit", auch von "Ekel-Fernsehen" war die Rede. Läßt sich daraus aber folgern, daß die Zuschauer diese Sendungen 'geschmackvoll' finden? Oder empfinden sie ein wie auch immer geartetes Vergnügen an der Geschmacklosigkeit? Und wenn ja, wie lassen sich solche, oft unter dem Etikett 'Trash' verhandelten ästhetischen Phänomene erfassen? Welche Rolle spielt überhaupt das individuelle ästhetische Urteil, ob in der Semantik des Geschmacks oder mit anderen ästhetischen Begriffen, bei der Formulierung ästhetischer Urteile über das Fernsehen? |
||||
An Fragen dieser Art schließt sich die Frage an, womit man solche Sendungen vergleichen soll. Orientiert man sich an der Geschichte des Fernsehens und seinen aus den Tagen des öffentlich-rechtlichen Monopols überkommenen pädagogischen Ansprüchen, bei der 'leichte Unterhaltung' zwar gestattet, aber nicht für das Selbstverständnis prägend war? Oder reiht man sie in die Geschichte funktionaler Äquivalente aus früheren Zeiten ein, wie den Jahrmarktsattraktionen, Schaubuden und den als öffentliche Spektakel inszenierten Hinrichtungen? Aus soziologischer Perspektive lassen sich derartige Fragen auch mit den aktuellen Diskussionen über Individualisierungstendenzen in der heutigen Gesellschaft und über die außerwirtschaftlichen Konsequenzen der neoliberalen Deregulierung verknüpfen. Im folgenden soll skizziert werden, in welche Richtung sich solche Fragen beantworten lassen; zu diesem Zweck kann es hilfreich sein, sich zunächst entlang einiger Aspekte der Geschichte des Fernsehens zu bewegen. |
||||
Das Fernsehen und seine Kritik von den 1950er bis 1970er Jahren | ||||
Das Fernsehen kann als Leitmedium des fordistischen Wohlfahrtstaates gelten, wie er sich in den kapitalistischen Industriegesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzte, mit einer bis dahin für unmöglich gehaltenen Verbindung aus Massenwohlstand bei gleichzeitig wachsender Freizeit, innerem und (trotz Kaltem Krieg auch weitgehend) äußerem Frieden. Der Anteil des Fernsehens daran war zwar auch materieller Art (als Massenkonsumartikel), wichtiger noch waren jedoch seine ideologischen Wirkungen. Daß Fernsehgeräte seit den späten 1950er und vor allem in den 1960er Jahren in den meisten Haushalten Einzug hielten, war für das 'Wirtschaftswunder' weniger bedeutend als das gesellschaftliche Verhältnis, das damit zugleich installiert wurde, denn mit dem Fernsehen hielt die in bewegten Bildern präsentierte Welt Einzug in die Wohnzimmer noch der abgelegensten Regionen. Über die Folgen ist viel spekuliert worden: manchmal wurde der Verlust direkter, öffentlicher wie privater, Kommunikation befürchtet; passiver, privater Konsum trete an die Stelle einer aktiven Beteiligung am öffentlichen Leben und der aktiven Gestaltung des privaten Lebens. Angesichts der einseitigen Kommunikation ohne Antwortmöglichkeit bei gleichzeitiger Ausnutzung der Suggestivwirkung von Bildern ohne Möglichkeit der direkten Reaktion (wie sie etwa bei öffentlichen Reden besteht) wurde die Manipulation der Zuschauer durch Werbung oder durch (sei es direkte, sei es unterschwellige) politische Propaganda befürchtet. Diese verbreitete Kritik an der Passivität des Fernsehkonsums und der durch das Fernsehen hergestellten einseitigen Kommunikationsrichtung scheint nicht mehr so überzeugend, angesichts eines interaktiven Mediums wie dem Internet, das zum neuen Leitmedium zu werden scheint, da dieses nun auch das Fernsehen ergänzt und den Zuschauern ermöglicht, beispielsweise in Foren miteinander in Kontakt zu treten oder auf einfachere Weise als zuvor sich direkt an die Sender zu wenden. Aber auch schon zuvor wurde ja u.a. im Rahmen der Cultural Studies die im Grunde aktive Rolle hervorgehoben, die die Fernsehzuschauer einnehmen, indem sie auf eine ihnen spezifische Weise aktiv 'Lesarten' des massenmedialen 'Textes' erzeugen und diesen nicht bloß passiv konsumieren. |
||||
Kulturkritiker verschiedener Couleur befürchteten oder konstatierten jedenfalls oft die "Verdummung" der Zuschauer. Andere Beobachter erkannten die Möglichkeit, daß durch das Fernsehen bestehende Sprachlosigkeiten erträglicher werden könnten; das elektronische Lagerfeuer ersetzte einfach das aus Holzscheiten. Und angesichts dessen ließ sich auch eine neue Art der Herstellung von Gemeinschaft in Familien beobachten: wenn es schon sonst nichts gab, worüber man sprechen konnte oder wollte, so konnte man sich zumindest vor dem Fernseher versammeln und mußte sich auf eines der meist nur drei Programme einigen. Das Fernsehprogramm führte zu einer neuen Strukturierung des Familienlebens durch den Senderhythmus: die allabendliche Tagesschau, die wöchentliche Sportschau sowie verschiedene beliebte Serien, die zumeist auch im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt wurden. Auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gab es eine vergleichbare Tendenz zu einer neuen Art des Gemeinschaftserlebnisses: Die 'Große Samstagabendunterhaltung' aus der Frühzeit des Fernsehens, wie sie bis heute noch in Wetten, dass überdauert hat, Fußball- und Olympiaübertragungen, die Mondlandung, die 'Straßenfeger', wie z.B. die legendären Durbridge-Verfilmungen in den späten 1960er Jahren, brachten jung und alt, Nord und Süd, West und Ost, Arm und Reich vor den Fernsehschirmen zusammen, wenn auch in meist familiären Kleingruppen vereinzelt. |
||||
Fernsehen als Medium der Gemeinschaftsbildung | ||||
In solchen Fernsehgemeinschaften läßt sich auch eine Neubildung der Volksgemeinschaft unter veränderten medialen Bedingungen und bei Fehlen einer gemeinsamen ideologischen Basis erkennen. Deshalb war auch das Studio- bzw. Stadion-Publikum wichtig, das es ermöglichte, nicht nur das Fernseh-Ereignis selbst, sondern auch die kollektive Begeisterung über das Ereignis zu konsumieren. |
||||
Niklas Luhmann trug solchen Entwicklungen Rechnung, indem er die 'Realität der Massenmedien' in erster Linie darin erkannte, daß diese in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft eine Grundlage für Gespräche bereitstellen, die allen gemeinsam ist; und nicht in dem, was in den Medien inhaltlich vermittelt werden soll. Aus ideologiekritischer Sicht läßt sich hierin eine demokratische, pluralistische Variante der 'Gleichschaltung' erkennen, bei der also nicht jeder das gleiche denken soll, sondern jeder das gleiche einschaltet und dann denken und sagen darf, was ihm oder ihr beliebt. Die Ideologie ergibt sich aus der Tatsache der Beteiligung am Gemeinschaftserlebnis und dem damit installierten gesellschaftlichen Verhältnis, aber nicht aus den kommunizierten Inhalten. Dieser Art der 'Gleichschaltung' entgehen eigentlich nur zwei Extrempositionen im Umgang mit dem Fernsehen, die sich praktisch schwer durchhalten lassen: die völlige Abstinenz sowie das wahllose Alles-Ansehen, bei dem alles auch gleichermaßen ernstgenommen wird; eine Rezeptionshaltung, die sich z.B. bei Rainald Goetz in seinem auch bzw. mittlerweile nur noch als Buch Abfall für alle erhältlichen Internet-Tagebuch findet. |
||||
Heutzutage hat sich diese Art der Gemeinschaftsbildung angesichts der Vielzahl von Fernsehprogrammen und der Verbilligung der Fernsehgeräte, die dazu führte, daß in vielen Haushalten mehrere Geräte stehen, vielleicht abgeschwächt. Allerdings sind auch massive Gegentendenzen zu beobachten, so die mediale Inszenierung der letzten Fußball-Großereignisse, bei denen man nicht nur die kollektive Rezeption beim 'Public Viewing' propagierte, sondern diese auch ideologisch als Beweis für ein neues, friedlich-fröhlich feierndes Deutschland funktionalisiert wurde, wodurch ein angeblich 'ganz normaler Patriotismus' offenbar erfolgreich im Alltagsbewußtsein einer Mehrheit verankert wurde. Daneben haben sich im Laufe der Zeit auch neue, nun nicht mehr unbedingt familiäre Kleingemeinschaften zur kollektiven Rezeption herausgebildet, meist um sogenannte Kult-Sendungen, wie den mittlerweile fast zur Institution gewordenen Serien wie Tatort und Lindenstraße, oder, wenn Partys zum Eurovision Song Contest stattfinden. |
||||
Qualitätskriterien und Distinktionsmöglichkeiten | ||||
In den Ländern mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen nach dem Vorbild der britischen BBC war das Fernsehen an den Auftrag zur Bildung, Information und Unterhaltung gebunden, ein Auftrag, in dem sich unschwer die Überreste der klassischen bildungsbürgerlichen Ideale des 'Guten, Schönen und Wahren' erkennen lassen. Dennoch hegten die an der klassischen Hochkultur orientierten Schichten lange Zeit Vorbehalte gegen das Fernsehen. In Erinnerung mag noch Helmut Schmidts Vorschlag eines fernsehfreien Tags pro Woche sein, typisch war auch die demonstrative Unkenntnis oder das demonstrativ falsche Erinnern von Namen, die aus dem Fernsehen oder anderen 'trivialen' Kulturbereichen bekannt waren. Erst im Laufe der Zeit begannen diese Vorbehalte zu bröckeln, an die Stelle der Ablehnung des Fernsehens als solchem trat die Unterscheidung von 'guten', 'wertvollen' und 'minderwertigen' Sendungen, oft natürlich zuerst aus pädagogischen Gründen, wenn es galt, den Fernsehkonsum der Kinder zu steuern. |
||||
Hier stellt sich natürlich die Frage nach den -- ästhetischen oder ethischen -- Kriterien für derartige Qualitätsurteile. Ästhetisch lassen sich, allgemein formuliert, die Komplexität im Umgang mit Material und Form oder die Relevanz des behandelten Themas ins Felde führen; ethisch das Verhältnis zu von als gesellschaftlich wünschenswert angesehenen ethischen Maßstäben; da diese jedoch häufig umstritten sind, sind Diskussionen um den ethischen Wert von Fernsehsendungen immer auch Kampfplätze, auf denen um die Geltung bestimmter Maßstäbe gestritten wird. Dies gilt auch für die ästhetischen Bewertungskriterien, wie seit Pierre Bourdieus berühmt gewordener Studie über Die feinen Unterschiede bekannt ist, in der er beschreibt, wie in den Aneignungsweisen von Kultur sich soziale Hierarchien reproduzieren, etwa durch den Mechanismus des Distinktionsgewinns durch die exklusive Aneignung von Kulturgütern. Das Fernsehen ist allgemein zugänglich, auch die Pay-TV-Kanäle sind nicht unerschwinglich: die Wahl des Fernsehprogramms läßt sich daher etwa nicht zu Distinktionsgewinnen mit ökonomischem Hintergrund nutzen, wie beim Kunst- und Antiquitätenerwerb, wo die angeeignete Kennerschaft erst durch die finanzielle Ausstattung, die den Kauf ermöglicht, wirklich zum Tragen kommen kann. Finanziell weniger gut ausgestattete Klassen reagieren darauf mit der Entwicklung anderer, neuartiger Arten der Aneignung von Kultur, zu denen die Entwicklung neuer ästhetischer Hierarchien gehört. Distinktion ist also beim Fernsehen für alle vorrangig durch die Art des Umgangs mit dem Fernsehen zu erzielen. Hierzu gehören die Wahl bestimmter Sendungen, die Präferenz für bestimmte als anspruchsvoll geltende Sender wie arte, aber auch die Entwicklung neuartiger Rezeptionsweisen, wie das erst mit dem Aufkommen der Fernbedienung möglich gewordene Zappen, das Verwandtschaft mit avantgardistischen Strategien der Fragmentierung (Collagen) hat und beim Zuschauen Effekte erzeugen kann, die dem surrealistischen Schönheitsbegriffs des zufälligen Zusammentreffens inkohärenter Dinge ähneln, sich aber durch die Begrenztheit der möglichen Elemente schnell erschöpfen. |
||||
Die Bewertungskriterien ergaben sich zunächst vor allem entlang einer Hierarchisierung der drei Bestandteile des Programmauftrags: es wurde zwischen Bildungs- und Informationssendungen auf der einen und den Unterhaltungssendungen auf der anderen Seite differenziert; ausgenommen allenfalls noch politisches Kabarett oder Loriot. Als etwa seit Anfang der 1980er Jahre eine sachkundigere Fernsehkritik entstand, wurden die Differenzierungen vielfältiger: gute konnte von schlechter Unterhaltung unterschieden werden, gute von schlechter Information (Kritik an Infotainment, während die öffentlich-rechtlichen Sender nun ihre 'Informationskompetenz' als Trumpf gegen die Privatsender auszuspielen begannen); gute von schlechten Bildungssendungen (das einstige Schulfernsehen wurde zum nicht mehr nur für Schüler und Schülerinnen produzierten 'Wissen'-Genre modernisiert, das der 'Häppchenkultur' des 'Edutainment' entgegentrat). |
||||
Privatfernsehen und Spartenprogramme in Zeiten neoliberaler Individualisierung | ||||
Die Zulassung des Privatfernsehens in den 1980er Jahren brachte eine grundsätzliche Umgestaltung der Programmlandschaft mit sich, die mit zeitgleich ablaufenden gesellschaftlichen Prozessen in mehrfacher Hinsicht korrespondierte. Die Durchsetzung des neoliberalen Gesellschaftsmodells wirkte sich auf das Fernsehen nicht nur auf der ökonomisch-institutionellen Ebene aus (das staatlich kontrollierte, durch Parteienproporz ausgestaltete Monopol der öffentlich-rechtlichen Sender wurde durch die auf Gewinnerzielung ausgerichteten Privatsender ergänzt), sondern wurde auch durch ideologische Unterfütterungen sekundiert, die die Art und Weise betrafen, wie über Fernsehen geredet wird und welche Kriterien zur Beurteilung angelegt werden. Zu nennen ist hier beispielsweise die Freiheitsrhetorik: Durch das Privatfernsehen sollte 'mehr Meinungsvielfalt' erreicht werden, die Zuschauer sollten von öffentlich-rechtlicher 'Bevormundung' befreit werden. Dies läßt sich bereits mit den gesellschaftlichen Tendenzen zur Individualisierung in Verbindung bringen: an die Stelle von wie auch immer definierten objektiven Qualitätskriterien tritt die Begründung der Mediennutzung aus dem subjektiven Gefallen, letztlich also dem individuellen Geschmack. Mit der Einführung der privatwirtschaftlichen Rechtsform wird also auch die Begründung des Fernsehkonsums an das ökonomietheoretische Ideologem der Konsumentensouveränität angepaßt. Die Einschaltquoten der 'werberelevanten Zielgruppen' werden zur Letztbegründung, da sie die Leitwährung der ökonomischen Grundlagen des Privatfernsehen darstellen, ohne die es in dieser Form nicht existieren könnte. |
||||
Dies erfolgte -- ob zufällig oder nicht, soll hier nicht erörtert werden -- in demjenigen Zeitraum, in dem eine Tendenz zur Individualisierung auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu konstatieren war: also ein Rückgang der Orientierung an kollektiv vorgegebenen Maßstäben und Leitbildern, der sich u.a. aus objektiven sozialstrukturellen Faktoren wie der Entstandardisierung von Erwerbsbiographien ergab, mit entsprechenden Auswirkungen auf die nun entstehenden individuellen, subjektiven Orientierungen. An die Stelle der vom sozialen Herkunfts- oder angepeilten Zielmilieu vorgegebenen Deutungsmuster traten solche, die nach mitunter auch wechselnden subjektiven Erfordernissen konstruiert waren und sich mitunter aus Elementen zuvor unverbundener oder sogar konkurrierender Ideologien zusammensetzten. |
||||
Die Entstehung von Spartenprogrammen im Fernsehen ist eine der am Fernsehprogramm ablesbaren Folgen dieser Individualisierung: der tendenzielle Rückgang des Gemeinschaftserlebnisses Fernsehen (trotz der oben beschriebenen Phänomene des kollektiven Konsums); an die Stelle des gemeinsamen Fernsehkonsums trat eine individuelle Ausdifferenzierung der Fernsehgewohnheiten. Aus der Koinzidenz von gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen und der Durchsetzung des Privatfernsehens ergab sich nun eine dramatische Konterkarierung des einstigen, aus den Zeiten des öffentlich-rechtlichen Monopols überkommenen 'Anspruchsdenkens', als Information, Bildung und Unterhaltung immer unter dem Legitimationsdruck standen, zumindest anspruchsvoll zu sein, während die Sendungen bloß 'leichter' Unterhaltung, die es natürlich auch bereits gab, sich zumindest über die vorher und nachher laufenden Programme legitimieren mußten. |
||||
Aus den nun herrschenden Rahmenbedingungen, mit der Konkurrenz der Sender um Werbekunden und 'Marktanteile' bei den Zuschauern, resultierte neben einer auch neu entstandenen Experimentierfreude (zumeist wurden allerdings im Ausland erfolgreiche Fernsehformate imitiert und an die mutmaßlichen deutschen Sehgewohnheiten angeglichen) vor allem eine Logik der Überbietung, die sich jenseits einer Orientierung an 'Anspruch' in Extreme steigern konnte, die bis an die Grenzen der auch für die Privaten geltenden Mindestvorgaben hinsichtlich Gewaltverherrlichung, Menschenwürde, Pornographie usw. gehen konnte -- oder gerade so weit darüber hinaus, daß es zumindest noch strittig war, ob diese Grenzen verletzt waren, und die deswegen entstehenden Debatten wiederum die Einschaltquoten steigerten. |
||||
Man erinnert sich vielleicht noch an die Zeit vor der Einführung des Privatfernsehens, als dessen Befürworter neben mehr oder weniger offen zugegebenen politischen Motiven (dem Mißfallen an einigen angeblich zu linkslastigen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten wie dem WDR und Radio Bremen) und den offensichtlichen wirtschaftlichen Interessen (neue Investitionsmöglichkeiten für Medienkonzerne) auch "mehr Programmvielfalt" als Argument ins Felde führten. 25 Jahre später ist diese Vielfalt durch Spartensender zum Teil eingetreten, ansonsten läßt sich eher die Angleichung des Belanglosen konstatieren. Die 'Vollprogramme', einschließlich der öffentlich-rechtlichen Sender, werden einander immer ähnlicher: Quizsendungen, Daily Soaps und Telenovelas, Infotainment sowie (und meist am besten): die Ausstrahlung von amerikanischen und britischen Serien. Ein Unterschied besteht vor allem im quantitativen Anteil der Informationssendungen. |
||||
Der Kompromiß zwischen Wertkonservatismus und Wirtschaftsliberalismus: individuelle Freiheit im Konsum, anonyme Kollektivierung als Herrschaftstechnik | ||||
Nähme man die Argumente der einstigen Befürworter ernst, dann ergäbe sich für diese ein Dilemma, das vor allem deshalb von Interesse ist, weil es einen Konflikt im Kleinformat reproduziert, der innerhalb der ideologisch dominanten Strömungen des CDU-Wählerspektrums besteht: den Konflikt zwischen Wertkonservatismus und Wirtschaftsliberalismus, der programmatisch ständig ausgeglichen oder überspielt werden muß. In dem Maße, in dem der Wirtschaftsliberalismus in alle Lebensbereiche durchdringt, verschont er auch nicht die von den politischen Trägern der wirtschaftsliberalen Deregulierung in den christdemokratischen Parteien sonst hochgehaltenen traditionellen 'Werte'. Diese können dann bloß noch in hilflosen und konfusen 'Wertedebatten' am Leben gehalten und in Sonntagsreden eingefordert werden, während sie durch die gesellschaftliche Wirklichkeit (und unter anderem auch durch das Fernsehen) ständig dementiert und untergraben werden. Ein Vordenker des Wirtschaftsliberalismus wie Friedrich von Hayek berief sich gerne auf die Tradition, die er, wie die liberale Wirtschaftsordnung, als evolutionäre Errungenschaft ansah, offenbar in der Hoffnung, sie könnte ausreichen, um die ethische Indifferenz des wirtschaftsliberalen Gesellschaftsmodells zu kompensieren. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Nun stehen bei manchen Gelegenheiten die Wertkonservativen, ungeachtet ihres politischen Bündnisses mit den Wirtschaftsliberalen, wie die Zauberlehrlinge vor den Geistern, die sie riefen und nun nicht mehr los werden. Ein jüngeres Beispiel: gerade aus christlich-konservativer Ecke häuften sich zu Ostern des Jahres 2008 die Proteste gegen die Häufung von Gewaltfilmen im Feiertagsprogramm einiger Privatsender. |
||||
Dieser Konflikt scheint gegenwärtig auf gesamtgesellschaftlicher Ebene durch eine Neuinstallierung einer repressiven Law-and-Order-Politik gelöst werden zu sollen, die zwei Funktionen erfüllt: ideologisch bedient sie die Ordnungssehnsucht der Wertkonservativen, praktisch können mit ihr einige der Symptome der gesellschaftlichen Desintegration, nämlich diejenigen, die in Form von Kriminalität sichtbar werden, bekämpft werden. (Für das Fernsehen bietet sich diese Strategie allerdings nicht an.) Dem ungeachtet steht über allem der Schlüsselbegriff der 'Freiheit': Wirtschaftsliberal besteht diese Freiheit in der Freiheit der privatwirtschaftlichen Tätigkeit mit möglichst wenigen außerwirtschaftlichen Rücksichten, nicht in der Freiheit derjenigen, die durch diese Tätigkeit in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Der Freiheitsbegriff ist für seine ideologische Funktionalisierung bei der Durchsetzung des Neoliberalismus auch deshalb attraktiv, weil er ein hohes Prestige in der republikanisch-demokratischen Tradition besitzt, wo er mit Toleranz, Zivilcourage und Pluralismus assoziiert ist. Diese Freiheit kommt in der modernen Demokratie allen Bürgern zugute und ist nicht mehr nur das Privileg der Besitzenden innerhalb der frühbürgerlichen Ständeordnung, in der dieser Freiheitsbegriff entstand. Seine Entsprechung auf der ästhetischen Ebene ist wiederum der Geschmack, verstanden als individuelles Vermögen zum ästhetischen Urteil (und unter Ausklammerung der Ethik), zu dem jeder fähig ist, auch wenn es der Entwicklung und Übung bedarf. In der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft hat jeder das Recht nicht nur auf eine eigene Meinung, sondern auch auf einen eigenen Geschmack. Beide werden mit Vorliebe quantitativ ermittelt: Meinungsumfragen, Wahlen, Verkaufszahlen von kulturellen Gütern und beim Fernsehen eben Einschaltquoten, durch die eine Rangordnung der Meinungen und Geschmäcker hergestellt wird. |
||||
In diesem Zusammenhang verdient ein weiteres Phänomen Beachtung: werden die Fernsehzuschauer als Objekte in den Blick genommen, werden sie auf der Ebene von aggregierten Kollektivgrößen analysiert: x% der werberelevanten Zielgruppe sehen Sendung y, und eventuell wird dann noch weiter aufgeschlüsselt nach Altersstufen, Geschlecht, Wohnregionen, Einkommen etc. Auf der Ebene der ideologischen 'Anrufung' geht es hingegen immer um das Individuum: der Kunde bzw. der Zuschauer ist König. In dieser Aufspaltung läßt sich ein allgemeines Merkmal heutiger Herrschaftstechniken erkennen: Kollektivgrößen werden dann bemüht, wenn es um die bei der Regierungstätigkeit anfallenden praktischen Regulierungsmaßnahmen geht: X Millionen Arbeitslose, Rentner, Migranten, Schüler, Studenten, Erwerbstätige sollen sich angesichts einer bestimmten Maßnahme in statistisch erwartbaren Dimensionen anders in Richtung auf das durch die jeweilige Maßnahme angestrebte Ziel verhalten. Auf der ideologischen Ebene wird hingegen der neoliberale Individualisierungsdiskurs gepflegt: Aktivierung, Eigenverantwortung, Freiheit; das Subjekt wird als nur für sich selbst verantwortliches und auf sich selbst gestelltes Individuum angesprochen. Das Fernsehen ist in dieser Hinsicht also Abbild der heutigen gesellschaftlichen Tendenzen: der objektivistische Diskurs bei der Durchsetzung und Anwendung von Herrschaftstechnik wird um die Anrufung des Subjekts als freies, selbstverantwortliches Individuum ergänzt. |
||||
Das Vergnügen am Trash-Fernsehen | ||||
Jenseits dieser politisch-ideologischen Verschiebungen in den Rahmenbedingungen des Fernsehens seit Mitte der 1980er Jahre läßt sich immer noch konkret fragen: welche Art von Vergnügen empfinden die Zuschauer der 'neuen Fernsehformate'? Distinktionsgewinn ist jedenfalls kaum zu erzielen, ebensowenig wie durch das Fernsehen insgesamt; und zwar weder durchs Anschauen noch durchs Nichtanschauen; durch das Anschauen nicht, weil es dazu zu viele andere Zuschauer gibt; durchs Nichtanschauen nicht, weil das zumindest bei denen, die auf Distinktion Wert legen, ohnehin normal wäre. Wenn, dann also höchstens durch das Anschauen aus einem originellen Motiv heraus. Die professionellen Rezipienten wiederum dürften sich jeweils bald nach Aufkommen der einzelnen neuen Fernsehformate verabschiedet haben; zunächst waren die neuen Fernsehformate ja einfach wegen ihrer Popularität populär; man sah sie, weil andere sie sahen, um darüber mitreden zu können; aber das reicht für einen dauerhaften Erfolg nicht aus. Diejenigen, die sie ansahen, weil diese Formate zum allgemeinen Gesprächsthema wurden, werden damit aufgehört haben, nachdem sich die ersten Diskussionen gelegt hatten. Aber die meisten dieser Formate laufen ja, wenn auch zum Teil in eingeschränktem Umfang, weiter. Die Einschaltquoten sind für die Sender offenbar zufriedenstellend. Empfinden die Zuschauer, die diese Sendungen anschauen, ein ästhetisches Wohlgefallen? Bieten die Sendungen Unterhaltung? Sind sie bloßer Zeitvertreib? Entsprechen sie einem wie auch immer definierten Geschmack? Oder stützt sich das Vergnügen einfach auf Schadenfreude, das Amüsieren über Talentlosigkeit, über bizarre Konflikte, die einen selbst nicht betreffen, also letztlich auf eine leicht zugängliche Variante des Voyeurismus? Auch wenn man nicht, dem Cultural-Studies-Ansatz folgend, es so weit treiben muß, hier Widerstand oder Subversion zu vermuten; das Vergnügen, das auch beim 'emanzipatorischen' Fernsehkonsum am Anfang steht, muß ja vorhanden sein. |
||||
Ein kurzer, kursorischer Blick in TV-Foren zum Dschungel-Camp ergibt folgenden Eindruck: Diejenigen, die diese Sendung gerne sehen, betrachten sie nicht als 'geschmackvoll', als ästhetisch qualitätsvoll, ethisch vorbildlich oder informativ: Lästern, Schadenfreude und eine gewisse Art von Sadismus werden als Gründe genannt, das Dschungel-Camp zu sehen, auch "einfach Unterhaltung" und "Ablachen" werden angeführt, wie auch das "Vergnügen, menschliche Stärken und Schwächen in besonderen Situationen vorgeführt zu bekommen". Eigentlich handelt es sich also um ein nun massenmedial bereitgestelltes funktionales Äquivalent zum guten alten Dorfklatsch. Letztgenannte Motivation würde allerdings genauso eine Rezeptionsweise bezeichnen, die sich auf einen beträchtlichen Teil hochkulturell anerkannter Literatur anwenden ließe. Problematisch könnte also diese Art der Rezeption nicht nur beim offensichtlich 'Geschmacklosen', sondern auch beim 'Anspruchsvollen' sein: Wie ist es zu bewerten, wenn man sich aus gesicherter Distanz an den Nöten und Katastrophen anderer, fiktiver oder realer, Personen erfreut? Auch kann man sich überlegen, was nötig ist, damit diese Art der Inszenierung funktioniert: Wichtig ist ein ritualisierter Ablauf; außerdem muß eine gewisse Mindestvertrautheit mit den Personen (B-Promis) oder Konflikten (in den Gerichtsshows z.B. aus dem Alltag bekannte Probleme) existieren; zur Not wird diese Mindestvertrautheit durch die Art der Präsentation auch erst hergestellt. |
||||
Kritik an diesen Sendungen wird in den Foren selten differenzierter denn als "Niveaulosigkeit" oder "Geschmacklosigkeit" formuliert, es finden sich aber auch Vergleiche mit öffentlichen Hinrichtungen. Gegen Niveauansprüche werden gängige Muster zur Immunisierung gegen Kritik aufgefahren: diejenigen, die Niveau einfordern, schauten ja selber die Sendungen an. Wenn also selbst für die regelmäßigen Zuschauer gar kein positiver ästhetischer Wert im Vordergrund steht, so befindet man sich im Gebiet der 'Trash'-Rezeptionshaltung, der Freude am unfreiwillig Mißlungenen, 'Schrägen'. In den 1960er Jahren war sie noch neu, in den 1970er/80er Jahren eine Spielwiese für subkulturelle Distinktionskämpfe, seit den 1990er Jahren ist sie allmählich im Mainstream angekommen, nun auch ohne jene Reflexivität, die bei den intellektuellen Vorreitern einst vorlag. |
||||
Varianten der ironischen Rezeption der Massenmedien | ||||
Das Vergnügen am Trash, dem ironischen Etwas-gut-Finden, gerade weil es schlecht ist, ist noch kaum näher analysiert [Anm. 1]; und wenn doch, dann eher in bezug auf seine avantgardistisch-intellektuellen Wurzeln: hier überwog das Interesse an solchen Formen der Abkehr von den ästhetischen Normen der Hochkultur, die abseits von den immer schneller hochkulturell akzeptierten avantgardistischen Überschreitungen stattfanden. Welche Gestalten der Trash-Konsum im Zuge seiner Ausbreitung in den Mainstream angenommen hat, ist schwerer zu erfassen. |
||||
Die ironische Grundhaltung, die hier zugrunde liegt, wurde nach dem 11. September 2001 wohl allzu schnell totgesagt. Vielleicht stellt die verallgemeinerte Ironie ja eine angemessene Reaktion auf den alltäglichen Medienüberfluß dar, selbst wenn dabei die Gefahr entsteht, auch das nicht mehr erkennen zu können, was der Ironisierung widersteht. Jedenfalls würde damit aus dem Bewußtsein der Schwierigkeit des ästhetischen Gelingens im Fernsehen die durchaus einleuchtende Konsequenz gezogen, sich dem Mißlungenen in seiner Mißlungenheit zuzuwenden, statt sich bloß, asketisch oder angewidert, abzuwenden. Auch Ironisierung läßt sich jedoch nicht einfach über einen Kamm scheren; Ironie kann sehr verschiedene Formen annehmen, auf verschiedenen Motiven beruhen und verschiedene Einstellungen zur massenmedialen Umwelt zum Ausdruck bringen. Zu unterscheiden wären hier u.a.: |
||||
- Ironie als eine allgemeine Lebenseinstellung, die entweder am Bewußtsein der allgemeinen Künstlichkeit der massenmedialen Umgebung geschult ist oder aber durch diese verursacht ist; |
||||
- Ironie als eine Immunisierungsstrategie, die die eigene, unreflektierte Freude am im Grunde als minderwertig Anerkannten akzeptabel machen soll; dies wäre bei einem Großteil der Aussagen zum Dschungel-Camp-Konsum zu vermuten; |
||||
- Ironie als eine nur auf klar definierte Teilbereiche des medial Wahrgenommenen angewendete Haltung; nämlich auf das, was als unernst, unwichtig, nebensächlich gilt, basierend auf einer eindeutigen Ordnung dieser Bereiche. Hier wäre auch danach zu unterscheiden, ob es sich um gesellschaftlich dominante oder eher um eigensinnig-eigenständige Ordnungen handelt; |
||||
- Ironie als intuitives Bewußtsein, das eigentlich nichts in der Medienwelt ernst zu nehmen ist; was durchaus zu begrüßen wäre, wenn es sich auch auf die Nicht-Trash-TV-Programmbestandteile erstreckte, wo es meist die Form von Ressentiments annimmt, die Helge Schneider vor Jahren in dem Song Die Herren Politiker treffend karikierte: "... die Herren Politiker ... die sind alle doof ... die wollen nur unser Geld ... die sollen doch alle ... nach Hause gehen ... alle wie sie da sitzen ..." |
||||
Diese Vielfalt möglicher ironischer Aneignungen ist vielleicht für die Popularität der neuen Fernsehformate entscheidend: bei diesen haben sich noch nicht über Jahrzehnte hinweg festgezurrte Rezeptionshaltungen eingespielt, so daß sich an diesen Sendungen sowohl ungewohntere Rezeptionshaltungen bewähren wie auch neue Rezeptionshaltungen herausbilden können. Dies wird begünstigt durch die leichte Verfügbarkeit und die schon in Luhmanns These hervorgehobene Möglichkeit zur Anschlußkommunikation. Bei der Lektüre der TV-Foren entsteht bisweilen sogar der Eindruck, die Diskussionen über die Sendungen seien wichtiger als diese selbst, auch dies also ein Indiz für die Verwandtschaft mit dem Klatsch. |
||||
Ein kurzes Fazit | ||||
Mag ein Großteil des heutigen Fernsehens nach hergebrachten ästhetischen oder ethischen Kriterien wenig ergiebig sein, so ist dies kein Grund, es deswegen zu verdammen oder pauschal der Verdummung zu verdächtigen. Auch ein 'besseres' Fernsehprogramm -- wie auch immer dieses aussehen könnte -- würde dessen ideologische Rahmenbedingungen nicht ändern; zudem ergeben sich vielleicht gerade aus minderen ästhetischen Qualitäten größere Spielräume für innovative, eigensinnige Rezeptionshaltungen, für die Entwicklung von Geschmacksmustern jenseits des 'Guten, Schönen, Wahren'. Beruft man sich aber allein auf den Geschmack der Zuschauer, im Sinne einer nicht weiter begründbaren individuell-subjektiven Entscheidung analog zur Konsumentensouveränität der Ökonomie, rücken die interessanteren Fragen nach den Verschiebungen und Konflikten ästhetischer Rangordnungen gar nicht erst in den Blick. |
||||
|
autoreninfo
Dr. Frank Illing, geb. 1965, studierte Soziologie, Volkswirtschaft und Philosophie in Freiburg i. Br.; Promotion mit einer Arbeit über die Beziehungen des tschechischen Strukturalismus zur poetistischen Avantgarde: Jan Mukarovsky und die Avantgarde (Bielefeld 2001). Weitere Buchveröffentlichung: Kitsch, Kommerz und Kult. Soziologie des schlechten Geschmacks (Konstanz 2006). 1996-2006 Redakteur beim Freien Radio Radio Dreyeckland in Freiburg. Zur Zeit Arbeit an einer Studie über Imagekonstruktionen in den Kunstavantgarden des 20. Jahrhunderts.
E-Mail: fffilling@gmx.de |
||||
|
|