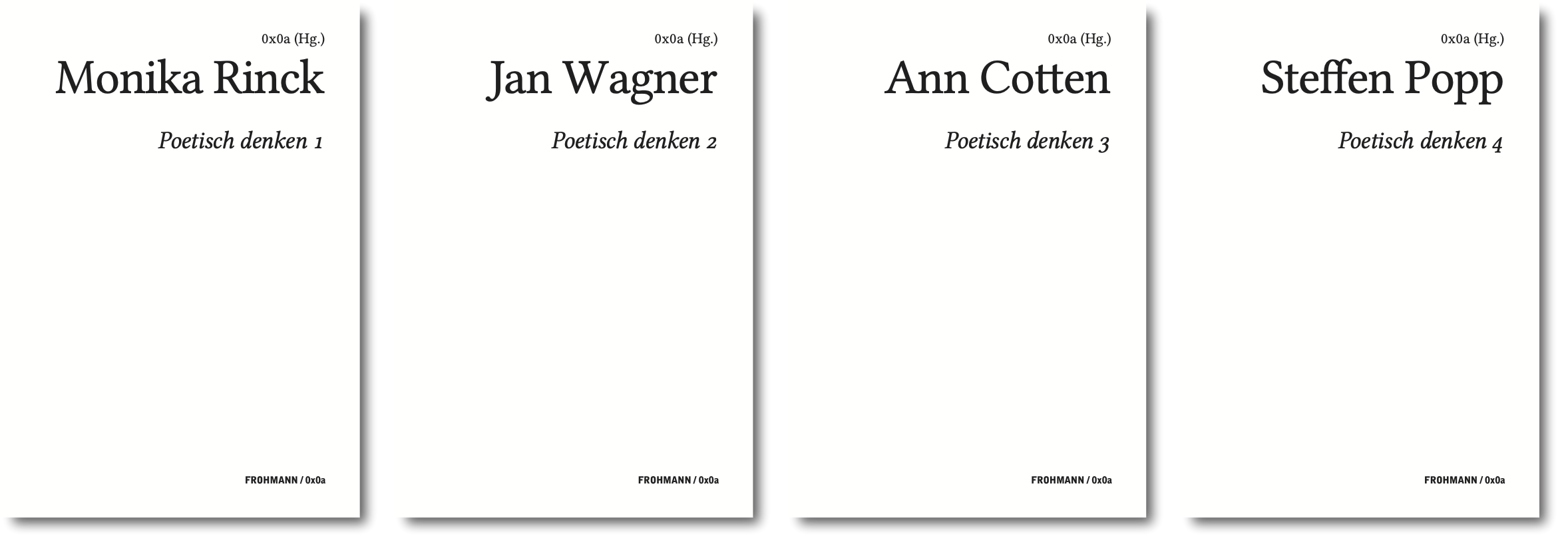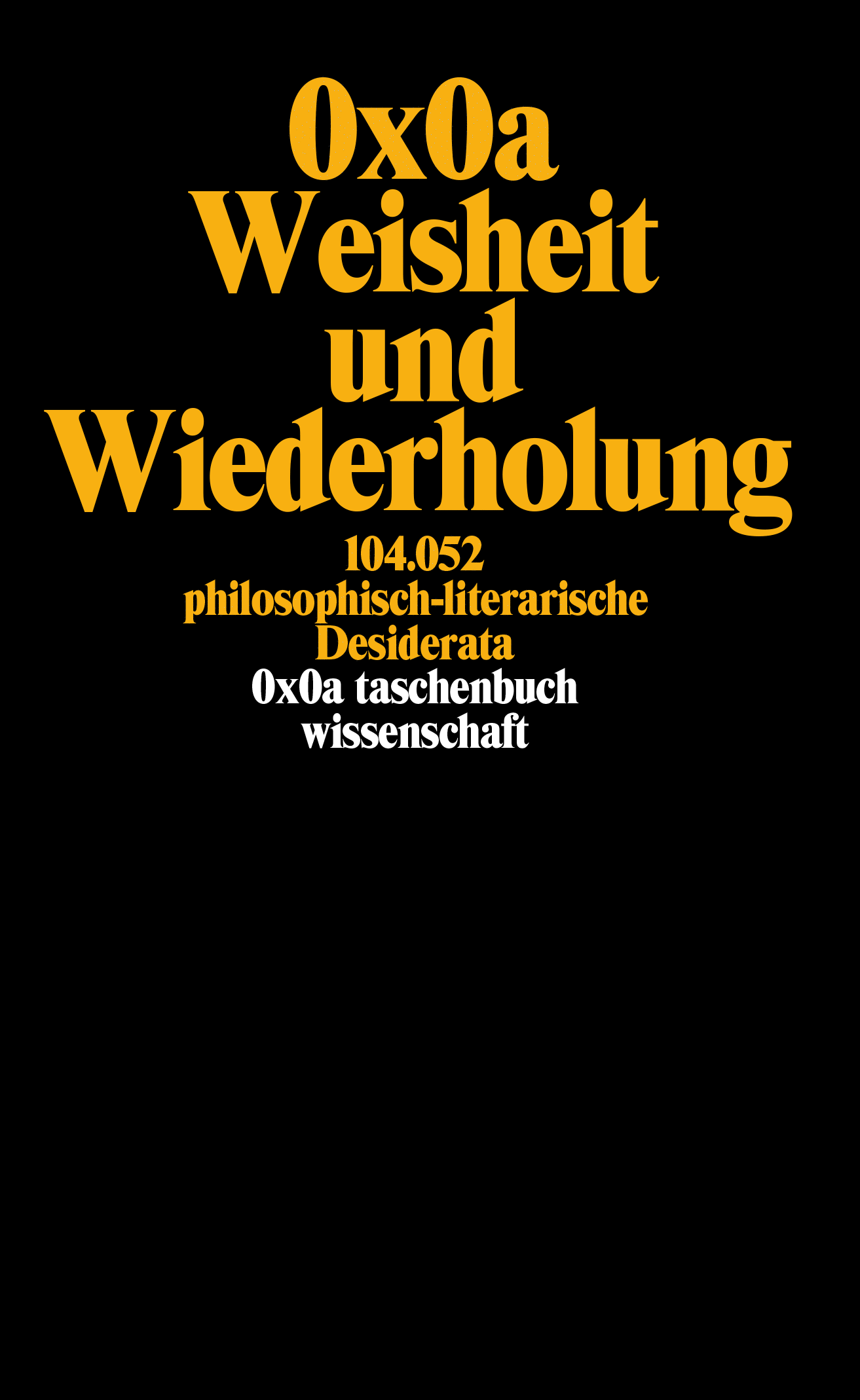 »Und« verbindet und trennt, koordiniert und hält auf Abstand. Doch bleibt das Verhältnis zwischen zwei durch »und« gekoppelten Termen ambivalent, kann sowohl Zusammengehörigkeit wie Gegensatz ausdrücken. Vielleicht dieser Vagheit wegen sind sie als Titel vor allem für philosophisch-literarische Großwerke populär: Sein und Zeit, Wirtschaft und Gesellschaft, Kritik und Krise, Mohn und Gedächtnis.
»Und« verbindet und trennt, koordiniert und hält auf Abstand. Doch bleibt das Verhältnis zwischen zwei durch »und« gekoppelten Termen ambivalent, kann sowohl Zusammengehörigkeit wie Gegensatz ausdrücken. Vielleicht dieser Vagheit wegen sind sie als Titel vor allem für philosophisch-literarische Großwerke populär: Sein und Zeit, Wirtschaft und Gesellschaft, Kritik und Krise, Mohn und Gedächtnis.
Aber noch ist nicht alles gesagt. Was ist mit Mohn und Zeit, Wirtschaft und Kritik, Sein und Krise? Es bleibt auch für zukünftige Diskursgrößen viel zu tun. Das Kompendium Weisheit und Wiederholung versammelt die Titel von 104.052 noch zu schreibenden Büchern: Eine To-do-Liste intellektueller Selbstbeschäftigung, erstellt durch alle möglichen Permutationen der von Hendrikje Schauer und Marcel Lepper gesammelten Titelpaare (Works & Nights, 2018).
Neue Titel: Poetisch denken, Band 1-4
1Deep Dreaming der Lyrik: Poetisch denken hieß ein Buch von Christian Metz über vier Dichter*innen, die für ihn die Lyrik der letzten zwanzig Jahre wesentlich bestimmt haben: Monika Rinck, Jan Wagner, Ann Cotten und Steffen Popp. Poetisch denken heißt auch diese Sammlung, die je ein neues Buch von Rinck, Wagner, Cotten und Popp enthält, generiert mit dem neuronalen Netz GPT-2 und auf Grundlage aller in Metz’ Buch erwähnten Titel.
mehr…Neuer Titel: Vom Unterauftrag
0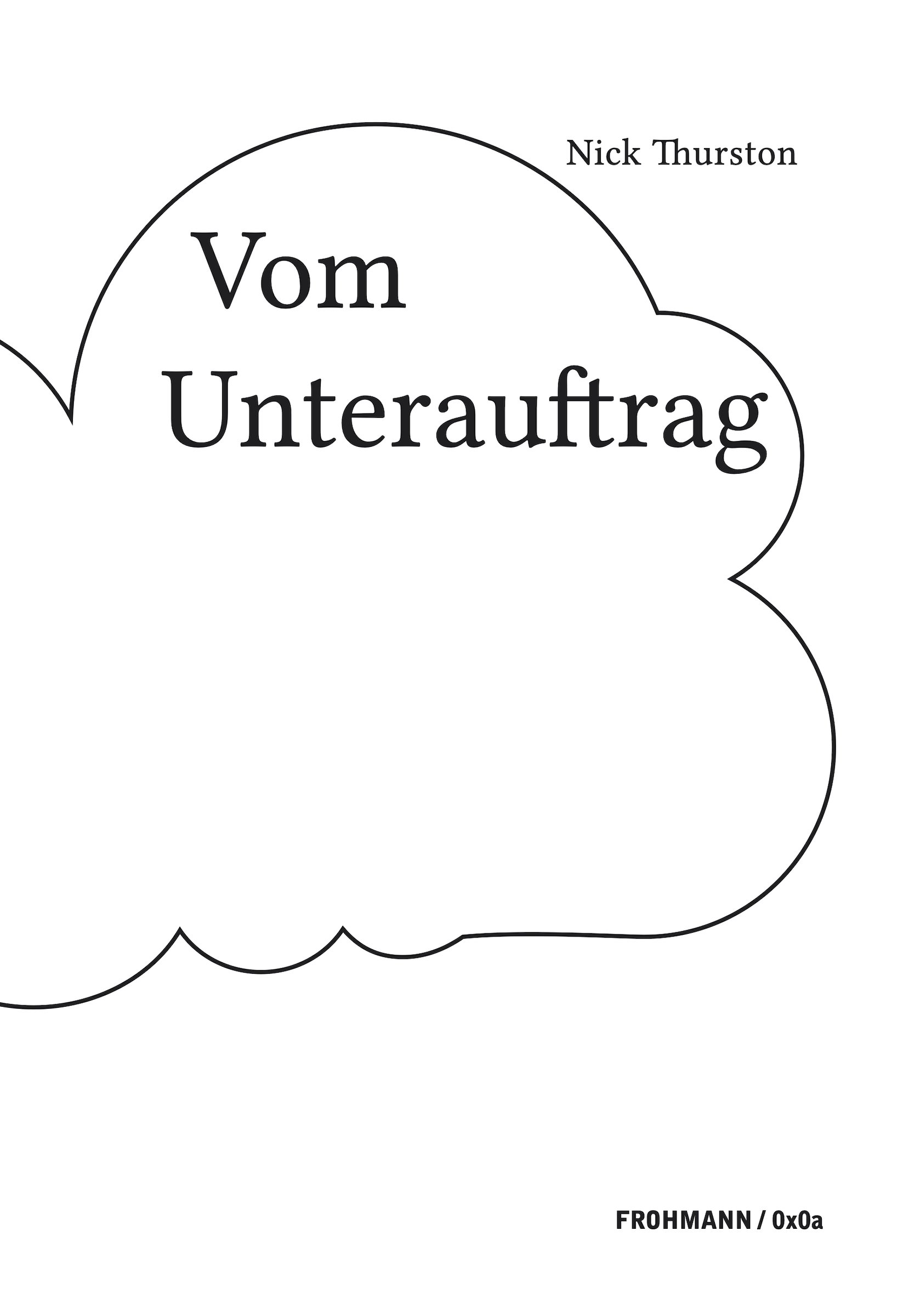
Es geht weiter mit konzeptuellen Titeln in Übersetzung: Diesmal ist es Nick Thurstons Vom Unterauftrag. Für das Buch ließ Thurston Gedichte über Amazon Mechanical Turk schreiben, den Mikrodienstleistungsservice von Amazon, bei dem Freischaffende für Centbeträge Kleinstaufträge ausführen. Als Kommentar zum Computerkapitalismus macht er jene »künstlichen künstlichen Intelligenz« literarisch fruchtbar, die nur Platzhalter für die noch nicht ausgereifte KI ist, die sie einmal ersetzen wird. Für 0x0a hat Nick Thurston sein Buch per Google Translate selbst übersetzt, einschließlich des »Vorworts« von McKenzie Wark und des Nachworts von Darren Wershler.
Auf dem Poesiefestival 2020 stellte Thurston sein Buch vor (auch dabei: Kathrin Passig und Alvaro Seiça), eingeführt von 0x0a-Mitglied Hannes Bajohr und kuratiert von Annette Gilbert:
Das Buch gibt es bei uns und im Frohmann Verlag.
Neuer Titel: Megawatt
2 0x0a freut sich, einen neuen Titel in der »Weißen Reihe« in Kooperation mit dem Frohmann-Verlag präsentieren zu können: Nick Montforts Megawatt. Ein deterministisch-computergenerierter Roman, Passagen aus Samuel Becketts Watt erweiternd.
0x0a freut sich, einen neuen Titel in der »Weißen Reihe« in Kooperation mit dem Frohmann-Verlag präsentieren zu können: Nick Montforts Megawatt. Ein deterministisch-computergenerierter Roman, Passagen aus Samuel Becketts Watt erweiternd.
Megawatt ist Rekonstruktion und Steigerung von Samuel Becketts hochartifiziellem Roman Watt in einem. Autor und Programmierer Nick Montfort wählte aus der Vorlage Passagen mit systematischen Manierismen aus und ließ sie durch ein Python-Skript simulieren. Doch statt diese Passagen nur zu wiederholen – obwohl der Megawatt-Code auch dazu verwendet werden kann –, werden sie vielmehr intensiviert. So erzeugt Montfort mit den gleichen Methoden wie Beckett deutlich mehr Text als im ohnehin schon exzessiven Original zu finden ist: Aus Watt wird Megawatt. Dem Roman ist das Skript angehängt, mit dem er erzeugt wurde; die Übersetzung durch Hannes Bajohr erfolgt ebenfalls im Code.
Megawatt ist nicht die erste Übersetzung, die bei 0x0a erscheint. Bereits Dagmara Kraus’ LENZ war eine Art der konzeptuellen Übertragung, eine »Übersetzung à rebours«. Statt Rodney Grahams konzeptuelle Verarbeitung von Büchner’s Lenz direkt und Wort für Wort zu übertragen, übertrug sie das Konzept. Bei Megawatt war statt des Konzepts der Code zu übertragen, doch die erste Übersetzung von Watt ins Deutsche, die Elmar Tophoven 1970 für Suhrkamp besorgte, ist auch hier noch vorhanden. In den in Python verarbeiteten Fragmenten wird sie gedreht, gewendet, iteriert und rekursiv wiederholt: Und die arme alte, lausige Erde, die meine und die meines Vaters und meiner Mutter und der Mutter meiner Mutter und des Vaters meiner Mutter und der Mutter meines Vaters und des Vaters meines Vaters und der Mutter der Mutter meiner Mutter und …
Mehr zu Megawatt und dem ursprünglichen Entstehungskontext in diesem Beitrag von 2015.
Datenpoesie
0[Der folgende Text erschien am 27.2.2018 in der NZZ unter dem Titel »Unermüdlich dichtet das Maschinchen«.]
Digitale Literatur – was war das noch? Damals, tief in den neunziger Jahren, schwärmten Literaturwissenschaftler von der Hyperfiktion, von Texten ohne Zentrum, durch die sich der Leser selbst seine Pfade schlagen und per Link beliebig von Abschnitt zu Abschnitt gelangen konnte. Was aber einigen als Zukunft der Literatur erschien – in der sich vor allem liebgewonnene Konzepte der Postmoderne wiederfinden ließen –, war bald zu einem Genre ohne Leser und, schlimmer noch, ohne Produzenten geworden. Es gibt sie nicht mehr.
Und heute? Müsste in Zeiten der Digitalisierung die digitale Literatur nicht eigentlich das zentrale Genre der Gegenwart sein? In der Tat gibt es heute eine quicklebendige, aber nur wenig beachtete Szene. Anders als damals geht es nicht mehr darum, mehr oder minder konventionelle Texte durch Linkverzweigungen ihrer Linearität zu berauben. Heute wird der Computer selbst zum Textproduzenten. Das Ergebnis ist eine ganz andere Literatur, die von den Bedingungen des Digitalen erzählt, wie es ein klassischer Realismus nie könnte.
mehr…Bots unter Generalverdacht
1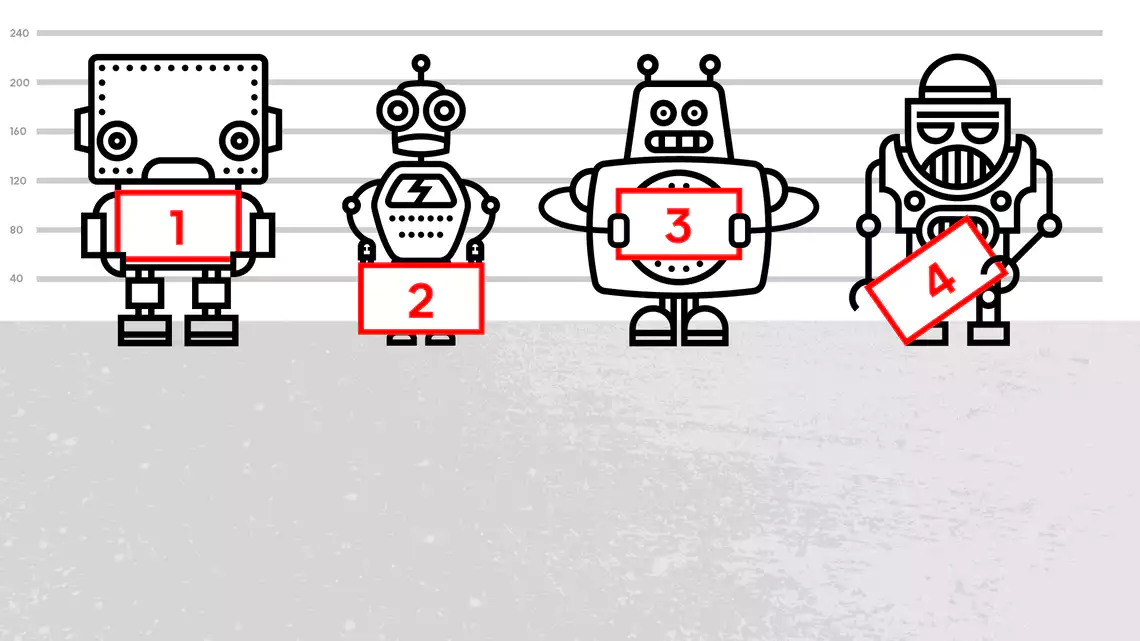
[Dieser Text erschien zuerst auf Krautreporter am 1. Dezember 2016.]
mehr…Vom Geist und den Maschinen
0[Dieser Text erschien zuerst auf dem Suhrkamp-Blog Logbuch Suhrkamp.]
Im letzten Jahr stellten Swantje Lichtenstein und Tom Lingnau einer Reihe von Autoren die Frage: Is the artist necessary for making art today? Was am Ende ein schmales Büchlein wurde, nahm seinen Ausgang mit dem Projekt Covertext, das sich dem Konzeptualismus und der Appropriation in der Literatur widmet. Vor diesem Hintergrund also wurde die Frage formuliert, welche Verbindung noch zwischen Künstler und Kunst besteht –, denn wenn in der konzeptuellen Literatur die Idee wichtiger als die Ausführung ist und wenn im reinen Sichaneignen und Kopieren fremden Materials keine Schöpfung im klassischen Sinne mehr vorliegt, ist die Idee der Autorschaft in der Tat in einer Zwickmühle angelangt, denn sie verhält sich dem Werk gegenüber flüchtig und ausweichend: Wer ist der Autor eines Buches, dessen Autor eigentlich ein anderer ist? Borges’ Pierre Menard lässt grüßen.
mehr…LENZ (Büchner Mueller Graham Kraus)
0 Übersetzung als Aneignung, Ansetzung und Übereignung: Dagmara Kraus über ihr Appropriations-Projekt LENZ (Büchner Mueller Graham Kraus), der ersten »Übertragung« konzeptueller Literatur auf 0x0a, der noch weitere folgen werden.
Heißt es in Georg Büchners einziger Novelle, der in den Vogesen mit dem Wahnsinn ringende Sturm-und-Drang-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz gehe »den Wald herauf« und, etwas weiter, »den Wald herab«, übersetzt C. R. Mueller beide Fälle einfach als »through the forest«. Rodney Graham nutzt diesen Glücksfall einer Übersetzungsungenauigkeit und greift an der Stelle ein, um die Wiederholung weitere Wiederholungen generieren zu lassen. Er setzt die drei Worte so über den Seitenumbruch, dass »through« jeweils auf der linken Seite des Buches steht, »the forest« auf der rechten. An das zweite »through« schließt allerdings nicht die Wortfolge der Originalerzählung an; stattdessen wird die dem Leser bereits bekannte Seite anmontiert, die zwar auch mit »the forest« beginnt, aber fortfährt wie eingangs: »and voices awakened on the rocky slopes, one moment like distant echoing thunder…« Hier beißt sich die Schlange in den Schwanz.
mehr…Subtitle Buoy
0I wrote a bot that subtitles updated photos from a buoy in the Atlantic Ocean with trending topics from the web: https://twitter.com/subtitle_buoy
Behind the scenes the bot is looking up what people search for on Google at the moment (Google trends) and tries to match relevant sentences for a topic on Twitter. Most of the times the pieces of text are news headlines, occasionally spam or deliberately spread disinformation.
The imagery comes from the National Data Buoy Center.
It’s also a Tumblr: http://subtitlebuoy.tumblr.com

Gregor Weichbrodt: No Offense
0Eine Version dieses Essays erschien im Programmheft von Gregor Weichbrodts Salon bei Room & Board am 29. Oktober 2015. Julia Pelta Feldman ist die Leiterin von Room & Board, einer Künstlerresidenz in Williamsburg, Brooklyn.
Gregor Weichbrodt besuchte vor einiger Zeit eine Bekannte in Berlin. Er wusste, dass sie des Öfteren internationale Gäste bei sich unterbringt, aber Weichbrodt, der die Dinge der Wohnung mit ihren eigenen Bezeichnungen beschriftet fand, fühlte sich dennoch mit einem Mal orientierungslos. Der Kühlschrank stand auf dem Kühlschrank; die Wand an der Wand. Natürlich waren diese Wörter da, um Besuchern beim Deutschlernen zu helfen, aber für den Muttersprachler Weichbrodt hatte diese Erfahrung eine surreale Qualität: Die redundanten Erklärungen entfremdeten ihn von diesen vertrauten, häuslichen Dingen.