Zeitungen bieten hierzulande die “Grundversorgung” (Habermas) der öffentlichen Kommunikation. Jetzt, da die digitale Revolution in der Mitte Deutschlands angekommen ist, fragt sich: Was unternehmen Zeitungen, um ihrer Rolle gerecht zu werden? Denn eines ist klar: Ohne entsprechende Öffentlichkeit, entsteht kein Bewusstsein für diesen historischen Moment. Berliner Gazette-Herausgeber Krystian Woznicki geht der Sache auf den Grund.
*
Wir erfinden uns neu. Diese vier Worte könnten das Motto der digitalen Revolution sein. Wofür steht das Wir? Wir als Gesellschaft… Wir als Bürger… Aber eben auch: Wir als Öffentlichkeit… erfinden uns neu. Das ist entscheidend. Ohne Öffentlichkeit gibt es kein geteiltes Bewusstsein darüber, dass „es“ passiert. Oder passiert ist. Dieses große, wichtige Ereignis: Die Revolution, in deren Zentrum das Internet und die digitale Vollvernetzung des gesamten Lebens stehen.
Öffentlichkeit, und auch das ist entscheidend, wird in Deutschland maßgeblich von Zeitungen hergestellt. Also von jenen Medien, die vor der digitalen Revolution ‘an die Macht’ kamen. Und die noch immer an der Macht sind. Paradoxerweise. Immerhin trifft sie der Umbruch mitten ins Mark. Erschüttert ihr Selbstverständnis und Geschäftsmodell, ihre Macht und gesellschaftliche Funktion.
Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb organisieren sie in Zeiten der digitalen Revolution maßgeblich die Öffentlichkeit und somit unser Verständnis darüber, was diese ausmacht. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem BDZV-Kongress betonte: „49 Millionen Menschen über 14 Jahren – also fast 70% unserer Bevölkerung über 14 Jahren – lesen regelmäßig eine Tageszeitung. Damit hat Deutschland eine Zeitungsdichte wie nur wenige Länder Europas.“
Den Tipping Point erreicht
Merkel sagt damit: Zeitungen bleiben “die politischen Leitmedien” – so wird sie jedenfalls in der Welt zitiert. Diese Lesart entspricht dem Wunschbild des Philosophen Jürgen Habermas. Für ihn bieten Zeitungen die energetische “Grundversorgung” der öffentlichen Kommunikation. Realistischer gedacht könnte man sagen: Zeitungen haben das Potenzial, eine kritische, aufgeklärte Öffentlichkeit herzustellen. Gerade in diesen Monaten ist dieses Potenzial von besonderer Bedeutung. Denn Deutschland hat einen Tipping Point erreicht: Die digitale Revolution ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Erstes Anzeichen: Die Zeitungen, die die öffentliche Kommunikation dieser Mitte bisher federführend formten, arbeiten in dieser Sache nicht mehr allein. 70% der Menschen in Deutschland nutzen das Internet – also genauso viele wie in der BRD Zeitungen lesen. Die Zahlen sprechen nicht nur für sich. Inzwischen sind sie auch im kollektiven Bewusstsein eingesickert. Vernetzte Öffentlichkeit ist hierzulande selbstverständlich geworden. Nur zu welchen Bedingungen? Die Debatten darüber haben erst angefangen. Das Spektrum ist äußerst breit.
Der arabische Frühling, Fukushima oder die Tötung Osama Bin Ladens – diese Großereignisse konnten nur durch das Zusammenspiel von klassischen Medien und Internet einen gewaltigen Grad der medialen Verbreitung erfahren. So gewaltig, dass sie zu “Mega Stories” (PEJ) avancierten, wie sie zuvor allenfalls nur in einem einzigen Ausnahmefall pro Jahr verzeichnet werden konnten. Jetzt kommen diese Blockbuster in Serie.
Globale Internet-Unternehmen wie Google und Facebook führen die Erneuerungen ihrer Dienste in immer schneller getakteten Folgen ein: Gesichtserkennung, Klarnamen-Zwang und der „Griff nach dem ganzen Leben“ (FR). Was sie umstritten macht, qualifiziert sie offenbar als Fackelträger der Revolution. Was sonst hätte der Google-Chef auf dem Cover des manager magazin im Che-Guevara-Look verloren?
Auch in anderen Bereichen geht es Schlag auf Schlag. So können wir in einem Atemzug vermelden: die vernetzte Zivilgesellschaft stürzt erstmalig in der Geschichte einen Minister (symbolisiert durch den Barcode des GuttenPlag-Wikis, s.o.), die Hacker vom Chaos Computer Club werden ARD- und ZDF-kompatibel, die Piraten-Partei zieht ins Berliner Parlament ein, Google gründet das Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin, WIRED Deutschland kommt auf den Markt, mit dem Verein Digitale Gesellschaft entsteht ein Greenpeace für die digitale Revolution, usw.
Was leisten Zeitungen in dieser wichtigen Phase?
Die digitale Revolution wird seit 20 Jahren im Rhythmus globaler Sportereignisse immer wieder neu ausgerufen: die Gründung von AOL Deutschland und Vernetzung aller Haushalte in Deutschland (1995ff), der kommerzielle Adrenalin-Rausch im Namen der New Economy (1999ff), die Einführung des Breitband-Internet “Web 2.0” als Mitmach-Massenmedium (2003ff) und dann der “Social”-Turn im Zeichen von sozialen Netzwerken (2007ff).
Im Jahre 2011 steht “totale Transparenz” auf den Fahnen der digitalen Revolution. Hat dieser Prozess in der aktuellen Phase eine neue Dimension erreicht? Ja. Das ist nicht zuletzt daran erkennbar: Die digitale Revolution kann nicht mehr als Marketing-Hype abgetan werden, denn sie markiert zwischen Konzernen wie Facebook, zivilgesellschaftlichen Organisationen wie WikiLeaks und dem Staat ein gesamtgesellschaftliches Spannungsfeld. Wir müssen sie ernster nehmen als jemals zuvor. Und wir tun dies auch.
Das Bewusstsein darüber haben wir nicht zuletzt Zeitungen zu verdanken. Nur: danken wir ihnen nicht zu schnell. Seien wir lieber kritisch. Fragen wir: Was leisten sie in dieser wichtigen Phase? Haben sie ein Auge für das große Ganze – für die Tragweite des Prozesses samt seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft? Oder sind sie mehr mit sich selbst beschäftigt?
“Niemand identifiziert sich mit dem Internet.”
Die Unruhe, die die digitale Revolution verbreitet, die Orientierungslosigkeit, die sie bedingt, die Krise, die sie einleitet – all das sind neben den genannten Zahlen und Ereignissen weitere Anzeichen für den Umbruch. Anzeichen, die in der Mitte Deutschlands spürbar sind und die wir auch aus den führenden Organen der analogen Ära herauslesen. Doch ihnen fehlt, bei genauerer Betrachtung, die Distanz zu der eigenen Sprecherperspektive.
Frank Schirrmacher, der als Sinn-Botschafter der Zeitungsmacher wahrgenommen wird, hat das Dilemma kürzlich auf den Punkt gebracht. Im Juni diesen Jahres sagte er bei seiner Antrittsrede der 8. Tübinger Mediendozentur: „Mit dem Internet identifiziert sich niemand, mit der FAZ (…) schon.“ Wir wollen nicht erst fragen, was netzaffine FAZ-Autoren wie Stefan Niggemeier, Christoph Kappes oder Constanze Kurz über diese Aussage denken. Wir wollen uns nicht mit dem Offensichtlichen aufhalten: Natürlich identifizieren sich Menschen mit dem Internet. Zusammengenommen sicherlich mehr als mit einer einzelnen Zeitung.
Frank Schirrmachers Antrittsrede der 8. Tübinger Mediendozentur
Das Internet ist ein zutiefst emotionales Medium. Selbst für gestandene Zeitungsmacher wie Alan Rusbridger: „Er liebt das Internet“. (Der Spiegel, 26.9.). Worauf es ankommt bei Schirrmachers Aussage, übrigens das dramatisch zugespitzte Schlusswort seiner Rede, ist die Entweder-Oder-Rhetorik. Sie ist so alt wie der Kampf der Zeitungen gegen das Internet.
Die Entweder-Oder-Rhetorik – das ist der Subtext, welcher der Öffentlichkeitsarbeit der Zeitungen spätestens seit den Nuller Jahren des 21. Jahrhunderts zu Grunde liegt: Old vs. New Media (etwa: Journalisten vs. Blogger), Old vs. New Economy (etwa: Springer vs. Google). Das ist freilich nicht mehr und nicht weniger als ein pubertärer Identitätsdiskurs.
50 Millionen Menschen in der kollektiven Pubertät?
Auch die Zeitungen rufen immer wieder: Wir erfinden uns neu! Und im Kleingedruckten steht: Aber wollen wir das auch? Diese Frage stellen sie sich in erster Linie selbst. Denn sie hadern mit der digitalen Revolution – spätestens seitdem sie weniger Gewinn machen. Sie wollen „dagegen halten“ (Schirrmacher). Doch sie machen ihre eigene Identitätskrise nicht transparent. Stattdessen haben sie ihre Sorgen und Ängste zu unseren Problemen gemacht. Schirrmacher sagt: „Wenn die Zeitung bedroht ist, dann sind wir’s alle“.
So fragen sie uns, mal mehr, mal weniger direkt: Gehörst du zu der guten alten Welt oder zu der schönen neuen Welt? Doch wir müssen uns nicht entscheiden. Nicht in dieser Frage zumindest. Denn wir sind schon mittendrin. Und hier, in der digitalen Revolution, geht es um Zusammenarbeit – auf allen Ebenen. Auch zwischen Journalisten und Bloggern. Merkel hat dafür nur den schwachen Begriff der „Ergänzung“ parat.
Die Eliten der analogen Ära haben das in Deutschland noch nicht erkannt. Oder: sie wollen es noch nicht wahrhaben. Aber wenn die Zeitungen auch weiterhin als Leitmedien fungieren wollen, dann müssen sie den entscheidenden affirmativen Schritt tun. Affirmation nicht im Sinne von Ja-Sagen zu allem. Sondern im Sinne des Berliner Philosophen Marcus Steinweg: Wahrhaben von allem. Und das bedeutet auch, die Momente von Unruhe, Orientierungslosigkeit und Krise beim Schopfe packen.
Was sind die wirklich wichtigen Probleme der digital vernetzten Menschen? Doch nicht was echte Freunde oder wahre Liebe im Internet-Zeitalter sind! Genauso wenig, was der richtige Umgang mit dem Netz ist, um nicht süchtig zu werden! (Niggemeier dazu hier.) Die 50 Millionen Internet-User in Deutschland durchleben derzeit keine kollektive Pubertät. Deshalb brauchen sie auch nicht die von Mathias Döpfner empfohlene „Führung“ der Zeitungen. Nein: Wir sind mitten in einer Revolution, die nicht nur die alte Führung, sondern das Prinzip Führung in Frage stellt.
Wir erfinden uns neu: Solange wir Bürger sind
Wenn das Jahrzehnt der großen Zeitung aufkommen soll, dann nur, wenn die richtigen Fragen auf den Titelseiten stehen, etwa: Wie können wir uns als Bürger in der digitalen Gesellschaft jene Rechte sichern, die bislang selbstverständlich waren?
Denn wir müssen uns klar machen: „Ähnlich wie die Bürger, das Bürgertum und die Arbeiterklasse sich Rechte vom Staat erkämpfen mussten, genau so müssen wir das als Bürger heutzutage (in der digitalen Gesellschaft) auch wieder machen.“ Das fordert Thorsten Schilling in der De:Bug, seines Zeichens der Medien-Beauftragte der Bundeszentrale für politische Bildung.
Umso genauer müssen wir hinhören, wenn uns Experten mitteilen, das demokratische Prinzip des Bürgers werde abgeschafft. Selbst oder gerade wenn es sich um gut gemeinten Alarmismus handelt. Miriam Meckel etwa, bekanntlich die Digital-Fee der Zeitungsmacher, beginnt ihre anthropologische Diagnose der digitalen Gesellschaft mit der Narziss-Episode aus der griechischen Mythologie – eine archetypische Figur abendländischer Identitätsdiskurse. Und verkündet dann: „Der berechnete Mensch kann nicht mehr Bürger sein. Er ist Produkt einer ‘Like’-Diktatur.“
Doch haben wir nicht selbst in einer Diktatur eine politische Minimal-Basis? Und somit einen Spielraum als Bürger? Die Zeitungen sollten jetzt ihren Bildungsauftrag wahrnehmen und diesen Spielraum vermessen und besetzen helfen – er ist derzeit bedeutend größer als in einer Diktatur. Sie sollten dort ansetzen, wo die Bürgerinnen und Bürger bereits aufbegehren: im diskursiven Zentrum ihrer Initiativen. Aber sie sollten auch Latenzen erkunden und neuen Bewegungen den Weg in eine breite Öffentlichkeit ebnen.
Anm. d. Red.: Dieser Text ist der zweite Text in einer Serie über die “Zeitung im Medienwandel”, der erste Text hieß Jahrzehnt der großen Zeitung: Frank Schirrmacher, Digitalisierung und der Fall der chinesischen Mauer.



 MORE WORLD
MORE WORLD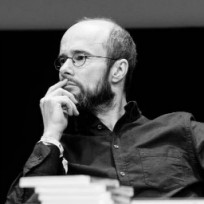

25 Kommentare zu
Die Kritik entspringt eigentlich einem Wettbewerbsdenken - du oder ich. Die analogen oder die digitalen Medien. Wie du richtig sagst, wäre eigentlich die Frage, wie man am besten kooperiert - und sich gemeinsam weiterentwickelt. Wie man das eine in das andere Medium überträgt, dort weiter entwickelt und wieder zurück überträgt. In diese Prozesse muss mehr Phantasie gesteckt werden. Im Grunde ist das Internet nämlich eine gigantische Kooperationsmaschine.
http://www.faz.net/aktuell/die-f-a-z-im-internet-uebersichtlich-meinungsstark-und-diskussionsfreudig-11447692.html
Grundversorgung: Das wären demnach Zeitungen und öffentlich-rechtlicher Rundfunk und das hatte lange Zeit auch seine Berechtigung. Allerdings: Spätestens, seit über 70 Prozent der Deutschen sich im Netz tummeln, wird es Zeit, diesen Grundversorgergedanken zu überdenken.
Das Netz tickt anders. Das Netz braucht keine Grundversorgung, weil das Netz die neue Grundversorgung ist. In der Praxis hat sich beispielsweise das Verhältnis zwischen Zeitung und Netz innerhalb weniger Jahre faktisch umgekehrt: Noch vor fünf Jahren war fast die Hälfte der Deutschen nicht im Netz. Das Netz war also die Kür, der Zusatz, wenn man so will: der Luxus, den man sich zusätzlich zu Zeitung und Rundfunk noch leistete. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Speziell jüngeres Publikum irgendwo zwischen 15 und 30, komplett mit dem Netz aufgewachsen, würde es als einen absonderlichen Gedanken empfinden, Zeitung und Rundfunk als die Grundversorgung zu verstehen.
Die Grundversorgung ist das Netz — und da geht das eigentliche Problem für die analogen Medien los. Weil das Netz anders genutzt wird. Aus dem Netz holt man sich, was man will, was man gerade braucht, man stellt sich seinen eigenen Konsum zusammen. Zumal das Netz eben auch alles bietet, es ist Zeitung, Radio, Fernseher, Spielekonsole zugleich. Das schließt nicht aus, dass man zusätzlich analoge Medien konsumiert. Nur einen Zwang, wie ihn der Begriff Grundversorgung nahelegt, den gibt es nicht mehr.
Es ist auch zunehmend weniger so, dass sich Menschen mit ihrer Zeitung oder ihrem Sender identifizieren. Wenn das Netz die Loslösung von Plattformen und Kanälen bedeutet, dann ist das gleichbedeutend mit der Loslösung von Identifikation. Zumal im Netz diejenigen, mit denen sich Nutzer inzwischen identifizieren, andere sind. Das sind Google und Apple und Amazon und Ebay, das sind YouTube, Blogs, Netzwerke. Oder aber: kleine, sehr spezifische Projekte. Über Identifikation und Grundversorgung läuft das nicht mehr. Die Zeit der Wundertüten für alle, die sich irgendwo in der Mitte von Nirgendwo bewegen, sind vorbei.
Man wird also andere Gründe für die eigene Weiterexistenz im Netz finden müssen.Von diesen Gründen gäbe es ausreichend, hochwertiger Journalismus beispielsweise wäre so ein Grund. Gute, spannende Geschichten, mehrkanalig, mobil, multimedial, interagierend erzählt, das wäre etwas. Vergesst die Grundversorgung und vergesst die Identifikation.[...]
http://www.perlentaucher.de/blog/216_deutsche_zeitungen_stehen_kaum_noch_online
Ein Witz in dieser Hinsicht ist freilich, dass viele Zeitungen gar nicht entscheiden, ob sie online sind oder nicht. Diese Entscheidung überlassen sie längst - willentlich wie der Spiegel oder netz-ignorant wie die Zeit - den Piraten.
das ist nur eine interessante Frage, die +Thierry Chervel in seinem Beitrag "Deutsche Zeitungen stehen kaum noch online" (http://www.perlentaucher.de/blog/216_deutsche_zeitungen_stehen_kaum_noch_online) stellt.
Gemeint ist das offene Netz, das Internet, im Gegensatz zu den "Walled Gardens" bzw. Gated Communities, die Facebook bietet bzw., und das ist wohl langfristig entscheidender, Apple und Amazon mit ihren Tablet-Universen (iPad und Kindle lassen grüßen).
Am Ende zieht Chervel folgendes Fazit:
"In zwanzig Jahren Internet sind die deutschen Zeitungen einen Sonderweg gegangen. Sie haben sich - mit Zwischenphasen - immer mehr vom Netz abgeschottet. Es gibt sie, abgesehen von den Epapers und Online-Archiven, praktisch wieder nur noch im Print."
Und auf Tablets - wäre zu ergänzen.
Daher fragt Chervel zukunftsweisend:
"Werden Jobs und Bezos zu den neuen Herren der Öffentlichkeit?" u.a. vorausgesetzt, man pflichtet den Zeitungen eine zentrale, ja, DIE zentrale Rolle bei der Herstellung von Öffentlichkeit bei, wie ich es in meinem Essay oben nicht ohne Vorbehalte und Fragezeichen tue.
Hier klafft also durchaus eine Lücke in der Grundversorgung. Wir müssen häufig allzu lange warten, bis sich bestimmte (meist kostenlosen) Angebote auf dem Markt etablieren können. In einem ganz anderen Zusammenhang wäre das soziale Netzwerk diaspora ein gutes Beispiel. Warten auf die Grundversorgung. Oder hier und da ein wenig mitbasteln - als Coder oder Blogger, der die Grenzen seiner Tools auslotet und aufzeigt, weiterentwickelt. Oder eben darüber philosophieren und debattieren, was sie eigentlich bieten soll. Ja: was sie eigentlich sein soll.
Denn das ist nicht ganz klar. Und nicht befriedigend, wenn wir die Grundversorgung hier aus reiner Konsumentenperspektive entwerfen: wo stille ich meinen Hunger? Immerhin sprechen wir nicht nur über Dienstleistungen. Sondern in erster Linie über Öffentlichkeit. Über öffentliche Kommunikation als Plattform/Vehikel/Katalysator des Politischen. Die Haltung/Aktivität des Einzelnen geht in diesem Zusammenhang über Konsum hinaus (nicht das Konsum unpolitisch ist). Und sie geht über das reine Bedürfnisstillen hinaus. So sollte man "Versorgung" nicht missverstehen.
Habermas vergleicht, wie zulässig oder unzulässig sei dahin gestellt, die Zeitungen und ihr "energetisches Angebot" mit Wasser, Elektrizität, etc.
Das sind Gemeingüter.
Und hier wird die Debatte doch spannend. Hier können wir die Rolle der Zeitungen und anderer, neuer Medien ernsthaft auf den Prüfstein stellen:
Denn unter Gemeingütern versteht man Güter, die von allen zu gleichen Bedingungen geteilt werden können. Die Zeitungen und auch das Internet weisen in letzter Zeit jedoch immer stärkere Anzeichen von Privatisierung auf (siehe auch +Thierry Chervel über Faz.net & Co.: http://www.perlentaucher.de/blog/216_deutsche_zeitungen_stehen_kaum_noch_online )
So selbstverständlich ist das Netz also nicht die Grundversorgung. Zeitungen freilich ebenso wenig. Insofern hat +Christoph Kappes vollkommen recht und weist auf ein weiteres Defizit hin: über verschiedenste Fragen in diesem Zusammenhang gibt es keine langfristige Sicherheit!
"@#8: du willst damit sagen: die piraterie macht es den zeitungen unmöglich sich ordentlich im netz zu verbreiten? wenn dem so ist: eine arg konservative haltung, nicht zuletzt im hinblick auf "piraterie", was ja "sharing"-kultur meint, aber auch auf das geschäftemachen im netz, das die zeitungen aus der alten welt 1:1 auf das netz übertragen wollen."
Sharing und Piraterie halte ich in der Tat nicht für synonym. Wenn Leute wie z. B. bei wikipedia kostenlos Inhalte produzieren und verteilen, ist das das eine, nämlich Sharing, würde ich sagen. Wenn Leute sich die Inhalte anderer Leute schnappen und gegen deren Willen verbreiten, um damit ihrerseits Geld zu verdienen, ist das Piraterie - im negativen Sinne.
Dazwischen liegt natürlich eine weite Grauzone, die man differenziert betrachten muss. Und die sich entwickeln muss, z. B. was die Kostenmodelle angeht. Wenn ich demnächst eine Zwangsabgabe (GEZ) zahlen muss, obwohl ich deutsche öffentlich-rechtliche Inhalte gar nicht nutze, sehe ich das nicht ein. Wenn daraus eine allgemeine Kulturflatrate würde, von der dann etwa auch die Zeitungen profitieren, ließe sich darüber reden.
Wenn Du Dein Geld mit der Produktion von Inhalten verdienen müsstest, würdest Du da womöglich auch konservativer denken.
Ich habe das auch lange so gesehen (und mittelfristig wird es so kommen), man kann aber mit diesem Gedanken allein nicht die Notwendigkeit von "Grundversorgung" durch ö-r Anstalten und ggf Zeitungen bestreiten:
1. Das Internet ist zwar stark verbreitet, von der Nutzung her ist es aber für tagesaktuelles Geschehen immer noch weit hinter TV und Print, siehe
AWA 2011: Internet liegt mit 26% gleichauf mit Radio und weit abgeschlagen von TV (48%) (-> Folie "Die Bedeutung der verschiedenen Medien für die tagesaktuelle Information", (http://www.awa-online.de/praesentationen/awa11_politik_maerkte.pdf ca. Ende des erstes Drittels des pdfs),
2. Begründung für die Existenz der ör-Medien war die Kraft der Bilder bei Massenmedien, diese Argument müsste beim Internet erst recht gelten, da hier noch Social-Media-Verstärker dazukommen
3. Die institutionelle Unabhängigkeit der ö-r Anstalten ist strukturell besser abgesichert als bei Privatanbietern (es sei denn, er ist eine Stiftung oder sonstwie verselbständigt, was man übrigens über die F.A.Z. wissen sollte.)
4. Über solche Fragen muss langfristig Sicherheit bestehen, das ist aber nicht der Fall.
Das Steinweg'sche "Wahrhaben von Allem" klingt gut. Wo schreibt er das?
Das Auffinden einer entsprechenden Quelle ist daher nicht einfach. Sicher ist, dass Steinweg diesen Begriff von Affirmation, wie so vieles in seinem Denken, im Zuge einer Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Kunst und Philosophie entwickelt hat.
Einer seiner jüngsten Vorträge mit dem Titel "Chaosbejahung" (August diesen Jahres gehalten) wurde mit ein paar Sätzen angekündigt, die weiterhelfen dürften in diesem Zusammenhang: "Affirmation ist nicht Gutheissung des Bestehenden, Affirmation meint Bejahung der Realität in ihrem Inkommensurabilitätswert, Öffnung auf die Welt in ihrer Komplexität. Deshalb gehört eine gewisse Widerständigkeit zu solcher Bejahung, Resistenz gegenüber einem Realitätsschema, das Inkommensurabilität/Komplexität exkludiert. Die Welt der etablierten Kommensurabilitäten verdankt ihre, deshalb scheinhafte, Konsistenz dieser Exklusion."
In seinem Buch "Politik des Subjekts" (2009) lassen sich ebenfalls einige Zeilen zu diesem Begriff finden. Er spricht hier u.a. von "affirmativer Resistenz im Hier-und-Jetzt-Universum" (S.68). Sagt aber auch: "Bejahen heißt nicht gutheißen." (S.86). Und noch aufschlussreicher:
"Nie geht es darum, für oder gegen etwas zu sein. Nie primär. [Sondern um][...] die Weigerung, [den] Realitätskontakt durch Wertungen zu neutralisieren. Es ist klar, dass diese Weigerung einen gewissen Mut verlangt. Denn es ist bequemer, seinen Wirklichkeitsbezug mittels moralischer Wertungen zu dämpfen, als sich auf der Höhe von Widersprüchen und Konflikten zu artikulieren, die sich ihrer überhasteten Neutralisierung sperren." (S.87)