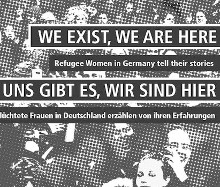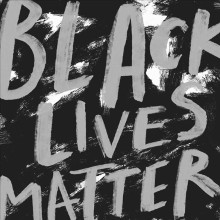Worte, so geschmeidig wie Seide, traenenschwangere Abschiede und Liebesgestaendnisse gehaucht fuer die Ewigkeit. Willkommen in der Welt von Angel Deverell. Wir befinden uns im England des Fin de Siècle und die junge Angel hat nur einen Traum: den dunklen Gassen ihrer Heimatstadt entfliehen und eine beruehmte Schriftstellerin werden. Emsig schreibt sie sich in ihrer Dachkammer an einem Roman die Finger wund. Spaeter erst wird klar: Was Angel da schreibt, ist ziemlicher Kitsch. Deshalb ueberrascht es anfangs nicht so sehr, dass sie bald einen Verleger findet und mit ihrem Erstling Lady Irania
unglaublich grossen Erfolg hat. Die Londoner High Society liebt sie, reiche Adlige verschlingen ihre Buecher. Rasch avanciert Angel zum Popstar.
Diese Geschichte wird in Francois Ozons neuem Werk – dem Abschlussfilm der 57. Berlinale – mit soviel Pomp, Samt und Seide erzaehlt, dass der Zuschauer sich manchmal fragt, ob es wirklich stimmt, dass das Dokumentarische auf der diesjaehrigen Berlinale so stilbildend gewesen sein soll. Wie auch immer: Angel scheint so gar nicht ins Heute zu passen. Sie ist eine Traeumerin, die Sonnenuntergaenge und Gondelfahrten durch Venedig liebt. Sie passt nicht mal so richtig in das England des 19. Jahrhunderts. Das Unzeitgemaesse
des Films wird noch verstaerkt durch seine verstaubt wirkende Oberflaeche, man hat das Gefuehl, einen Film aus den 1930er Jahren zu sehen – bloss in Farbe. Die Montagetechnik, die Ozon an einigen Stellen anwendet, unterstreicht diesen Eindruck. Wenn Angel beispielsweise auf einer Kutsche durch London reitet, wirkt sie wie hineingebeamt in das Strassenbild.
Schoener kanns nicht kommen? Nun, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Auch schon die Vorlage fuer den Film arbeitete sich daran ab: Der Roman der englischen Schriftstellerin Elizabeth Taylor (!), erschienen im Jahre 1957, erzaehlte das Leben der Marie Corelli. Diese Figur hiess im wirklichen Leben Mary Mackay und war um 1900 in England genauso bekannt wie Queen Victoria. Sie schrieb so etwas wie literarische Soap Operas und die Leute waren suechtig danach. Corelli gilt als der erste richtige Star des Literaturbetriebs. Aber heute kennt sie niemand mehr. Vermutlich war sie ihrer Zeit einfach nur voraus. Um mehr als einhundert Jahre vielleicht.



 MORE WORLD
MORE WORLD