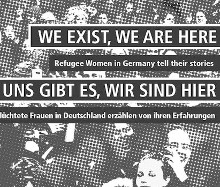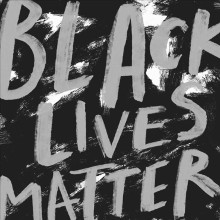Wenn ein Mensch die Mitte seines Lebens erreicht, kommt es haeufig dazu, dass er anfaengt dieses kritisch zu ueberdenken und gefuehlsmaessig infrage zu stellen. Manchmal weitet sich das Ganze zu einer regelrechten Identitaetskrise aus. In der modernen Industriegesellschaft ist fuer diese Lebensphase der Begriff Midlife-Crisis gepraegt worden. Wenn die Europaeische Union ein Mensch aus Fleisch und Blut waere und man ihren Geburtstag irgendwann nach dem zweiten Weltkrieg datieren wuerde, dann erreichte sie diese Phase vermutlich genau jetzt. Und es scheint in der Tat so zu sein, dass die EU gerade in einer handfesten Identitaetskrise steckt. Jedenfalls ergab sich dieses Bild, wenn man letzten Sonntag die Abschlusstagung der Berliner Konferenz in der Akademie der Kuenste besuchte. Dort trafen Politiker und Intellektuelle aufeinander um >Europa eine Seele zu geben<. Doch genau mit diesem Anspruch fangen die Probleme auch schon an: Wie soll diese Seele eigentlich aussehen? Was macht Europa und die europaeische Union aus? Was ist die Identitaet der Europaeischen Union? Sprache funktioniert in diesem Zusammenhang immer ganz gut als identitaetsstiftendes Moment, aber eine gemeinsame Sprache gibt es in der EU nicht. Dann gibt es Religion: noch komplizierter. Geografische Grenzen? Wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Gemeinsame Werte? Auch keine wirklich gute Idee. Ich schlage vor: Pluralitaet. Das, was wir in der EU alle gemeinsam haben, ist, dass wir alle verschieden sind. Egal ob Deutsch-Tuerke oder Italo-Vietnamese – du kannst Europaeer sein. So stell ich mir mein Europa vor. Midlife-Crisis hin oder her.
- Entlang der X-Achse: Führen uns nervöse Kurvenlandschaften zurück zur Norm…
- Schöne neue Logistik-Welt? Warum Arbeiter*innen in Erzählungen über Liefer…
- Stadt und Pandemie: Gibt es Arbeit im vermeintlich vollautomatisierten Silico…
- Der dritte Weg: Warum eine differenzierte Kritik der "Corona-Maßnahmen" gera…
- Schreien, Weinen, leises Lachen: Acht Mütter über ihr Leben in der Covid-19…
- Stadt und Pandemie: Silicon-Valley-Urbanismus, kritische Infrastruktur und "S…
- Unsichtbar gemachte Entscheider*innen: Content-Moderation, KI und Arbeitskäm…
- Kritisieren, Träumen und Gestalten: Wie gegen den KI-Kapitalismus ankämpfen…
- Die "Caring Crowd": Wenn hinter dem Label KI eigentlich digitale Heimarbeit …
- Verpasst und verpatzt: Was 1990 in der BRD und Europa hätte passieren könne…
-
Auch Du bist Europa
-
In Neukoelln dampft’s an allen Ecken
Am Mittwoch war ich beim Quartiersmanagement, gleich im Erdgeschoss unseres Hauses. Ich wollte meinem Aerger Luft machen. Der Aerger war eigentlich schon Wut. Ich bin nicht leicht aus der Fassung zu bringen, dies entspricht nicht meinem Naturell. Aber auf Hundescheisse reagiere ich allergisch. Dreimal bin ich seit meinem Einzug Anfang November schon reingetreten und bis zum Monatsende sind es noch einige Tage. Die Frau vom Quartiersmanagement empfing mich mit warmen Worten.
Sie sind neu hier? Herzlich willkommen in unserem Haus!
Na prima, dachte ich, jetzt kann ich nicht einmal die Zicke raushaengen lassen. Mit ihrem eigenen Koeter geht sie sicherlich nicht in Neukoelln – Berlins neuem In-Viertel – Gassi. Sie gehoert zu den Guten. Eine Stelle beim Quartiersmanagement ist der Traum eines jeden Stadtsoziologen. Menschen zusammenzufuehren, Buerger zu ermutigen, Verantwortung fuer ihren Kiez zu uebernehmen. Ein schwieriges Geschaeft, vielleicht ein Kampf gegen Windmuehlen. Die Frau gab sich dann auch gelassen. Das Thema sei nicht neu, es haetten sich schon einige wehrhafte Hausbesitzer und Anwohner zusammengeschlossen, um Aufklaerung in Sachen Hundekot zu betreiben.Wollen Sie sich auch engagieren?
Dankend lehnte ich ab.Ich recherchiere in dieser Sache, ich moechte darueber berichten.
Ihre Miene verfinsterte sich schlagartig. Aufgeregt meinte sie:Schreiben Sie bloss nicht, dass Neukoelln an Hundekacke erstickt wir tun so viel fuer die Aufwertung des Stadtteils…
Als Beweis drueckte sie mir ein gelbes Faltblatt in die Hand.Hundehalter und Menschen ohne Hunde koennen friedlich miteinander leben, wenn sie ihre Beduerfnisse gegenseitig respektieren und aufeinander Ruecksicht nehmen.
Versoehnlicher gestimmt, beschloss ich, das Thema fallen zu lassen. Zurueck im Hausflur stieg mir einmal mehr dieser bestialische Gestank in die Nase. Willkommen zu Hause! SCHEISSE. -
Die Eloquenz leerer Sprechblasen
Was haben Mifanwy Kaiser, Sabrina, 19, aus Vorarlbgerg, eine Initiative gegen Tierleid sowie ein Dolmetscher- und Uebersetzungsbuero aus Muenster gemeinsam? Werter Leser, Sie waren eben nur einen Mausklick entfernt von der Antwort. Die da lautet: Sie duenken sich sprachlos. Doch sie sind nicht allein: Hollywood liess in >Speechless< die Protagonisten Reden fuer konkurrierende Politiker schreiben, eine Pop-Band rockt seit sechs Jahren
sprachlos
durch die Republik (>Musik, die Baende spricht<) und 3Sat weiss zu berichten: Mehr als zehn Prozent der Kinder sind sprachgestoert. Zeit fuer eine Zigarette, deutet mir Peter Glaser in seiner Email von vorgestern an. Der Mann, der grenzuebergreifend fuer seine Texte geschaetzt wird, schickte mir ein Bild: ddr_zigaretten.jpg. Orangefarbene Streifen, drei an der Zahl wie bei Adidas, horizontal plaziert, von einem braunen Quadrat, das ein organenes Z einfasst, wie von einer Guertelschnalle ueberlagert. Drunter, und Sie merken, dass das Bild, das ich beschreibe nur eine Zigarettenschachtel sein kann, drunter ist da ein blaues Rechteck durchzogen von einer braunen Linie, die sich anschickt und wendet wie eine stolzierende Irrgartenmauer. In der untersten Zeile trockene Info zum Content: 20 Stueck HSL 1873360 EVP 2,40 M. In der Mitte des blauen Rechtsecks, umgeben von der braunenIrrgartenmauer
prangt es in weisser Schrift: SPRACHLOS. Aber warum beschreibe ich das Ganze so umstaendlich, wenn ich auch einfach ein im Netz archiviertes Bild sprechen lassen koennte? Nun daemmert es auch mir: Das Bild, das Guru Glaser mir schickte, es koennte gar eine Anspielung auf unser McDeutsch-Projekt sein. Ohne Worte sozusagen. -
Charlotte Chronicles.17
Wenn man sich in einer fremden Sprache unterhaelt, ist man zwangslaeufig den damit einhergehenden Limitierungen seiner Ausdrucksweise unterworfen. Einer der bestimmenden Faktoren fuer die Moeglichkeiten, sich in jedweder Sprache (die eigene Muttersprache eingeschlossen) auszudruecken, ist der Wortschatz. Ich habe, ebenso wie einige andere Auslaender hier, zur Erweiterung meines englischen Wortschatzes, einen Dienst abonniert, durch den ich taeglich eine E-Mail mit der Erlaeuterung eines nicht so gebraeuchlichen englischen Wortes erhalte. Doch auch Amerikanern wird eine ueber das Alltagsvokabular hinausgehende Beherrschung ihrer Sprache empfohlen, wenn sie als Absolventen einer >Ivy League<-Universitaet durchgehen wollen. In normalen Alltagsgespraechen kommt man hingegen mit einem erstaunlich geringen aktiv verwendeten Wortschatz zurecht. Schaetzungen fuer die deutsche Sprache gehen davon aus, dass ohne Einbeziehung eines spezifischen themenbezogenen Vokabulars 400 bis 800 Woerter fuer die meisten Gespraeche ausreichen und neuere Kommunikationsformen wie Chats oder SMS sogar mit 100 bis 200 Woertern auskommen. Um sich als Redner eloquent auszudruecken ist allerdings ein Wortschatz von 4.000 bis 10.000 Woertern notwendig. Aehnliches spiegelt sich auch in der von der Presse verwendeten Sprache wider: Sie bewegt sich zwischen 400 (Boulevard) und 5.000 (Feuilleton) verschiedenen Woertern. Zum Vergleich: Im Duden werden etwa 120.000 Stichwoerter aufgefuehrt.
Die Universitaet Leipzig betreibt ein >Wortschatz-Projekt<, bei dem fuer diverse Sprachen neben der Bedeutung eines Wortes auch seine Verwendung untersucht wird. So werden neben Synonymen auch typische linke oder rechte >Nachbarn< des entsprechenden Wortes angegeben. Beim Suchbegriff >Meckern< erfaehrt man, dass ein haeufiger >rechter Nachbar< in der deutschen Sprache das Wort >Benzinpreis< ist. Damit befinden wir uns schon wieder im prallen Leben und haben gleich zwei der 400 Woerter, die zum Verstaendnis der BILD-Zeitung notwendig sind, gefunden. -
In Vergessenheit geraten
Ich will mich mal so ein bisschen an meiner Biographie entlang hangeln: In Karlsbad geboren, als 3jaehriger nach Bayern gekommen – da hat man schon gleich mit drei Sprachen zu tun. Hochdeutsch, Tschechisch, Bairisch. Tschechisch konnte ich nur ein paar Brocken ueber meine Eltern (und auch nicht die vornehmsten Woerter), Bairisch lernte ich wohl oder uebel, und dann gerne fuer mein Umfeld, und Hochdeutsch mit bairischem Akzent war die Ueberlebenssprache. Dann kamen im Humanistischen Gymnasium die toten Sprachen hinzu, und schliesslich zum obligatorischen Englisch ein reichhaltiges Angebot an Wahlfach-Sprachen (Italienisch, Franzoesisch, Russisch), die ich anlernte (und nie auslernte). Mit den Sprachen nimmt man ja auch mehr oder weniger von der Kultur eines Sprachraums mit. weiterlesen »
-
Deutsche und Fremde
Nilufer Goele, die beruehmte tuerkische Soziologin mit Sitz in Paris, hat lange, wallende Haare von einem gefaehrlich-strahlendem Rot. Als sie am Sonntag auf dem Podium der Berliner Konferenz sitzt, wird ihre Haarpracht von einem Paar Kopfhoerer zurueckgehalten. Denn Nilufer Goele spricht zwar Tuerkisch, Arabisch, Franzoesisch und Englisch, aber kein Deutsch. Sie braucht eine Simultanuebersetzung. Fuer diesen Umstand entschuldigt sie sich bei Ihrem Publikum als allererstes: >Ich muss mich wirklich dafuer entschuldigen, dass ich Sie hier, auf dieser europaeischen Konferenz nicht auf Deutsch ansprechen kann.< Wie die meisten Menschen, die sich mit philosophischen Themen beschaeftigen, verstehe sie zwar ein bisschen Deutsch, aber ueber die Lippen kaeme es ihr nicht. In ihrem Vortrag ueber den Islam in Europa weitet Sie die Thematik des Nicht-Deutsch-Koennens noch aus. Anekdotisch erzaehlt sie, was ihr vor einigen Jahren in Berlin passiert ist: Damals sprach sie ein tuerkischer Verkaeufer auf dem Markt an. Die beiden kamen ins Gespraech ueber dies und das, Gott und die Welt. Sie sprachen Tuerkisch miteinander. Als der Mann die Unterhaltung auf Deutsch fortsetzen wollte, war er empoert ueber die Unfaehigkeit seines Gegenuebers mit ihm weiter zu kommunizieren. >Dann bist Du also eine Fremde< meinte er zu ihr. Eine Tuerkin in Deutschland, die kein Deutsch kann? Das erschien dem Verkaeufer paradox. Doch wie haette dieser Mann reagiert, wenn er sie in Istanbul auf dem Markt getroffen haette, oder in Paris? Waere dann er der >Fremde<, weil er kein Franzoesisch spricht? Warum verwendet er ueberhaupt dieses krass ausgrenzende Wort >Fremde<? Vielleicht weil er aehnliche Situationen mit Deutschen schon erlebt hat? Situationen, in denen er, der Tuerke, der >Fremde< war, obwohl er Deutsch konnte? Am Ende des Vortrags beschaeftigen mich diese Fragen mehr, als das, was Goele sonst noch zu sagen hatte.
-
Deutsch im Rotlicht
In Deutschland hat die Ueberfremdungsangst eine neue Farbe angenommen, zumindest wenn man im uebertragenen Sinne sagen wuerde, dass die kollektive Psyche entsprechend dem Alarmsystem der Homeland Security je nach Aggregatzustand ihre Farben wechselt. Derzeit ist das kollektive Bewusstsein ein Rotlichtsektor und orientiert sich bei Kompensierungsversuchen dieses Zustands an den USA. Dort wird die Ueberfremdungsangst auf der Sprachebene verhandelt; der eloquenteste Homeland-Hueter gibt zu verstehen:
There is no Americano Dream. There is only the American dream created by an Anglo-Protestant society. Mexican-Americans will share that dream and in that society only if they dream in English.
Und so projiziert auch Deutschland seine Schwierigkeiten mitPhaenomenen
wie der Migration von Daten, Kapital und Menschen auf die deutsche Sprache. Stimmt alles mit der Nation? Hat der Staat gutduenken angesichts der Globalisierung? Diese Fragen stellt man nun lieber wie folgt: Sprechen die Buerger der BRD ueberhaupt noch die richtige Sprache oder sind sie laengst verloren gegangen an ein Schattenregime, dasunsere
Gesellschaft zu unterwandern droht? Nach dem Schulen und Kindergaerten von dieser Frage beschattet worden sind, sowie auch Fitnessstudios, Kneipen und Saunas, bleibt nur noch eines: der Rotlichtsektor. Ich wette, dass man dort richtiggehend fuendig wird, was den Missbrauch, die Verlotterung und die Ueberfremdung der deutschen Sprache anbetrifft. Immerhin wissen Farbforscher schon jetzt: Rot ist die Farbe des Todes. An dieErotik der Sprache
(Roland Barthes) denkt dabei kaum einer. -
Flexibilisieren und festnageln
Am 14. Januar 1989 wurde die langlebigste Quizsendung im deutschen Fernsehen eingestellt:
Was bin ich?
Rund fuenfzig Jahre lang durfte ein vierkoepfiges Rateteam Fragen stellen wie:Sind Sie mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschaeftigt?
,Koennte auch ich zu Ihnen kommen?
,Machen Sie Menschen gluecklich/zufrieden?
. Kandidaten, deren Beruf am Ende unerraten blieb, gingen mit einem Schweinchen Geld nach Hause. Heute gehoert dieses Ritual der Vergangenheit an, die Fragestellung offenbar auch. So informiert das Wissensportal von Bertelsmann: Die Zeiten, als man sich ausschliesslich ueber den Beruf definierte, sind lange vorbei. Gefragt seien die so genannten Soft-Skills. Da sei es gut zu wissen, wer man ist, was man darstellt, wie man wirkt. Folglich laute die neue Fragestellung: Wer bin ich? Die Identitaetssuche wird von weniger introspektiven Appellen begleitet: Flexibilisiere Dich! Werde biegsam! Passe Dich sich staendig veraendernden Strukturen an! Erfinde Dich immer wieder neu! Kurz: Wer sich selbst kennenlernen will, legt sich besser nicht so genau fest. Gleichzeitig – und das ist wohl das zentrale Paradoxon dieser Zeit – wird allenthalben vehement das Gegenteil eingefordert: Man soll sich gefaelligst einordnen lassen, Farbe bekennen, ein Label tragen. Symptomatisch in diesem Zusammenhang: das Modell Multitalent. Welche Berufsoptionen hat jemand inunserer
Gesellschaft, der vieles wirklich gut kann und auch wirklich gerne macht? Keine. Menschen mit diesem Profil sind nicht gefragt. Koennen nur schwer Fuss fassen. Selbst im Starkostuem haben sie ein schweres Leben. Da hilft auch kein Test weiter. Und die ganzen neumodischen Berufenamen lenken von dem Umstand nur ab, dass wir in einer merkwuerdigen Zeit leben: Identitaet, Berufung, Geldverdienen – Dinge, deren Zusammenhang besser nicht so genau hinterfragt werden sollte. Beschraenken sollte man sich lieber auf die Frage: Wer bin ich? -
Auf dem Glatteis der Vernunft
Seit 1991 gibt es in Berlin ein Institut, dessen Team sich tagtaeglich auf irrationales Glatteis begibt: das Erratik-Institut. Verirrung, Fehler, Irrtum, Luege, Taeuschung – all das findet hier dankbare Aufnahme, begruendet es doch die so genannte
vagabundierende Wissenschaft
der Erratik. Nichts in der Welt geschieht ohne Bedeutung, und alles ist bedeutungslos. So sind typische Forschungsprojekte beispielsweise dieerratische Architekturkritik
, die Hubschrauberforschung oder dieMaterialermuedung
– wo auch immer das uns hinfuehren mag, originell ist’s in jedem Falle. Gruender des Instituts ist der in Kapstadt geborene Heinrich Dubel, der als Berliner Kuenstler und Autor des im Maas Verlag erschienenen BuchesHelicopter Hysterie Zwo
bekannt ist. -
Die Kunst, den Faden zu verlieren
Morgens halb zehn in Deutschland. Genauer gesagt: Morgens halb zehn in Eberswalde. Ich bin hier, um an einem Seminar fuer Kulturschaffende teilzunehmen. Da ich selbst aus einer Kleinstadt komme, sehe ich mich mit den noetigen Hinterland-Skills ausgeruestet, um in Eberswalde zu ueberleben. Doch Eberswalde ist viel groesser als erwartet und der Marktplatz (mein Endziel) ist nicht bloss einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt, wie in meiner Heimatstadt. Ich muss mich also nach dem Weg erkundigen. Ein Graus. Nicht nur, weil man sich so in der Provinz sofort als Fremdling outet, sondern auch, weil es, wie schon erwaehnt, halb zehn ist. Um diese Uhrzeit ist vornehmlich eine Bevoelkerungsschicht in der Stadt unterwegs: Renter. In der Naehe der Bahnhofsstrasse, die hier Eisenbahnstrasse heisst, entdecke ich einen aelteren Herren, der ganz nett aussieht. >Wo gehts n hier in die Innenstadt?< frage ich ihn. Er laechtelt mich an und sagt laut: >Hee?< Ich wiederhole meine Frage lauter. Er nickt verstaendnisvoll und milde: >Na ja, wissen sie, ich komme eigentlich nicht von hier. Also seit zwanzig Jahren wohn ich nun schon in Eberswalde, damals neunzehnhundertbarundziebzig…< Ich hoere ungefaehr zehn Minuten lang geduldig zu. Warum sollte er einfach antworten, wenn er auch eine Geschichte erzaehlen kann? Ich muss an meinen Zweitlieblingsschriftsteller Sten Nadolny denken, der auch schon meinte: >Verliere den Faden und du gewinnst die Welt.< Ich entferne mich langsam und unauffaellig und erspaehe den naechsten Rentner, der mir vielleicht weiterhelfen kann. >Entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Marktplatz?< frage ich, gleich in der richtigen Lautstaerke. >Meinen Sie das Einkaufszentrum? Einfach immer den Strippen nach!< ist seine Antwort. Was ist denn mit dem los? Spinnen hier alle? Spricht hier keiner Deutsch? Vielleicht redet der alte Herr ja von irgendeiner Verschwoerungstheorie, laut der wir alle nur Marionetten sind, die an Strippen haengen oder so. Dann faellt bei mir der Groschen: Die Busse fahren hier an Oberleitungen, so wie andernorts die Strassenbahnen. Und da die Busse alle den Marktplatz passieren, muss ich nur den >Strippen< folgen und komme irgendwann zwangslaeufig in die Innenstadt! Wer kann hier eigentlich kein Deutsch? Vielleicht gehen die Alten ja ganz anders mit der Sprache um. Sie nehmen sich die Zeit, auszuschweifen oder in Raetseln zu sprechen. Koennte nur unguenstig sein, wenn man zum Beispiel danach fragt, wo der naechste Feuerloescher steht.
-
Charlotte Chronicles.16
In meiner Firma hier in den USA werden kostenlose Deutschkurse fuer Mitarbeiter angeboten und nach den ersten Unterrichtsstunden teilten mir einige meiner Kollegen mit, dass Deutsch doch eine sehr harte Sprache sei, bei der fast die Stimmbaender ruiniert wuerden. Ich kann diese Ansicht bis zu einem gewissen Grad teilen, aber ganz so extrem, wie sie es formulierten, sehe ich es dann doch nicht. Von daher bat ich einen der Amerikaner, mir einmal einen Beispielsatz zu nennen und ich muss gestehen, dass nach dem mir entgegengeschleuderten >Ick spraecke Duitsch!< wirklich beinahe meine Trommelfelle bluteten. Es daemmerte mir, dass viele Deutschanfaenger, die spezifisch deutschen Laute, wie das >ch<, noch haerter ausprechen, als es Deutsche ohnehin tun und damit das (Vor)urteil ueber die >harte Sprache< bestaetigt sehen. Daraufhin beschloss ich, herauszufinden welche deutschen Sprachreferenzen man als normaler Amerikaner beim Heranwachsen mitbekommt und landete natuerlich unweigerlich beim Fernsehen. Zum einen wurden deutschen Schauspielern bis vor etwa 20 Jahren in Hollywoodfilmen nur Rollen als Nazis, Soldaten oder James-Bond-Antagonisten zugestanden, weshalb die meisten Amerikaner Ausdruecke wie >Stillgestanden<, >Haende hoch< oder ein gebruelltes >Ordnung muss sein< beherrschen. Deutsche Originalquellen tauchen fast ausschliesslich auf dem >History Channel< auf, der wegen des riesigen Programmanteils an Zweiter-Weltkriegs-Dokumentationen gelegentlich auch >The Hitler Channel< genannt wird und ebenfalls keine weichen Satzmelodien liefert. Nachdem klar war, welche sprachlichen Vorbilder die meisten Amerikaner haben, gab ich es auf, diesen Punkt entkraeften zu wollen und widmete mich lieber ihrem zweiten Kritikpunkt: Der komplizierten Grammatik, bei der man waehrend der unendlich verschachtelten Saetze die meiste Zeit nicht wisse, was denn eigentlich passiert, bis am Ende schliesslich das erloesende Verb komme. Ich erklaerte ihnen also, dass die deutsche Grammatik wie ein guter Krimi sei. Dort entfaltet sich auch ueber den ganzen Roman ein ungeklaertes Verbrechen und wenn am Ende die Aufloesung erfolgt, breitet sich die ganze wunderbare Konstruktion des Kriminalfalles vor dem Leser aus. Ob ich sie damit restlos von der Schoenheit deutscher Grammatikkonstruktionen ueberzeugen konnte, bezweifle ich nach ihrem kopfschuettelnden Abgang allerdings
-
Eine Frage des Bodens
Gemeinsam mit meiner Frau Alice Atieno und unseren vier Kindern lebe ich am Rand von Nairobi in einem Ort namens Kahawa Sukari. Es ist ein grosses Stueck Land, das sich die Menschen von der Savanne zurueckerobert haben. Mittlerweile leben hier ueber 20.000 Menschen, darunter viele Beamte aber auch viele Arme. Letztere hausen in Slumsiedlungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. weiterlesen »



 MORE WORLD
MORE WORLD