Die Polit-Seifenoper rund um Christian Wulff scheint ein Ende gefunden zu haben. Am gestrigen Tag erklärte der Bundespräsident seinen Rücktritt. Die Prioritäten jener Massenmedien, die Wulffs Niedergang begleitet haben, wirken auch in diesem denkwürdigen Moment irgendwie verkehrt: Lohnt es sich wirklich, soviel Aufmerksamkeit auf diese Personalie zu verwenden, wo doch derzeit ganz Europa lichterloh brennt? Berliner Gazette-Herausgeber Krystian Woznicki kommentiert.
*
Als Bundespräsident Wulff gestern um 11 Uhr vor die Mikrofone trat um eine Erklärung abzugeben, waren die Medienvertreter wie gewohnt zur Stelle. „Rücktritt erwartet“ hatten einige Nachrichtenportale kurz zuvor getextet und bereits die ersten Worte Wulffs ließen keinen Zweifel daran, dass er sich eben dazu durchgerungen hatte: „Gerne habe ich die Wahl zum Bundespräsidenten angenommen.“ (YouTube) Worte, die man beim Antritt oder beim Abgang spricht.
Spiegel Online sendete die Erklärung als Live Video. Auch auf ARD.de war sie zu sehen, doch dort war der Stream überlastet. Noch während der rund viereinhalb minütigen Mitteilung erschienen auf Spiegel Online und Bild.de die „Eilmeldungen“ vom Rücktritt. Zeit Online begnügte sich mit einer statischen Live Ticker-Zeile, farbig abgesetzt. Der Blick auf Guardian.co.uk wiederum bestätigte eine naheliegende Annahme: international ist dieser Rücktritt eine kleine Nummer, die wichtige News Site aus Großbritannien machte aus diesem Vorgang keine Breaking News.
Causa Wulff im europäischen Kontext
Erst im Laufe des Tages erschien auf Guardian.co.uk ein Bericht über den „Godparent of 77,000“ – eine Mischung aus Nachruf und Zusammenfassung der wichtigsten Fakten. Überraschend ist daran allenfalls, dass der Artikel auf der Startseite in einer Übersicht auftauchte, die nicht weitere Texte zum Thema Wulff aufführt, sondern zum Thema Europakrise: ein Beitrag über Spanien, vier Beiträge über Griechenland, darunter eine Kolumne von John Holloway, die mit den Worten „We are all Greeks.“ endet und zwei Texte über Deutschland: der eine spekuliert über die Vorteile, die Merkel aus dem Wulff-Rücktritt ziehen könnte (Wulff’s demise good for Merkel); der andere sinniert darüber, welche Konsequenzen die innere Spaltung Deutschlands (German schism) für das 130 Milliarden-Rettungspaket haben könnte.
Die Meldungen über Wulffs Rücktritt in diesem Kontext zu sehen, bestätigt die Annahme, dass die Causa Wulff auf der internationalen Bühne weitgehend irrelevant ist. Als eine Meldung unter vielen hat sie vor allem deshalb Nachrichtenwert, weil ihr Auswirkungen auf die Machtspitze angedichtet werden können: die Kanzlerin, deren Europakrisenmanagement allenthalben Beachtung findet. Wenn hingegen in deutschsprachigen Medien die Verbindung zur Kanzlerin untersucht wird, dann nicht im Hinblick auf die Europapolitik, sondern im Hinblick auf eine mögliche Staatskrise. Schmoren wir im eigenen Saft?
Dass die Causa Wulff wenig Bedeutung hat, daran hatten übrigens auch Kritiker hierzulande appelliert, als die massenmediale Beschäftigung mit dem Fall zu einem Selbstläufer zu werden drohte. Warum sollten wir uns in Deutschland über Wulff den Kopf zerbrechen, wenn es viel wichtigere Probleme gibt? Warum sollten die durchaus besorgniserregenden Standards einer Symbolfigur so viel wichtiger sein als die reißenden Bande der internationalen Gemeinschaft? Während Wulff sich an sein Amt klammerte, klammerte sich die Öffentlichkeit in Deutschland an ein buchstäbliches Luxus-Problem: in Europa tobt ein gewaltiger Sturm, doch wir widmen uns lieber den Affären einer politisch hohlen Symbolfigur.
Nicht Themen, sondern Namen
Günther Jauchs Sondersendung am gestrigen Abend bestätigte diesen Trend auf eigentümliche Weise. Es hieß beispielsweise, ein Bundespräsident habe nicht Europapolitik zu machen, könne entsprechend nicht die Europakrise bewältigen helfen, derartiges Tagesgeschäft sei nun mal nicht sein Bier. Vielmehr habe er zukunftsweisende Fragen zu bearbeiten und entsprechende Leitlinien für die Bundesrepublik zu entwerfen. Kurz: große Themen, Weitblick, Zukunft. Wenngleich dieser Anspruch weitgehend unwidersprochen im Raum stehen blieb, drehte sich die Diskussionsrunde fortan weniger um große Themen und die Zukunft und auch nicht um die Frage, ob und wie man all das als Bundespräsident bewältigen kann. Nein: es ging um Namen, frei nach dem Motto „Deutschland sucht den Super-Bundespräsidenten“ – selbst wenn die geladene Claudia Roth dies nicht wahrhaben wollte.
Schon vor Jauchs Sondersendung hatten einige Online-Medien ihren Fokus in der Wulff-Berichterstattung modifiziert. Es ging nicht mehr um das Wie und Warum des Rücktritts. Sondern um die Frage: Wer wird es künftig machen? Zeit Online etwa stellte Neun Kandidaten für Bellevue vor. Ganz offensichtlich war der Trendsurfer Jauch darauf eingestiegen. Er offenbarte allerdings nicht nur einen Sinn für die trending topics. Sondern er bestätigte auch, dass politische Themen in Deutschland kaum mehr jenseits des Bezugsrahmens einer Einzelperson breit diskutiert werden können. In Anlehnung an Felix Stalder ließe sich sagen: Griechenland ist zu groß und zu weit weg. Schlimmer noch ist es mit Europa: es ist zu groß und deshalb zu weit weg. Wulff hingegen ist klein und greifbar. Aber auch relevant? Das scheint in diesem Zusammenhang sekundär. Und das sollte uns zu denken geben.
Die Diskussionen um Wulff – mögen sie ernsthafte Mängel eines Politikers zu Tage gefördert haben – konnten nicht bewerkstelligen, dass am Beispiel dieser Figur die wirklich dringenden Fragen unserer Zeit verhandelt werden. Hier und da gab es Lichtblicke, etwa als Anke Domscheit-Berg bei Günter Jauch für radikale Transparenz und die Tugenden der Internet-Gesellschaft plädierte oder als es an anderer Stelle darum ging, welche Gemengelage Politik und Wirtschaft heutzutage bilden. Leider nur wurden diese Themen in der gesamtgesellschaftlichen Debatte selten wirklich vertieft.
Anm.d.Red.: Das Bild oben ist ein Standbild aus dem Live-Video der gestrigen Erklärung; das Bild darunter ist ein Screenshot von Bild.de



 MORE WORLD
MORE WORLD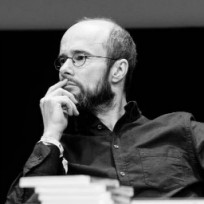

16 Kommentare zu
http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/zur_strecke_gebracht_1.15125869.html
Aber meines Erachtens rechtfertigt das nicht, dieses Thema wochenlang auf fast allen Titelseiten, Hauptaufmachern, Kommentaren breitzutreten, während gleichzeitig die EU in ihrer schwersten Krise ist. Milliarden von Steuergeldern werden neu ausgegeben, die Verschuldung der Länder Europas nimmt weiterhin zu statt ab. Verglichen mit diesem Thema (und vielen anderen) ist die Besetzung des Bundespräsidenten (ein Job ohne rechte Bedeutung, den man problemlos abschaffen könnte), schlicht und einfach irrelevant.
warum nur haben sich die medien verpflichtet gefühlt bei wulff so lange nachzuhaken und nahezu im halbtagestakt "neue skandale aufzudecken"? liegt es am bevorstehenden eurokollaps? wegen irgendwelcher äusserungen, die er irgendwann mal getätigt hat?
die bild, also sozusagen das paradebeispiel für hochwertigen deutschen journalismus, fühlte sich verpflichtet informationen preiszugeben (drohanruf), sie jedoch anfangs nicht selbst zu publizieren.
für ein sensationsblatt dieser grössenordnung etwas seltsam, oder?
vielleicht erfahren wir irgendwann in der zukunft warum man selbst über ein geschenktes bobbycar (vom autohändler der wulffs) öffentlich diskutieren musste, wo doch auf der welt zur gleichen zeit so wichtige entscheidungen zu
euro esm
griechenland
sopa, pipa
acta
etc.
getroffen wurden.
http://www.facebook.com/hellassolidarity
"Es können Wetten darauf abgeschlossen werden, dass diese ganze Schar von Rettungsplänen – die jedesmal als die „allerletzten“ dargestellt werden – kein anderes Ziel verfolgt hat, als die Position Griechenlands immer mehr zu schwächen, um ihm – ohne jede Möglichkeit, von sich aus die Bedingungen einer Umstrukturierung vorzuschlagen – dadurch aufzuzwingen, dass es alles seinen Gläubigern überlässt, um der erpresserischen Alternative „entweder die Austeritätspolitik oder die Katastrophe“ zu entkommen. Die künstlich erzwungene Erschwerung des Verschuldungsproblems ist auf diese Weise als eine Waffe eingesetzt worden, um ein ganze Gesellschaft im Sturmangriff zu erobern. Wir sind uns dessen wohl bewusst, dass wir hier Begriffe aus dem Bereich des Militärischen benutzen: Es geht eben wirklich um einen Krieg, der mit den Mitteln der Finanzen, der Politik und des Rechts ausgetragen worden ist, einen Klassenkrieg, der gegen die gesamte Gesellschaft geführt worden ist"
http://theeuropean.de/anthony-grayling/9967-moderner-konservatismus-und-bildung