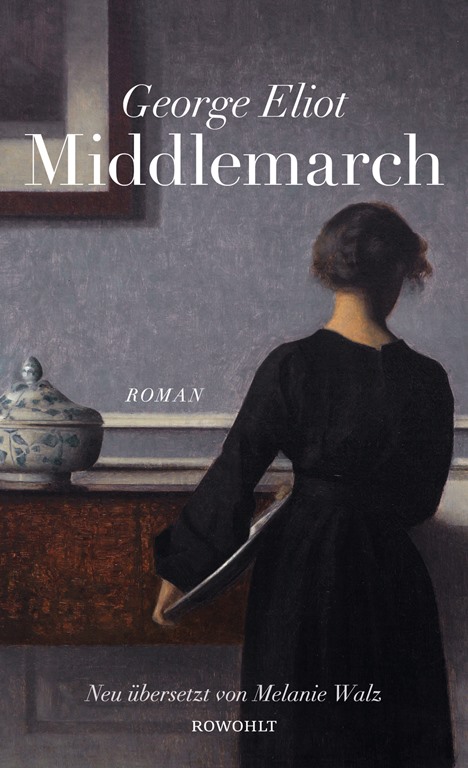“Das Geschenk”. Ein kleiner Auszug.
Aber so spannend ist das nicht, also kehre ich zu der Krankenhausnacht vor der Transplantation zurück. Eine Nacht, in der niemand schlafen konnte. Die Zeit zog sich wie Kaugummi in die Morgendämmerung hinein. Meine Frau und ich legten sich jeder auf ein frisches, unbenutztes Bett. An Schlaf war nicht zu denken, während die Nervosität über die Bettdecke kroch und ich im kühlen Raum die horizontale Lage übte, als ob ich vorausahnte, für Wochen keine andere mehr einnehmen zu können. Wir sprachen wenig. Gegen Morgen kam die Schwester und sagte lapidar, dass es gleich losginge. Da lag ich schon mit den weißen Thrombosestrümpfen auf dem Bett und muss mir wie ein bemitleidenswerter Transvestit vorgekommen sein. Jetzt musste auch noch der Slip weichen unter dem hinten geknoteten, kitschig bläulich gepunkteten Engelshemd. Immer ungeschützter setzte sich mein Körper der bevorstehenden Operation aus. Wir machten kein Auge zu in dieser nicht enden wollenden Nacht. Wie auch, vor einer Reise, von der man möglicherweise nie wieder zurückkehrte.
Während das Operationsteam um den leitenden Oberarzt herum an einem bis ins kleinste vorausgeplanten Ablaufdiagramm feilte, lag das knapp zwei Kilogramm schwere, rotbraune Fleischstück also zur Begutachtung unter den Augen eines anderen kontrollierenden Spezialisten. Von einer befürchteten Dramatik war nichts zu spüren, die Ruhe verströmte eher eine Banalität, die dem Ernst des Beabsichtigten diametral entgegen stand. Als das erste Morgenlicht diffus in das Krankenzimmer kroch, öffnete sich die Tür und wie eine Art Befreiung wirkte der lapidare Satz der Schwester im blauen Kittel: „Es geht los!“ Mit dem Bett wurde ich zum Fahrstuhl und durch zahlreiche Gänge auf den Flur in den OP-Vorraum geschoben. In äußerster Eile erschien eine Assistentin in der Tür. Sie benötigte noch eine Einwilligungsunterschrift für die Anästhesie. Die Verwaltung konnte nicht anders als jeden in diesem Riesenmoloch letztlich auf den Strichcode eines Klebestreifens zu reduzieren. Theatralisch hätte man sich den Abschied von meiner Frau vorstellen können, aber auch das erschöpfte sich in aufbauenden Floskeln wie: „Wir schaffen das.“ Ich war merkwürdig ruhig und ergeben, als wäre alles nur ein Spiel und jetzt ohnehin nichts mehr daran zu ändern. Dabei hätte doch der Anfangssatz des „Malte Laurids Brigge“ in Paris das Szenario merklich aufgewertet: „So, also hierher kommen die Leute um zu leben, ich würde meinen, es stürbe sich hier.“ Doch der Bruder des Schlafes sollte noch warten müssen, der Schlaf selbst aber befand sich in den Narkosespritzen der geschäftigen Ärzte um mich herum. Die dachten weniger an Literatur, sondern beschwichtigten routiniert mit dem Hinweis: „Nun träumen Sie mal schön von Urlaub, Sonne und Südsee.“ So wie ich nun dieses größtmögliche, letzte Geschenk von jemand Unbekanntem bekam, so dachte ich auch an die Möglichkeit, daß sich ein letztes Tuch über mein Gesicht senken könnte und mich ebenfalls für immer namenlos machte. Die Kanülen bohrten sich in die Venen beider Arme, den Sauerstoff atmete ich tief durch eine Maske. Vom Operationssaal sah ich nichts mehr, es wurde schwarze Nacht für mich an diesem gerade hell werdenden Wintermorgen.
Es reicht nicht die Augen zu schließen, um sich eine Vorstellung vom Nichts zu machen. Nichtvorhandensein ist ein Ausnahmezustand, der dem Subjekt fremd ist. Wie sollte ein Ich jemals jenseits der Vorstellung sein, überhaupt vorhanden zu sein? Ein Mensch in der Narkose träumt nicht, denkt nicht, fühlt nicht, er ist ein Stück narkotisiertes Fleisch.
Das Aufwachen war nicht grausam, aber das schreckliche Neonlicht blendete. Man findet sich sofort wieder ein im alten Ich oder war es ein neues? Intensivstation mit Stimmen. Ich war nicht allein. Eine Schwester stand an einem Monitor, eine Stimme fragte:
„Da bist du ja, hast du Schmerzen?“
Was empfindet ein Körper, wenn der Bauch weg ist und Schwäche zur Angst hinzukommt, sich irgendwo zu berühren. Da muss eine schreckliche Wunde sein in der fehlenden Mitte, ein tausend Meter tiefes Loch. Das Bewegen meiner Arme fiel mir schwer.
„Es ist alles gut gelaufen, trinken darfst du noch nichts.“
Da lag ein wunder Leib, ein kraftloser Körper von Schläuchen und Beuteln umgeben im Bett, neben dem ein einzelner Computermonitor und ein ganzer Ständer voll Überwachungsgeräte und Diffusoren standen. Flüssigkeiten wurden an beiden Seiten des Bettes in Plastikbehältern außerhalb von mir aufgefangen. Es floss ständig etwas aus mir heraus. Urin und Wundwasser, Blut und Schaum. Alles der Gesundheit unzuträglich Überflüssige sollte heraus. Das einzige was hinein sollte war Luft durch die Nase, angereichert mit Sauerstoff durch einen Schlauch und erst nach Tagen gab man mir die Stäbchen zum Zähneputzen, mit denen ich mir heimlich den trockenen Mund benetzte. Permanent verabreichte man Schmerzmittel und Medikamente durch den ZVK. Das klingt wie „Zentrales Verzeichnis der Kinderbücher“, ist aber der Zentrale Venenkatheder. Es gab nur eine Art zu liegen und zu schlafen: Rückenlage. Woche um Woche würde ich von nun an auf dem Rücken liegen, auf dem Rücken schlafen. Rücken, Rücken, Rücken. Ob man sich jemals wieder auf die Seite drehen konnte? Umringt durch die seitlichen Schläuche, die in die Beutel mündeten, anfangs noch einen Katheder zwischen den Beinen, auf den ich Acht geben musste, dass der Schlauch nicht abklemmte. Denkt man an das Ende des Lebens, das man sich sowieso nur schwer vorstellen kann? Die Welt ohne mich? Unwillkürlich kreisen die Gedanken auch um das Sterben. Der Nachtschwester habe ich ein Gedicht aufgesagt, wie peinlich. Das war der Euphorie des Überlebens, des wieder auferstandenen Seins geschuldet. Ich hechelte nach Sinn, wollte wohl gar mit meiner Hilflosigkeit kokettieren. Zeitweise fühlte ich mich wie ein Anderer, ein klarerer, ernsthafterer Mensch, der seinem Leben einen Hauch von Wahrhaftigkeit geben würde. Das Gedicht schien mir wohl wie ein letztes Abschiedswort, etwas womit ich in Erinnerung bleiben wollte. Ich sprach es bestimmt zu feierlich, überhaupt sich selbst zu zitieren, pathetisch. Die Schwester schien einen Moment irritiert, aber einordnen konnte sie das Gehörte in ihr normales Leben nicht. Sie stand da mit dem verwunderten Blick, wie man Patienten ansieht, wenn sie merkwürdige, unerklärliche Dinge tun. Aber jetzt war ich ja nicht mehr nur ich, mein Ich war jetzt auch ein anderer. Es hatte natürlich auch damit zu tun, dass man in einem Krankenhaus einen Teil seines Schamgefühls ablegte und gerade Männer suchen diese Nähe des Weiblichen, um das Gefühl zu haben, noch am Leben zu sein. Das Gedicht liegt immer noch in einer ausgefransten, hellroten Mappe meines Schreibtisches, eine unerreichbare Liebe scheint die Adressatin:
„Jenseits aller Zeit“:
Wenn ich einmal jenseits aller Zeit bin
Sollst du die Seiten meiner Bücher haben
Sollst dich mit braunen Augen blätternd fragen: Welchen Sinn?
Wenn ich noch könnte würde ich dir sagen
Dein Gesicht zu sehen war Grund genug
Denn im Dunkel meiner Träume lag ich neben dir
Aber was sind Worte gleich Perlen einer Kette
Vor deiner Schönheit, vor der Anmut deiner Bewegungen
Und der Arglosigkeit deines Herzens?
Selbst die Farben deiner Kleider
Sie schmeicheln nicht dir, du schmeichelst ihnen
Und nie schien schwarzes Haar mir schöner
Ach könnte ich doch in Wolkenbetten schlummernd schlafen
Sanft dein Arm gelegt um mich
Und deine Augen wären Spiegel
In deren dunklem Licht wir uns in Träumen träfen
Doch nur verstohlen lauscht mein Blick der Stimme deiner Hände
Denn die Schönheit deiner Augen blendet viel zu viel