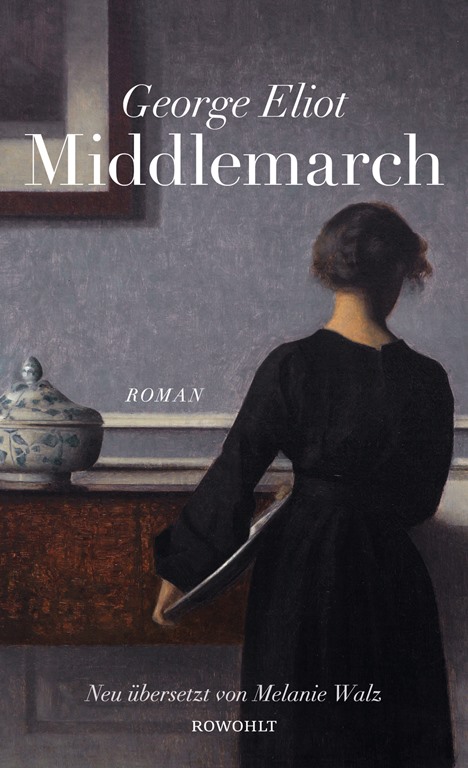Als man Briefe noch mit der Hand schrieb
Ein anderes Bild erzählt von einem Jahrmarkt in der Stadt, wo ich auf einem Karussell Mercedes fuhr.
Wenn man einen Brief wieder liest, den man vor ca. 35 Jahren schrieb, erscheint die Naivität ziemlich lächerlich und das peinlich um sich selbst kreisende, spätpubertäre Ich mag man(n) jetzt als überwunden empfinden. Aber man(n) sollte sich nicht täuschen, der Spiegel mag mittlerweile beschlagen sein, aber die Konturen bleiben sichtbar.
Spätsommer 1978
Liebe C.,
Klar ist am Morgen der See, ein Spiegel meiner Gedanken. Tote Worte, tote Liebe, wer bin ich, mich in Sätze zu pressen, die alles bezweifeln, wo deine Blumen auf dem Tisch nicht einmal verwelkt sind. Die ewig schwarze Tintenspur der gleichen Fragen: Leben, Liebe, Schönheit, Tod. Wozu? Wie schön, in deinen Augen noch die Unbekümmertheit zu finden, die ich verloren habe. Auch meine Angst, sie dir zu nehmen. Schau nicht zu oft in meine Augen, hinter den Träumen steckt der schleichende Virus des Zweifels.
Gestern war der Tag unserer Schönheitsdiskussion, und es ist wahr, auf die Dauer werde ich nicht schön genug für dich sein. Zum Teufel mit der Welt und ihrem Schönheitsmarkt. Sollen sie an ihren Makeup-Fassaden ersticken, soll ihre Eitelkeit ein Spiegel ihrer Dummheit sein. Wir Spielbälle der Zeit, des Konsums, der Lüge. Selbst auf dem Friedhof werden wir sie nicht los, die Schleifen und Kränze, unsere kostbaren Schönheitsutensilien, wir eitlen, schwarzen Heuchler. Ich baue dir ein Zimmer mit Boden, Decke und Wänden nur aus Spiegeln, und eine unendliche Straße nur aus Schaufensterglas. Auf dass du im ewigen Anblick deiner selbst versinkst und deiner Schönheit hoffentlich letztlich überdrüssig, dir deiner ganzen Nichtigkeit bewusst wirst. Denn wir sind überflüssig und hinterlassen keine Leere, der Zug fährt ohne uns weiter. Sinn und Ziel der Reise sind uns unbekannt, aber es scheint mir, als ob man beides am besten verfehlt, wenn man als aufgeplusterter Pfau vor der letzten Station unbedingt den Lidschatten erneuern muss. Ich liebe die Schönheit der Alten, ihre Runzeln und Falten, denn ihre Gesichter erzählen Geschichten und ihre Augen leuchten voll gebrochener Schönheit. Die Welt ist ein Markt voll prostituierter Haut und die Schönheit die ich meine, ist weder jung noch käuflich. Ich bin der Schönheit überdrüssig, es sind verschwendete Worte. Du bist schön, aber ich liebe nicht nur deine Schönheit! Zu früh habe ich am eigenen Körper ihre Unwichtigkeit erkannt. Eigentlich ist es kein Neid, der aus mir spricht, obwohl ich zu einem bestimmten Teil auch aus Hässlichkeit, Krankheit, Tod und Zweifel bestehe. Aber gerade dieser Teil hilft mir dabei, meine Gedanken auf das Wesentliche zu richten und mehr zu erkennen als die Oberfläche.
Ich habe Lust dir ein bisschen von mir zu erzählen, nur so verstehst du mich etwas besser. Geh in Gedanken ein Vierteljahrhundert zurück, die Welt muss noch elf Jahre auf dich warten. Deine Mutter ist ein junges Mädchen, und ich werde nicht weit von hier am dritten März (die zwei Glückszahlen gefallen mir) geboren. In einem alten Haus in der Mitte eines kleinen Dorfes. Welch Zufall, jetzt in einem ähnlichen zu wohnen. Wenn ich an meine Kindheit denke, bin ich weit davon entfernt, mich jetzt noch in ihr zu erkennen. Ein pausbäckiger, blonder Purzel, gesund, mit einer Pfirsichhaut. Nur auf einem Foto sehe ich schon meine verweinten, großen Augen, die habe ich nicht verloren. Ich mochte wohl damals die Situation im Fotostudio nicht und war empfindlich gegenüber dem Photographen. Weniger als ein Jahr alt, soll ich mein Bettzeug aus dem Fenster geworfen haben, schraubte einen Gitterstab aus meinem Bett, und machte mich auf eine Flucht, bei der ich nicht weit kam. Ein anderes Bild erzählt von einem Jahrmarkt in der Stadt, wo ich auf einem Karussell Mercedes fuhr. Ein weiteres Foto zeigt mich vorn auf dem Motorrad meines Vaters, einer silbermetallischen und roten Triumph mit 250 ccm Hubraum.
Später spielte ich mit Nachbarsjungen und anderen Cowboy und Indianer. Es war die Zeit als man Karl May las, kleine Spielzeugfiguren sammelte und mit einer Gummizwille auf andere schoss. Jugendliche können sehr grausam untereinander sein. Meine Großmutter hörte derweilen nicht auf, mich stundenweise mit Wurst- und Butterbroten vollzustopfen. Dann wurde mir irgendwann die große Zuckertüte in den Arm gedrückt, und es begann das lange Elend der Schule. Immer der beste und beim Sport der schnellste, wollte man mich unbedingt auf das Gymnasium schicken. “Aus dem Jungen soll mal was Besseres werden.” So hießen in etwa die Kommentare. Ich vergaß, dass mein Vater mich windelweich prügelte, wenn ich meinen Teller beim Essen nicht restlos aufaß. Mein Kinderteller hatte einen kleinen Bären in der Mitte und erst wenn dieser ganz sichtbar war, durfte ich auch nur daran denken, mit dem Essen aufzuhören.
Die Sexualmoral, die sie aus dunklen Zeiten mitbrachten, war auch nicht besser. Ich bekam es mit dem Teppichausklopfer nach den Doktorspielen mit anderen kleinen Jungen und Mädchen, wo man doch nur neugierig war, was sie unter ihren Hosen und Röcken verbargen. So lernte ich die Angst und das Schuldgefühl kennen. Das verurteilende „Bebe!“ oder „Igittigitt!“ wurden zu Bestandteilen meiner Kindersprache, wenn ich zum Beispiel in der Badewanne mein Glied berührte. Die Körperfeindlichkeit meiner Eltern war natürlich nur ein Produkt ihrer Erziehung, aber ich kann mich nicht daran erinnern, meine Eltern nackt gesehen zu haben. Ich glaube am Anfang war ich ein Muttersöhnchen und liebte niemand. Ein Feigling dazu, der vor den anderen davonlief, wenn sie ihn verprügeln oder an den Marterpfahl binden wollten. Irgendwann muss ich mich in ein zweites Ich verkrochen haben, das sich vor der Welt zurückzog, die es nicht verstand und von der es nicht verstanden wurde. In mich gekehrt, hypersensibel, schnell verletzt und beleidigt war ich schon damals ein zusammengerollter Igel. Die wirkliche Gemeinschaft, das Aufgehen in einer Gruppe, zweifelsfreie Harmonie habe ich nie erlebt. Ich hatte mich abgesondert, blieb immer ein Fremdling unter den anderen. Ich habe den Gedanken nicht ertragen, dass letztlich jeder allein ist, in sich selbst gefangen, mit einer Vakuumblase um sich herum, im dicken Wintermantel, von hohen Mauern umgeben. Nie konnte ich mich völlig mit etwas identifizieren. Ich erkenne mich in Sonderlingen mit schiefer Nase, Buckel oder Hasenscharte, im Einsiedler mit langem Bart. Ein kleiner Hobbyphilosoph mit gut gepflegten Neurosen. Ich weiß nicht genau, inwieweit diese Wandlung vom relativ gesunden Normalkind zum introvertierten schwierigen Fall mit der Krankheit zusammenfällt, die ich schon mit vierzehn Jahren bekam. Zumindest sehe ich da einen tiefen Einschnitt in meinem Leben. Ich wollte nie in einem Krankenhaus liegen. Es erscheint mir auch heute noch wie eine Vorstufe des Todes.
Ich ertrage es kaum, über mich zu schreiben, es scheint mir eine zu banale Geschichte. Oft kommt mir der Gedanke, mich selbst zu wichtig zu nehmen und andererseits wieder nicht wichtig genug, wenn ich mein immer noch defizitäres Selbstbewusstsein betrachte. Vor der Krankheit war ich im Fußball- und Tischtennisverein, hatte brav meine Konfirmation mit mir feiern lassen, war durchschnittlich intelligent, mit einem kleinen Knacks, auf dem Gymnasium nicht mehr der allerbeste wie in der Volksschule zu sein. Ein schüchternes, pubertierendes Söhnchen mit Pickeln, großen Füßen und der innerlichen Arroganz des verkannten, zweiten Albert Einstein. Mit einem Wort, sich zwar für alles andere als normal haltend, aber dennoch stinknormal zu sein. Die Schule schwänzte ich vierzehn Tage lang und blieb in der siebten Klasse mit zwei „Koffern“ im Zeugnis sitzen. [So nannte man eine Fünf, die zweitschlechteste Note vor der Sechs] An die zwei Lehrer der beiden Fächer Mathematik und Englisch erinnere ich mich gut. Den einen traf ich kürzlich im Kaufhaus und fühlte mich immer noch als unartiger Schüler, der andere trug Brille, eine Zigarre im Gesicht und die Nase wirklich so hoch wie ein englischer Aristokrat. Bei diesen zwei älteren Herren Unterricht zu haben, mag scheußlich gewesen sein, aber sie hatten etwas Faszinierendes von der „guten alten Zeit“. Der moderne Unterricht geschniegelter, angepasster Junglehrer in gewienerten, sterilen Klassenräumen, computergesteuert, didaktisch planquadriert ist möglicherweise unmenschlicher als der autoritäre von damals. Heute ist nicht mehr eine Person autoritär, sondern der ganze ferngesteuerte Mechanismus Schule selbst. Der Mensch wird überhaupt nur noch als Einheit und Nummer verwaltet. Er ist dabei, sich als Lochkarte [1978!, noch kein Microsoft PC weit und breit] selbst zu automatisieren. Neben der Schule mit ihren gelegentlich auch mal gutmütigen Lehrern fraß mich noch etwas anderes im Inneren auf. Plötzlich war es einfach da: das sich vermehrende Gelb in den Augen, die Übelkeit im Bus, der Durchfall, die matte Lustlosigkeit, die schnelle Erschöpfung. Ahnte ich damals schon, dass es mehr werden würde als eine einmalige sechswöchige Gelbsucht? Heute bin ich von meiner chronisch-aggressiven Hepatitis nicht mehr zu trennen. Manchmal meine ich, sie allein hätte meinen Platz eingenommen und ich wäre nur noch ihr Abbild. Seit damals haben die Läuse nicht aufgehört, über meine Leber zu laufen. Um mich zu begreifen, muss man diese Art Kranksein verstehen. Sie beeinflusste nicht nur meinen Körper, dessen Zustand sie wohl nur verschlechterte. Mein Charakter, meine Psyche, mein Innenleben, Geist, Gefühl und das, was man wohl die Seele nennt, scheinen mir auf sonderbare Weise in mancher Hinsicht profitiert zu haben. Ich bin im Großen und Ganzen ein ruhiger, friedliebender Mensch geworden, vielleicht zu empfindlich, aber mit ehrlichen Gefühlen und einer Bereitschaft zum Verständnis, so bilde ich es mir zumindest ein. Der Typ mit Erfolg im Fußball, blond, blauäugig und strotzend vor Gesundheit und Selbstüberzeugung wäre nicht unbedingt liebenswerter. Im Krankenhaus hatte ich Zeit nachzudenken, Bücher zu lesen, ich war auf mich selbst zurückgeworfen. Die Außenwelt existierte nicht wirklich, alles reduzierte sich auf die automatisierte Maschinerie einer Bettenbude. Trotz des Bettnachbarn war ich irgendwie mit mir allein. Meine Gedanken- und Gefühlswelt hörten nicht auf zu wachsen. Da gab es Zeit zum Grübeln, Philosophieren, zum Traurigsein und zum Träumen. Von was träumte ich damals anderes, als jemand zu lieben wie dich. Du bist mein Traum, gestern, heute und morgen. Mein Traum heißt Liebe in einer Welt der Einsamkeit.
Heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint auf die alte Mauer hinter meinem Fenster, das Licht spielt auf dem Rasen, das Moos in den Ritzen ist noch grün, ein warmer Tag im Herbst. Die Blätter werden bunter, bevor sie sterben. Bunt wie der Schmetterling an der Glasscheibe, den ich gleich hinausfliegen lasse. In mir ist eine Mischung aus Schwermut, Ruhe und Besorgtheit. Ist die Zukunft wieder ein schwarzes Loch oder ein heller Morgen? Aus vielen Fenstern kannst du sehen, aber nur hinter wenigen fühlst du dich zu Haus. Dies Fenster, vor dem ich jetzt sitze, und auf die steile Steintreppe, die den Hügel hinauf zum Garten führt, gibt mir das Gefühl, an meinem Platz zu sein. Hier könnte ich die Ruhe haben zu schreiben. Aber ich muss auch über mich selbst lachen, wenn ich daran denke, dass mein ganzes Schreiben nur der Ausfluss einer Unfähigkeit sein sollte zu leben. Ständige Kompensation des Unerträglichen, wobei es letztlich interessant ist, ob die Welt oder das Leben allgemein einfach unerträglich sind oder ich mich nur selbst nicht ertragen kann? Schon oft habe ich versucht zu schreiben, immer dann, wenn sich in mir Gefühle und Gedanken aufstauten, wie in einem Gefäß, das ständig neue Flüssigkeit aufnimmt und irgendwann einmal überläuft. Diese Schreibversuche fanden immer dann statt, wenn ich unglücklich, verzweifelt oder verliebt war. Gerade in letzterem Zustand gelangen mir schon mehrseitige Liebesbriefe. Sogar Anfänge einer Erzählung, in der ich mich als Person von außen zu beschreiben versuchte, zu einem „Er“ wurde und mich konsequent versteckte. Das veränderte mich aber nicht allzu sehr, da die gleiche Person nur in einer anderen Form über sich selbst schrieb, um einen künstlichen Abstand zu sich herzustellen. Was mir zum Teil ein korrupter Trick zu sein scheint. Denn abgesehen davon, dass auch ich mich weit von Menschen, Welt und Wirklichkeit entfernt fühle, indem ich mich immer mehr in mich selbst zurückziehe, und somit bewusst die Isolation und Einsamkeit suche und verschulde, unter der ich dann zu leiden meine, ist mir die scheinbare Objektivität und Tatsachennähe der Nachrichtenwelt in Zeitung, Funk und Fernsehen ein Gräuel und von dieser Wirklichkeit, von einer gemeinsam gedachten Welt, von einem verständnisvollen Zusammenleben, ebenso meilenweit entfernt wie ich. So bin ich bereit, die Wirklichkeit des Traums oder angeblicher Phantasterei, für oft realer zu halten, als das, was wir nach dem Aufwachen als das Zuschlagen einer unentrinnbaren Wirklichkeit empfinden, als ein traumtötendes Trauma. Denn wo sonst liegt in dieser Welt, die so vernünftig ist, Atombomben zu bauen und Millionen Menschen gleichzeitig verhungern zu lassen, die sich nur noch um Geld, Aktienkurse und Rationalisierungen dreht, die sich im Grunde selbst schon als sinnlos begriffen hat, es aber nicht wahrhaben will, die letzte Hoffnung, wenn nicht in der Phantasie und den Träumen, die sich einer solchen Realität verweigern?