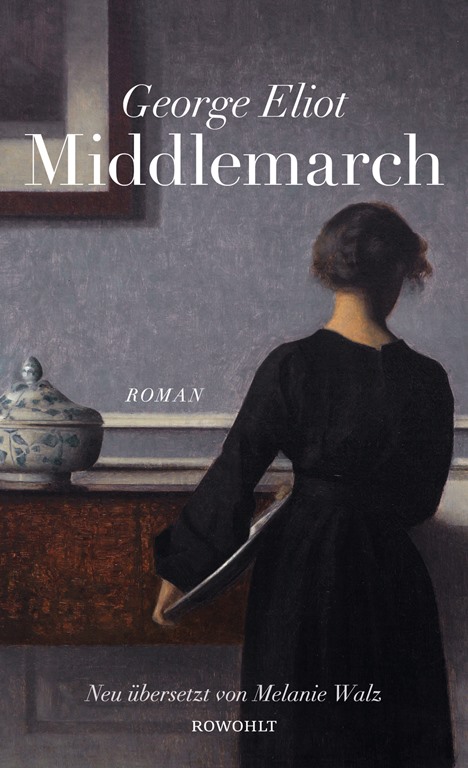Roberto Bolaño: Begegnung mit Enrique Lihn
To see the postcard from Bolaño to Enrique Lihn follow the link to the article, 1983. © Robert Bolaño, used with the permission of The Wylie Agency and the Getty Research Institute, reblogged from this article by Annette Leddy, “east of borneo”
für Celina Manzoni
Nachdem ich 1999 aus Venezuela zurückgekehrt war, träumte ich, in das Haus gebracht worden zu sein, in dem zu Lebzeiten Enrique Lihn wohnte, in einem Land, das gut Chile hätte sein können, in einer Stadt, die gut Santiago hätte sein können, in dem Bewusstsein, dass Chile und Santiago einst der Hölle ähnelten, und dass diese Ähnlichkeit in irgendeiner unterirdischen Schicht der realen Stadt und der eingebildeten Stadt für immer bestehen bliebe. Natürlich wusste ich, dass Lihn tot war, aber als man mich aufforderte, mitzukommen, um ihn kennenzulernen, hatte ich keinerlei Einwände. Vielleicht dachte ich an einen Scherz dieser Leute, die alle Chilenen waren und mit mir kamen, vielleicht an die Möglichkeit eines Wunders. Das Wahrscheinlichste aber ist, dass ich an nichts dachte oder dass ich die Einladung missverstand. Fest steht, dass wir zu einem siebenstöckigen Gebäude mit einer in einem blassen Gelb gestrichenen Fassade und einer Bar im Erdgeschoß kamen, eine Bar von nicht zu verachtenden Ausmaßen, mit einer langen Theke und etlichen Nischen, und meine Freunde (obwohl es mir komisch vorkommt, sie als solche zu bezeichnen, sagen wir besser: seine begeisterten Anhänger, die mich eingeladen hatten, den Dichter kennenzulernen) führten mich zu einer der Nischen, und dort befand sich Lihn. Am Anfang erkannte ich ihn kaum wieder, sein Gesicht war nicht das gleiche wie auf den Fotos seiner Bücher, er war schlanker und jünger, sah wesentlich besser aus und seine Augen glänzten viel heller, als die schwarz-weißen Augen der Schutzumschläge. In Wirklichkeit sah Lihn nicht mehr wie Lihn aus, sondern glich einem Hollywood-Schauspieler, einem jener zweitrangigen Darsteller in B-Movies, die es nie schaffen, in Europa aufgeführt zu werden und sofort in den Videotheken kreisen. Aber gleichzeitig war er Lihn, und obwohl er ihm nicht ähnelte, hatte ich keinen Zweifel daran. Die begeisterten Anhänger grüßten und sprachen ihn duzend mit seinem Vornamen an, was irgendwie übertrieben und falsch klang. Sie fragten ihn Dinge, die ich nicht hören konnte, und dann stellten sie mich vor, obwohl die Wahrheit ist, dass ich nicht vorgestellt werden musste, denn für eine Zeit lang, eine kurze Zeit, korrespondierte ich mit ihm und seine Briefe hatten mir in gewisser Weise geholfen, weiter zu machen. Ich spreche über die Jahre 1981 oder 1982, als ich zurückgezogen in einem Haus bei Girona lebte, mit beinahe nichts an Geld, noch der Aussicht welches zu bekommen, und die Literatur war ein riesiges Minenfeld, auf dem alle meine Feinde waren, mit Ausnahme einiger Klassiker (aber nicht aller), und täglich musste ich dieses Minenfeld durchqueren, einzig durch die Gedichte Archilochos bestärkt, wo doch die kleinste falsche Bewegung Unheil einbringen konnte. So ergeht es allen jungen Schriftstellern. Da kommt ein Zeitpunkt, an dem du dich auf niemanden stützen kannst, nicht einmal auf Freunde, noch weniger auf die anerkannten Autoren, niemand reicht dir die Hand. Publikationen, Preise, Stipendien erhalten die anderen, die ständig ihr „Jawohl, mein Herr“ wiederholt haben, oder jene, die voll des Lobes für die Literaturagenten waren, eine unendliche Horde, deren einzige Tugend es ist, das Leben als Polizeistaat zu begreifen, und dass ihnen niemand entkommt und niemandem vergeben wird. Nun ja, wie schon gesagt, es gibt keinen jungen Schriftsteller, der sich nicht so gefühlt hat am einen oder anderen Punkt seines Lebens. Aber damals war ich achtundzwanzig Jahre alt und unter keinen Umständen konnte ich mich als junger Schriftsteller betrachten. Ich war noch viel zu unbedarft. Ich war nicht der typische lateinamerikanische Schriftsteller, der in Europa dank der Mäzene (und des Patronats) eines Staates lebte. Niemand kannte mich und ich war weder gewillt aufzugeben, noch um Aufnahme zu ersuchen. Damals begann der Briefwechsel mit Enrique Lihn. Selbstverständlich schrieb ich ihm zuerst. Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ein langer und aus schlechter Laune heraus geschriebener Brief, wie man in Chile sagt, was heißt: mürrisch und jähzornig. In meiner Antwort sprach ich über mein Leben, über mein Haus auf dem Land, auf einem der Hügel außerhalb Gironas; vor meinem Haus die mittelalterliche Stadt und dahinter das Land und die Leere. Ich erzählte ihm auch von meiner Hündin, Laika, und dass die chilenische Literatur, mit zwei oder drei Ausnahmen, mir wie ein Haufen Scheiße erschiene. Seinem nächsten Brief konnte man entnehmen, dass wir bereits Freunde geworden waren. Daher lief es in der Folge auf das Typische heraus, was passiert, wenn ein angesehener Schriftsteller einen unbekannten zum Freund nimmt. Er las meine Gedichte und brachte einige davon in einer Art Lesung jüngerer Dichtung unter, die an einem nordchilenisch-amerikanischen Institut stattfand. In seinen Briefen sprach er über jene, von denen er annahm, sie würden die sechs Tiger der chilenischen Dichtung des Jahres 2000 bilden. Die sechs Tiger waren Bertoni, Maquieira, Gonzalo Muñoz, Martínez, Rodrigo Lira und ich. Glaube ich zumindest. Vielleicht waren es auch sieben Tiger. Nach meiner Meinung waren es nur sechs. Es dürfte schwer gewesen sein, unsere Anzahl sechs bis zum Jahr 2000 auch nur ein bisschen zu vergrößern, denn damals hatte Rodrigo Lira, der beste, den Freitod gewählt, und was über die Jahre von ihm übrig geblieben war, verrottete entweder auf irgendeinem Friedhof oder seine Asche verflog und vermischte sich weiter mit dem Straßendreck Santiagos. Man sollte lieber von Katzen sprechen als von Tigern. Bertoni, soweit ich weiß, ist eine Art Hippie, der am Meeresufer wohnt, wo er Muscheln und Seetang aufliest.
Fortsetzung folgt